"Anarchie ist machbar, Herr Nachbar!"
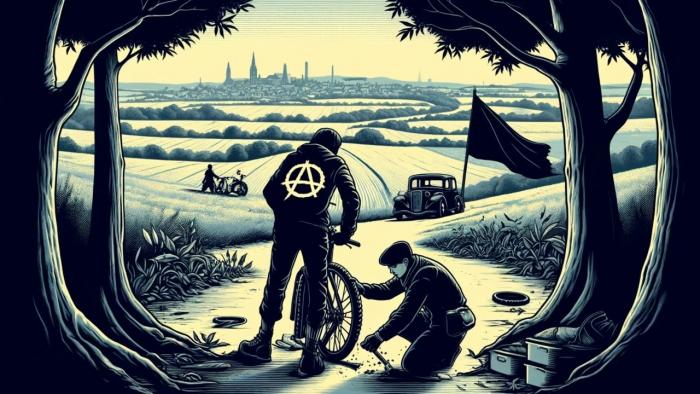
Illustration: Generiert von Künstlicher Intelligenz.
Ein spontanes Zweimann-Symposion an der Lahn: Vom Fahrradschlauch zum Freiheitskampf. Über Glanz und Elend des Anarchismus.
Lange hat mich die Frage gequält, warum alle Revolutionen, alle, ohne eine einzige Ausnahme, als Freiheitsbewegung begonnen und als Tyrannei geendet haben. Warum ist keine Revolution diesem Verhängnis entgangen?
Ignazio Silone
Jürgen lebt auf einem Grundstück am anderen Lahnufer. Um zu ihm zu gelangen, musste ich den Fluss überqueren. Ich beschloss, die nächste Brücke stadtauswärts zu nehmen. Ein Radweg schlängelt sich durch Felder und Wiesen.
Obstbäume stehen am Weg und ich sammelte Äpfel auf. Gerade als ich die Lahn überquert hatte, merkte ich, dass ich hinten einen Platten bekam. "Das hat ja gerade noch gefehlt", stöhnte ich und stieg ab. Den Rest des Weges musste ich schieben, um die Felge und den Mantel nicht zu beschädigen.
Es war richtig heiß und es lagen noch ein paar Kilometer vor mir. Völlig verschwitzt und erschöpft kam ich nach einer guten Stunde bei Jürgen an.
Er schenkte mir erst mal ein großes Glas Wasser ein und wir verspeisten die Nussecken, die ich aus meiner Lieblingsbäckerei mitgebracht hatte. Langsam kam ich wieder zu mir. "Dann flicken wir jetzt erst mal den Schlauch", sagte Jürgen. Wir stellten das Rad auf den Kopf und friemelten den Schlauch unter dem Mantel heraus.
Es war ein veritables Loch, aus dem zischend Luft entwich. Der Mantel hatte auch gelitten und Jürgen wechselte ihn aus. Er hatte irgendwo noch einen gebrauchten, aber gut erhaltenen herumliegen. Er zog ein paar Speichen nach, um einen Schlag aus dem Hinterrad zu entfernen, stellte die Schaltung neu ein und reparierte das Licht. Nach rund zwei Stunden war das Rad leidlich wiederhergestellt.
"Was ich über den Anarchismus wüsste"
Nach einer Probefahrt hockten wir uns in den Garten, tranken Wasser und redeten. Jürgen fragte mich, was ich über den Anarchismus wüsste.
Er war vor einiger Zeit mit einem Freund im Dannenröder Forst gewesen, den Umwelt-Aktivisten damals besetzt hatten, um den Bau einer Autobahntrasse mitten durch einen alten Buchenwald zu verhindern.
Ende 2020 beendete einer der größten Polizeieinsätze in der Geschichte des Landes Hessen die Besetzung. Die Aktivisten mit ihren dezentralen Strukturen, ihrer Ablehnung von Staat, Partei und Hierarchie stünden wohl eher in einer anarchistischen Tradition als einer marxistisch-kommunistischen. Jedenfalls sei das sein Eindruck.
Ich kramte zusammen, was ich über den Anarchismus in Erinnerung habe. Länger sprachen wir über den Spanischen Bürgerkrieg, der Glanz und das Elend des Anarchismus gleichermaßen offenbart hat.
Seine Stärke besteht für mich in der Betonung des revolutionären Geistes, des menschlichen Willens, in der Antizipation einer befreiten Gesellschaft. Veränderung braucht Zeit, aber sie beginnt heute! Also schaffen wir das Geld ab und demonstrieren, dass man auch ohne Geld leben und arbeiten kann.
Die Schwächen waren ein Mangel an Disziplin, die Vernachlässigung der politischen Sphäre und damit der Frage der Macht und die revolutionäre Ungeduld.
Marxismus und Anarchismus: Das Schisma
In meinen Augen war das Schisma zwischen Marxismus und Anarchismus, der Bruch zwischen Marx und Bakunin, der sich im Rahmen der Ersten Internationale vollzog, eine Katastrophe für die Arbeiterbewegung. Es trat etwas auseinander, was elementar zusammengehört, und, was noch schlimmer war, die auseinander gesprungenen Hälften der Bewegung begannen, sich bis aufs Messer zu bekämpfen.
So geschehen in der jungen Sowjetunion, als Lenin und Trotzki nach dem Ende des Bürgerkriegs begannen, die Anarchisten zu verfolgen und zu ermorden. Emma Goldman, die aus dem Baltikum stammte und vor dem Zarismus in die USA geflohen war, wurde 1919 in die junge Sowjetunion ausgewiesen.
Nach einer achtundzwanzig Tage währenden Schiffsreise stand sie an der Schwelle Sowjetrusslands. "Mein Herz klopfte in Erwartung und glühender Hoffnung", schreibt sie im dritten Band ihrer Lebenserinnerungen.
Solange die Revolution gegen die weiße Konterrevolution kämpfte, war sie bereit, über manche in ihren Augen problematische Entwicklung hinwegzusehen und ihren Widerstand gegen Verhaftungen und Hinrichtungen von Oppositionellen aufzuschieben.
Der Anarchist Nestor Machno, der seine Massenbasis in der Ukraine besaß, kämpfte mit einer rund 15.000 Männer umfassenden Armee an der Seite der Roten Armee und bewahrte sie einige Mal vor Niederlagen. Mit tatkräftiger Unterstützung der Machnowtschina gelang es Ende 1920, die letzten Reste der Weißen Armeen von russischem Territorium zu vertreiben.
Jetzt schien Emma die Zeit gekommen, die Verheißungen der Revolution einzulösen. Sie wurde beim Genossen Lenin vorstellig, um ihn an diese zu erinnern. Statt Machno und den Anarchisten für ihren Einsatz im Kampf um die Errungenschaften der Oktoberrevolution zu danken, begannen die Bolschewiki nach dem Sieg im Bürgerkrieg umgehend mit deren gnadenloser Verfolgung.
Emma Goldman verließ 1921 die Sowjetunion und schrieb:
Meine Träume zerstört, mein Glaube gebrochen, mein Herz ein Stein. ‚Matuschka Rossija‘ blutend aus tausend Wunden, ihre Erde bedeckt mit Toten.
Machnos Männer in der Ukraine wurden von den Bolschewiki zu Kriminellen und Banditen erklärt und von der Roten Armee gnadenlos gejagt. Machno gelang es, das Land zu verlassen; er schlug sich fortan in Paris als Arbeiter durch. Dort traf er sich gelegentlich mit den spanischen Anarchisten Durruti und Ascaso und versuchte, sie in ihrem Kampf für einen freiheitlichen Kommunismus zu unterstützen.
Der unselige Bruderkampf
Doch das Trauerspiel in der jungen Sowjetunion wiederholte sich im Spanischen Bürgerkrieg, als im Frühjahr 1937 in Barcelona eine gnadenlose Verfolgung und Ermordung von Anarchisten und Trotzkisten einsetzte. George Orwell hat diesen unseligen Bruderkampf, der einen maßgeblichen Anteil an der Niederlage der republikanischen Kräfte im Spanischen Bürgerkrieg hatte, in seinem Buch Mein Katalonien eindringlich beschrieben.
Als Durruti nach seiner Ermordung im November 1936 zu Grabe getragen wurde, erwiesen ihm rund 500.000 Tausend Menschen die letzte Ehre. Emma Goldman ließ es sich nicht nehmen, an seinem Grab eine ergreifende Rede zu halten. Da schien der Ausgang des Kampfes noch offen.
Nach dem Triumph Francos und der Faschisten
Nach dem Triumph Francos und der Faschisten war es vorbei mit dem Anarchismus. Er überlebte nur noch in den Herzen und Köpfen einzelner Menschen. Rossana Rossanda reiste Anfang der 1960er-Jahre im Auftrag der italienischen Kommunistischen Partei, deren Zentralkomitee sie angehörte, nach Spanien, um sich ein Bild vom Kampf gegen Franco zu machen.
Sie fuhr zunächst nach Barcelona, wo sie sich auch mit Genossen von der CNT, der einst stolzen und großem anarchistischen Gewerkschaft, treffen wollte. "Gibt es die hier?", fragte sie. "Ja, aber mit Kommunisten reden sie nicht." "Mit wem reden sie?", fragte sie weiter. "Mit niemandem", erhielt sie zur Antwort.
Sie redeten dann doch mit der italienischen Genossin. Man traf sich in einem abgelegenen Dorfgasthaus. Die CNT war einmal die stärkste Kraft Spaniens gewesen, mit anderthalb oder gar zwei Millionen Mitgliedern. "Wie viele seid ihr, wollt ihr mir das verraten?" "Wir sind fünfundachtzig." "Fünfundachtzig, wo?"
"Fünfundachtzig insgesamt, hier in Katalonien, praktisch nur hier in Barcelona." Ihre Organisation war zerstört. "Es ist sehr schwer, zu fünfundachtzig zu sein", fügte er hinzu. "Wahrscheinlich haben wir viele Fehler begangen." Und: "Die Jungen kommen nicht zu uns. Sie verstehen uns nicht."
Die Wiederbelebung anarchistischen Gedankenguts
Das änderte sich einige Jahre später, als die weltweite Jugend- und Studentenrevolte zu einer Wiederbelebung anarchistischen Gedankenguts führte. Aber, wie wir wissen, zerfiel auch diese Revolte nach wenigen Jahren. Und wieder ist es so, dass ihre Gedanken in den Köpfen einzelner und in kleinen Gruppierungen weiterleben.
Eine dieser Gruppen sind möglicherweise die Waldbesetzer (oder Teile von ihnen), in deren Kampf ein anderer Begriff von Veränderung aufscheint: Was jetzt umgewälzt werden soll, ist die Alltäglichkeit, der Lebenszusammenhang, die ganze Art und Weise zu produzieren und zu konsumieren und in der Welt zu sein.
Es geht nicht nur darum, den CO2-Ausstoß zu verringern, sondern das Raubbauverhältnis dieser Gesellschaft in Bezug auf die Natur zu beenden. Auch bei den alten Anarchos in Italien und Spanien gab es die Redewendung: Man geht "in die Berge" oder "in den Wald". Einmal, um sich der Verfolgung zu entziehen, dann aber auch, um ein Leben ohne Herren und in größtmöglicher Freiheit zu führen.
"Von fast nichts leben zu können"
Ein spanischer Genosse pries 1936 Franz Borkenau gegenüber die Fähigkeit der kastilischen Arbeiter, "von fast nichts leben zu können". Wenn Macht aus Enteignungen rührt und auf ihnen basiert, gilt im Umkehrschluss: Macht erlischt in wieder angeeigneten Lebensbedingungen, die geschichtlich unter die Kontrolle von Herrschaft und Profit gebracht worden sind. Aneignung ist Selbstermächtigung und Aufhebung von Macht.
Schon Rousseau wusste das, als er fragte: "Welches Joch kann man Menschen auferlegen, die nichts brauchen?" Noch viel früher soll Sokrates nach einem Gang über den Markt gesagt haben: "Schön, all die Dinge zu sehen, die ich nicht benötige!"
Dem "anständigen sozialdemokratischen Arbeiter" waren die Gestalten aus dem gesellschaftlichen Untergrund lediglich Kanaillen. Mit Bettlern, Fahrenden, Schmugglern, Vagabunden, Nichtstuern, Bummelanten, Huren und gewöhnlichen Kriminellen wollte er nichts zu tun haben.
Ein Bündnis mit "der Welt der Abenteurer und Räuber"
Eine Ausnahme bildete hier der Anarchismus. Vor dem Hintergrund russischer Erfahrungen sah Bakunin zum Beispiel im Räubertum einen volkstümlichen und spontanen Protest gegen despotische Verhältnisse und propagierte ein Bündnis mit "der Welt der Abenteurer und Räuber", die in seinen Augen die wahren Revolutionäre und Hüter des Geistes der Revolte waren.
Franz Borkenau ist dieser anarchistischen Tradition noch im Spanischen Bürgerkrieg begegnet. "Ihr stammt von bürgerlichen Handwerkern ab; unsere Vorfahren waren Räuber", erklärt ihm ein spanischer Genosse den Unterschied zur Arbeiterbewegung im Norden Europas, in der erst Ordnung herrschen musste, bevor Revolution sein durfte.
Der Anarchismus birgt eine Menge von Ansätzen und Ideen, die noch heute oder gerade heute wieder aktuell sind. Der große marxistische Historiker Eric J. Hobsbawm hat in einem Beitrag für das Kursbuch 19 über den Anarchismus gesagt:
Ebenso wie vor 1914 scheint der Anarchismus heute wieder eine passende Antwort bereitzuhalten. … Die Revolution würde kommen, weil die Revolutionäre sie mit solcher Leidenschaft ersehnten und fortwährend aufrührerische Handlungen begingen, von denen sich eine früher oder später als der Funken erweisen würde, der die Welt in Brand setzt. … Der Anarchismus kann uns manche wertvolle Lehre erteilen, weil er – in der Praxis stärker als in der Theorie – ein ungewöhnliches Feingefühl für die spontanen Elemente von Massenbewegungen hatte.
Eric J. Hobsbawm
Langsam wurde es kühl unter den Bäumen, und wir beendeten unser Zwei-Mann-Symposion. Ob das, was wir da über Anarchismus erörtert haben, mit den Besetzern des Dannenröder Forstes etwas zu tun hat, wussten wir beide nicht.
Wahrscheinlich hatten und haben sie weder Lust noch Zeit, sich über solche Dinge Gedanken zu machen und sich zu fragen, in welcher Tradition sie und ihr Handeln stehen. Sie sind einfach vor Ort und setzen sich und ihre Gesundheit aufs Spiel, um zu verhindern, dass noch ein Stück Wald unter Beton verschwindet.
Literatur zur Geschichte und Theorie des Anarchismus?
Ob ich Literatur zur Geschichte und Theorie des Anarchismus empfehlen könnte? Ich nannte ihm die Bücher von Justus Wittkop "Unter der schwarzen Fahne" und Daniel Guerin "Anarchismus – Begriff und Praxis". Beide Bücher sind wahrscheinlich nur noch antiquarisch zu bekommen.
Außerdem schwärmte ich Jürgen von einem Text von Murray Bookchin vor, der 1974 in der legendären Zeitschrift "Unter dem Pflaster liegt der Strand" im Karin Kramer Verlag erschienen ist und "Hör zu, Marxist!" heißt.
Ein grandioser Dokumentarfilm
Dann legte ich ihm noch einen grandiosen zweiteiligen Dokumentarfilm ans Herz, der "Kein Gott, kein Herr! Eine kleine Geschichte der Anarchie" heißt und auf YouTube zu finden ist. Ich sah ihn vor ein paar Jahren auf arte und war hellauf begeistert. Eine Sternstunde des Fernsehens.
Es werden seltene Film- und Fotodokumente gezeigt und es kommen Menschen zu Wort, die nicht akademisch und von oben herab über Anarchismus dozieren, sondern die sich selbst in dieser Tradition verorten.
Geist und Gehalt mancher Bewegung erschließen sich nur dem, der auf sie setzt. Jürgen sagte, er dürfe den Internetanschluss eines Nachbarn mit nutzen und werde sich diesen Film bei nächster Gelegenheit anschauen.
Dann bestieg ich mein wieder fahrtüchtiges Rad und fuhr am Ende eines schönen Tages nach Hause. Es dämmerte bereits und herbstlicher Dunst lag über dem Fluss. Ich musste das gerade reparierte Licht einschalten. Der Dynamo machte einen Heidenlärm.
Götz Eisenberg betreibt seit einigen Jahren unter dem Titel "Durchhalteprosa" einen eigenen Blog.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
