Großbritannien zeigt, wohin die Inflationsreise geht
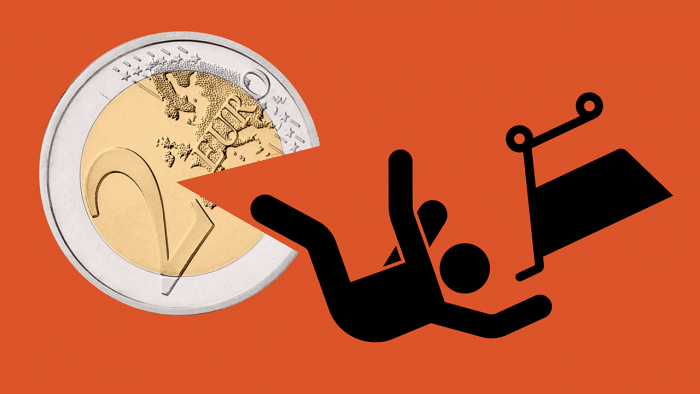
Teuerungsrate bis Ende des Jahres von über 10 Prozent? Außenministerin Liz Truss: "Sehr, sehr schwierige wirtschaftliche Situation". Anders als die EZB dreht die Bank of England schon an der Zinsschraube
In Deutschland erreichte die offizielle Inflationsrate im April schon 7,8 Prozent, während sie im Euroraum auf 7,4 Prozent gestiegen ist, wie die Europäische Statistikbehörde (Eurostat) gerade bestätigt hat. Damit liegt sie leicht unter den 7,5 Prozent der ersten Schnellschätzung. Am Rekordhoch ändert sich aber nichts.
In der EU ist die Teuerungsrate schon auf 8,1 Prozent angeschwollen. Allerdings zeigt ein Blick über die EU-Grenzen hinaus, dass damit das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht ist. In Großbritannien sind die Verbraucherpreise zum Beispiel im April so stark gestiegen wie seit 1982 nicht mehr. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich neun Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Das hatte das Office for National Statistics kürzlich mitgeteilt.
"Sehr starker globalen Gegenwind"
Die britische Außenministerin Liz Truss erklärte, dass man sich in einer "sehr, sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation" befinde. "Wir haben es mit einem sehr, sehr starken globalen Gegenwind zu tun", erklärte die konservative Politikerin angesichts einer "extrem hohen Inflation".
Die britische Notenbank meint, das Ende der Fahnenstange sei noch nicht erreicht. Die Bank of England (BoE) erwartet, dass die Teuerungsrate im Laufe dieses Jahres auch die Marke von zehn Prozent überschreiten wird.
Und im Königreich spricht man bei der Notenbank, anders als in der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt, klare Worte. So warnte der Notenbank-Chef Andrew Bailey auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg vor "apokalyptischen" Lebensmittelpreisen.
Zu den externen Schocks zählt er auch die Covid-Lockdowns in China, die sich weiter auf die Lieferketten auswirken.
Es tut mir leid, dass ich apokalyptisch bin, aber das ist ein großes Problem.
Andrew Bailey, BoE
Verzicht auf höhere Lohnforderungen
Bailey forderte natürlich die Beschäftigten auf, auf höhere Lohnforderungen zu verzichten, um die Lohn-Preis-Spirale nicht in Gang zu setzen. Aber er sagte auch, was zu erwarten sei, wenn die Löhne nicht steigen. Die Preise würden dann nämlich über einen "Schock" bei den Realeinkommen sinken. Denn gesenkte Realeinkommen würden sich negativ auf die Binnennachfrage auswirken und die Konjunktur dämpfen.
Was er natürlich nicht sagt, ist, dass die untersten Einkommensschichten längst unter noch größeren Kaufkraft-Verlusten leiden, da neben Lebensmittel derzeit hauptsächlich die Energiepreise die Inflation treiben. Es ist kein Geheimnis, dass Menschen mit wenig Geld in der Tasche einen besonders hohen Anteil ihres Einkommens für Lebensmittel und Energie ausgeben müssen.
Deshalb werde die reale Inflationsrate für das ärmste Zehntel der Haushalte zu durchschnittlichen jährlichen Inflationsraten von bis zu 14 Prozent führen. Dahinter steckt, dass die Energiepreisobergrenze auf fast 2.800 Pfund angehoben werden wird.
Nach Berechnungen des Institute for Fiscal Studies (IFS) soll die Inflationsrate für das reichste Zehntel der Bevölkerung nur unterdurchschnittliche acht Prozent betragen. Nach Angaben des Think Tanks gibt das ärmste Zehntel der Haushalte in der Regel fast dreimal so viel für Gas und Strom aus wie das reichste Zehntel.
Die Lage für einfache Menschen in Großbritannien kann schon als dramatisch bezeichnet werden. Nach einer Umfrage des Ipsos-Instituts stellen schon zwei von drei Briten die Heizung ab, um Kosten einzusparen. Mehr als ein Viertel der Befragten gab sogar an, wegen ihres knappen Budgets schon Mahlzeiten auszulassen zu müssen, um über die Runden zu kommen.
Die Verarmung wird also über die hohe Inflation deutlich vorangetrieben. Auch am britischen Beispiel ist die wüste These des Münchner Ifo-Instituts widerlegt. Als schon im vergangenen Herbst, längst vor dem Ukraine-Krieg, die Inflation auf Rekordwerte stieg, wartete das Ifo-Institut doch tatsächlich mit der These auf, die Inflation treffe höhere Einkommen stärker als niedrigere.
Gegenmaßnahmen mit Leitzinsen
Der Blick nach Großbritannien ist auch deshalb interessant, da die BoE längst Gegenmaßnahmen ergriffen hat. Die britische Notenbank hatte, für viele Beobachter "überraschend" als erste Notenbank der großen G-7-Staaten eine "Zinswende" schon im vergangenen Dezember beschlossen.
Innerhalb der letzten sechs Monate hat die BoE die Leitzinsen in vier Zinsschritten auf nun ein Prozent erhöht. Zuletzt waren die Leitzinsen vor 13 Jahren auf diesem Niveau, als sie weltweit von den Notenbanken im Laufe der Finanzkrise nach unten geprügelt wurden.
Wir haben es dort also mit einer weiter steigenden Inflation zu tun, obwohl die Notenbank Gegenmaßnahmen eingeleitet hat. Daraus kann man Schlüsse dafür ziehen, was uns in der Eurozone angesichts der absoluten Untätigkeit der EZB in Frankfurt droht. Wie Telepolis schon kürzlich ausgeführt hatte, kann resümierend gesagt werden:
"Je länger man das Problem verschleppt, desto härter werden die Konsequenzen."
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die konservative Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) kürzlich zur BoE getitelt hat: "Verspielt die Notenbank das Vertrauen der Briten?" Die FAZ spricht von einem "epochalen Versagen durch zu lockere Geldpolitik". Das kann man so sagen.
Nur vermisst man dann eine noch härtere Kritik der FAZ angesichts der Tatsache, dass die EZB bisher absolut nichts gegen Inflation unternimmt, weiter die Geldmärkte flutet und den Leitzins weiter auf null belässt und auch am negativen Einlagenzins nichts ändert.
USA: Drohende Stagflation
Klar ist, dass der Druck auf die EZB wächst, die weiterhin Durchhalteparolen ausgibt, wonach das Inflationshoch erreicht sein soll, worüber die FAZ wieder groß berichtet hat.
Lagarde will, allerdings erst ab dem Sommer, moderat die Zinsen langsam anheben. Nach elf Jahren Nullzinspolitik könnte dann eine Zinserhöhung um 0,25 Punkte kommen, während Kritiker einen entschlosseneren Einstieg in die geldpolitische Straffung wollen. Dazu gehört der Chef der österreichischen Notenbank Robert Holzmann, der eine Anhebung um 0,5 Prozent fordert.
Ein solcher Zinsschritt zu Beginn der Straffungsphase würde den Märkten signalisieren, "dass wir die Notwendigkeit zum Handeln erkannt haben", sagte er. "Alles andere würde Gefahr laufen, als schwach wahrgenommen zu werden."
Lagarde will ihre Geldpolitik weiter an den eigenen Prognosen orientieren, die sich seit Jahren als falsch erweisen. Doch man kann eine EZB-Geldpolitik darauf aufbauen, dass die eigenen Inflationsprognosen eintreffen, welche die Notenbank selbst aufgestellt hat. Das hatte der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Thomas Mayer, in einem hörenswerten Interview im Deutschlandfunk kritisiert.
Die EZB "leitet ihre Zinspolitik aus Inflationsprognosen ein bis zwei Jahre in die Zukunft ab. Sie kann die Inflation aber nicht wirklich oder eher gar nicht korrekt antizipieren", erklärt er. Anders handelt und argumentiert dagegen der BoE-Chef Bailey. Der geht davon aus, dass die Entwicklung im Ukraine-Krieg oder die der Covid-Pandemie eben nicht vorhersehbar ist.
Immer deutlicher wird, dass viel zu lange mit der Straffung der Geldpolitik gewartet wurde und sich deshalb die Anzeichen verstärken, dass man in eine gefährliche Stagflation wie in den 1970er-Jahren abgleitet, als eine hohe Inflation mit einer Stagnation oder mit einer Rezession einherging. Das ist für Ökonomen ein "toxisches Gemisch".
In den USA zeichnet sich eine Stagflation schon ab. Das Wirtschaftswachstum fiel nach der zweiten Schätzung des US Bureau of Economic Analysis im ersten Quartal 2022 mit einem Rückgang von 1,5 Prozent auf Jahresbasis noch schlechter aus, als ohnehin schon erwartet worden war.
Allerdings könnte die geldpolitische Wende der US-Notenbank FED, selbst wenn auch sie viel zu spät kam, dazu geführt haben, dass die Inflationsrate wieder sinkt. Im April stiegen die Verbraucherpreise in den USA um 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Zwar verharrt die Inflation weiterhin auf einem hohen Niveau, aber sie hat sich erstmals seit August 2021 leicht abgeschwächt.
Im März hatte die Inflation noch bei 8,5 Prozent gelegen. Ob es sich dabei wirklich um eine Trendwende handelt, bleibt aber abzuwarten.
Klar ist auch, dass die Abschwächung der Konjunktur eher dazu führen wird, dass die Lagarde-EZB bei der Zinswende auf die Bremse tritt, zumal die hohe Inflation den – wohl von Lagarde gewünschten – Effekt hat, die Schulden der hoch verschuldeten Staaten wie ihr Heimatland Frankreich wegzuinflationieren.
Thesen zur Inflation
Interessant ist in diesem Zusammenhang sind auch einige Thesen interessant, die Fefe kürzlich in seinem Blog zur Inflation angestellt hat.
Erstens: Vergesst mal die aktuellen Preise, wie teuer alles wird. Denkt mal lieber über eure Altersvorsorge nach. Wenn ihr, sagen wir mal, eine Rentenversicherung abgeschlossen habt, die euch garantiert 400 Euro im Monat auszahlt, und wir haben jetzt eine Weile 7-10 Prozent Inflation, dann kriegt ihr vielleicht 400 Euro, aber die sind viel weniger wert dann.
Fefe
Bei einer solchen Inflation über einige Jahre sind die 400 Euro praktisch wertlos, wenn man in 10 bis 15 Jahren in die Rente geht. Und niemand kann derzeit sagen, wie lange die Inflation angesichts der verheerenden Geldpolitik der EZB und dem Ukraine-Krieg so hoch bleiben wird.
Zumal wird alles vonseiten der europäischen Verantwortlichen getan wird, den Krieg zu verlängern, anstatt zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Damit - das sollte allen klar sein - werden die Energiekosten über längere Zeit in die Höhe geschraubt. So wird zum Beispiel vom grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ausgerechnet das extrem teure und umweltschädliche US-Frackinggas hofiert. Wer behauptet, damit ließe sich die Inflation senken, ist entweder blind oder er lügt.
In der zweiten These spricht auch Fefe die Tatsache an, dass die mit der Corona-Krise noch stärker ausufernden Schulden weginflationiert werden solle.
Der Staat schiebt unfassbar große Schuldenberge vor sich her, weil Geld immer als Kredit geschöpft wird. Auf der einen Seite hat jemand Guthaben, dann muss auf der anderen Seite jemand Schulden haben. Die Schuldenseite ist bei uns häufig der Staat. Daher argumentieren Ökonomen gerne, dass das OK oder sogar gut sei, wenn der Staat hohe Schulden hat, weil das heißt, dass jemand anderes ein hohes Guthaben hat. Nun machen aber zu hohe Schulden irgendwann Ärger, und wie kriegt der Staat die dann weg? Abzahlen ist nicht realistisch. Der Ausweg ist Inflation.
Fefe
So stellt Fefe richtig fest, dass die Schulden dann zwar nicht weg sind, aber im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung kleiner werden. Er nimmt an, dass der Staat (beziehungsweise die EZB) vermutlich gar keine große Eile hat, die hohe Inflation herunterzufahren, "weil das eben auch die Schulden weniger wert werden lässt".
Problematische Rechnungen
Es gibt ein Problem bei dieser Rechnung: Wenn man tatsächlich in die Stagflation abrutscht und in der Rezession die Wirtschaft nicht wächst, sondern schrumpft, dann wird der Effekt kleiner oder hebt sich vielleicht sogar wieder völlig auf.
Tatsächlich dürfte mit einer Rezession genau dann der "Schock" eintreten, den der britische Notenbankchef anspricht: Dass wegen fallender Nachfrage auch die Inflation wieder nachlässt, wenn die Beschäftigten keine entsprechenden Lohnerhöhungen durchsetzen können. Das bedeutet aber, wie schon oben angesprochen, die weitere Verarmung breiter Bevölkerungsschichten.
Die Betrachtungen der Staatsschulden und der Rentenproblematik sind deshalb wichtig, ganz abgesehen davon, dass Menschen mit Sparguthaben schon jetzt über Nullzinsen und Inflation massiv enteignet werden, da auch von linker Seite die Inflationsgefahren gerne verharmlost werden. Hier sind unter anderem die Ökonomen Heiner Flassbeck und Friederike Spiecker zu nennen. Sie schrieben in Relevante Ökonomik kürzlich:
Dabei bleiben die Befürworter einer strafferen Geldpolitik eine plausible Erklärung schuldig, wie und mit welchen gesamtwirtschaftlichen Folgen Zinserhöhungen die aktuellen Preissteigerungen bei importierten Rohstoffen zum Stillstand bringen können.
Heiner Flassbeck und Friederike Spiecker
Vergessen wird bei der Betrachtung zum Beispiel, dass zum Beispiel die Schweiz, die eine ganz andere Geldpolitik macht, eine Inflation von 2,5 Prozent hat, die noch im Rahmen des Inflationsziels der EZB liegt. Kauft ausgerechnet die kleine Schweiz keine Rohstoffe im Ausland?
Natürlich, aber da die Schweizer Notenbank eine andere Geldpolitik macht, anders als die EZB nicht zur Konjunkturförderung über die Geldschwemme auch den Euro nach unten geprügelt hat, hat der Schweizer Franken im Verhältnis zum US-Dollar einen deutlich höheren Wert.
Damit kauft die Schweiz ihre Energie und Lebensmittel auf dem Weltmarkt billiger ein. Das wird gerne vergessen. Darüber erklärt sich zum Teil auch, warum die Ölpreise in der Finanzkrise zum Teil fast 50 Prozent höher waren, aber der Spritpreis an unseren Tankstellen damals deutlich niedriger.
Der Handel mit dem Dollar
Da Energie auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, verteuert sich Energie für die Verbraucher über den schlechteren Wechselkurs auch, wenn die Preise für Gas und Öl auf dem Weltmarkt gar nicht steigen. Mit Zinserhöhungen in anderen Währungsräumen verstärkt sich der Effekt noch, da Geld aus dem Euroraum abfließt, der Euro also weiter geschwächt wird.
Zum Franken besteht fast schon Parität. Immer mehr Experten erwarten, dass es bald auch eine Parität zum Dollar bestehen wird. Mitte Mai fiel der Eurokurs sogar unter die Marke von 1,04 US-Dollar. Damit hat die EZB, anders als sie suggeriert, sehr wohl auch eine Möglichkeit dämpfend auf die Energiepreise und damit über diesen Hebel auch dämpfend auf die Inflation einzuwirken.
Flassbeck und Spiecker zeigen aber auch auf, dass man es mit Versäumnissen in der Vergangenheit zu tun hat. Man habe es zum Beispiel versäumt, "den Finanzmärkten starke Zügel anzulegen." Das zeitigt "negative Konsequenzen für die Realwirtschaft", denn "natürlich sucht sich das viele Geld, das durch die lockere Geldpolitik auf den Finanzmärkten vorhanden ist, seinen Weg in alle möglichen Anlageformen, zu denen in erster Linie spekulative zählen – seien es Gold, Metalle, Nahrungsmittel oder andere Rohstoffe".
Beide meinen, dass Verteuerungen von Krediten, sprich Zinssteigerungen vor allem Investitionsvorhaben getroffen werden, "eben auch die jetzt noch dringender als vor dem Krieg benötigten Sachinvestitionen."
Hier beißt sich die Katze allerdings in den Schwanz. Das Problem ist, dass das viele Geld der Geldschwemme, welche auch die beiden Ökonomen kritisch sehen, seit vielen Jahren nicht produktiv investiert wird.
Warum und wie das jetzt in produktive Investitionen gelenkt werden könnte, darauf bleiben sie Antworten schuldig.
Sehr fraglich ist, dass sie als Linke argumentieren, dass die Geldpolitik "nur dann die Zügel anziehen" sollte, wenn "der andere entscheidende Politikbereich, die Lohnpolitik, sie dazu zwingt, indem letztere einen inflationären Prozess in Gang setzt."
Das hier von Flassbeck und Spiecker unterschwellig Lohnverzicht und Gürtel-enger-schnallen gepredigt wird wie vom Chef der Bank of England, ist angesichts der sozialen Lage vieler Menschen dramatisch.
In Makroskop führt Patrick Kaczmarczyk dagegen aus:
Seit dem Beginn der Coronakrise reichen noch nicht einmal die nominalen Lohnzuwächse, um eine wirkliche Inflationsgefahr heraufzubeschwören. In den USA und in Großbritannien zeigt sich ein anderes Bild: Hier gab es tatsächlich einen rapiden Anstieg der Löhne, der den Inflationsdruck in diesen Ländern befeuert und sich auch in einer höheren Kerninflation widerspiegelt. Dass die Fed und die Bank of England jetzt die Zügel anziehen, ist somit nachvollziehbar und gerechtfertigt. In Europa sieht die Sache anders aus.
Patrick Kaczmarczyk
Allerdings plädiert auch er bei einer Inflation, die zum Beispiel aus stark steigenden Rohstoffpreisen resultiert, auch für Einbußen bei der Kaufkraft. Bei Lohnverhandlungen müssten "temporär reale Einkommensverluste in Kauf genommen werden (der Unter- und Mittelschicht kann und sollte dann fiskalpolitisch unter die Arme gegriffen werden)".
Das, so ist bekannt, passiert aber tendenziell nicht, wie wir unter anderem hier schon mit Blick auf die schmale Hartz-IV-Erhöhung aufgezeigt haben.
Geld zur Umverteilung?
Um real Geld zur Umverteilung zu haben, müsste es endlich dort abgeschöpft werden, wo es sich in großen Mengen befindet. So zum Beispiel derzeit bei Energiekonzernen, deren Gewinne extrem gestiegen sind. In Großbritannien wird gerade eine "windfall tax" auf den Weg gebracht, um Sondergewinne, sogenannte "windfall profits" abzuschöpfen.
Das sind Gewinne im Milliardenumfang, die auf die Konzerne herabregnen, ohne dass sie dafür etwas getan hätten. Zusatzgewinne von Öl- und Gaskonzernen sollen mit 25 Prozent extra besteuert werden könnten, womit fünf Milliarden Pfund an zusätzlichen Einnahmen in die Kassen gespült werden sollen.
Damit folgt Großbritannien Italien, wo eine solche Steuer auch der konservative Draghi ab November einführen will. Sinnvoller wäre es allerdings, das absurde Tarifmodell zu verändern, das solche Profite erst ermöglicht, statt nur ein Viertel der Sondergewinne daraus abzuschöpfen. Dazu müsste auch endlich gegen Spekulation vorgegangen werden, mit denen die Energiepreise auch in die Höhe getrieben werden.
Was die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale angeht, so tritt Ines Schwerdtner der herbeigeredeten Gefahr im Freitag entgegen. Sie bezieht sich auf eine Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, wonach zum Beispiel die Mindestlohnerhöhung kaum Auswirkung auf die Inflation habe.
Und wie der Ökonom Marcel Fratzscher betont, ist eine drohende Stagflation aufgrund der Lohnerhöhungen ein Mythos. Bereits in den Siebzigerjahren habe der Ölpreisschock die Inflation zwar angetrieben, die steigenden Löhne hätten der wirtschaftlichen Lage aber nicht nachhaltig geschadet. Vielmehr hätten die Lohnerhöhungen die Wirtschaft durch die erhöhte Kaufkraft der Menschen sogar stabilisiert. Es ist also auch aus Unternehmersicht durchaus sinnvoll, sich nicht gegen Lohnerhöhungen zu stellen.
Der Freitag
Allerdings springt auch sie, was die Sondergewinne angeht, viel zu kurz. Sie fordert nicht, dass die unterbunden werden sollen, da sie massiv Kaufkraft von den Verbrauchern abzieht, sondern auch sie befürwortet nur eine "Übergewinnsteuer" wie in Großbritannien und Italien.
