Kapital im Todeskampf: Warum nicht Konsum, sondern Arbeitsplatz-Demokratie die Rettung bringt
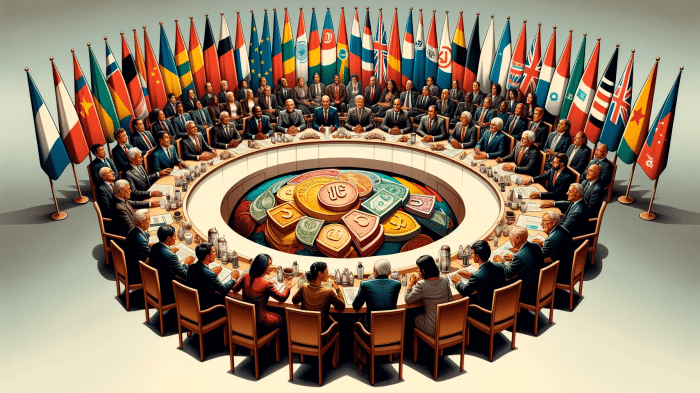
Eine lebhafte Debatte über Kapitalismus und Sozialismus: Vertreter der BRICS- und G7-Staaten diskutieren gemeinsame Zukunftsperspektiven.
(Bild: KI-generiert)
Echte Demokratie besteht nicht nur an der Wahlurne, sondern auch am Arbeitsplatz. G7- und BRICS-Staaten ringen damit. Über die Zukunft des Kapitalismus.
Im Jahr 1863 veröffentlichte der russische Sozialkritiker Nikolai Tschernyschewski einen Roman mit dem Titel "Was tun?". Im Mittelpunkt stehen die Heldin Vera Pawlowna und ihre vier Träume. Ihr persönliches Leben und die gesellschaftlichen Wirren des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus in Russland werden auf brillante Weise miteinander verwoben.
Tschernyschewski, ein von der zaristischen Regierung inhaftierter Revolutionär, schrieb einen Roman, der nicht weniger als ein Pionierwerk des sozialistischen Feminismus war. Darin plädierte er auch leidenschaftlich für eine städtische Industriewirtschaft auf der Grundlage von Arbeitergenossenschaften, einer modernen und transformierten Version der alten russischen Agrarkommunen.
Ein anerkennender Lenin nannte eines seiner wichtigsten politischen Pamphlete, das 1902 veröffentlicht wurde, "Was tun?".
Zwei Jahrzehnte später, nachdem die sowjetische Revolution in einem langen Bürgerkrieg ausländische Invasoren und inländische Feinde besiegt hatte, kehrte Lenin zum Thema der Arbeitergenossenschaften zurück.
Sozialismus im 21. Jahrhundert: Lektionen aus der Geschichte
Unter sowjetischen Bedingungen, die sich im Vergleich zu Tschernyschewskis Russland stark verändert hatten, plädierte Lenin nachdrücklich dafür, dass die Aktivisten der UdSSR die enorme Bedeutung der Gründung, Verbreitung und Achtung von Genossenschaften als Schlüssel für die Zukunft des sowjetischen Sozialismus erkennen sollten.
Er argumentierte, dass die Arbeitergenossenschaften die Antwort auf die brennende politische Frage der damaligen Aktivisten waren: Was ist zu tun?
Im Folgenden möchte ich Lenins Argument auf die heutigen gesellschaftlichen Bedingungen anwenden, die dieselbe Frage mit noch größerer Dringlichkeit aufwerfen.
BRICS vs. G7: Die neue Weltordnung im Kapitalismus
Der heutige Kapitalismus ist global – die ökonomische Grundstruktur der Weltwirtschaft ist durch ein zentrales Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Modell gekennzeichnet. Die "Produktionsverhältnisse" in den Unternehmen (Fabriken, Büros und Läden) machen eine kleine Minderheit der Beschäftigten zu Arbeitgebern.
Sie treffen alle grundlegenden "Geschäftsentscheidungen" darüber, was, wie und wo produziert wird und was mit dem Produkt (und dem Erlös aus dem Verkauf) geschieht. Alle diese Entscheidungen werden von ihnen allein getroffen. Die Beschäftigten, die Mehrheit der Akteure am Arbeitsplatz, sind von diesen Entscheidungen ausgeschlossen.
Der Kapitalismus ist heute weltweit in zwei große Blöcke gespalten, einen alten und einen neuen. Der alte ist mit den USA verbündet. Die Gruppe der Sieben ist nicht nur älter, sondern auch der kleinere der beiden Blöcke und hat in den vergangenen Jahrzehnten an relativer globaler Bedeutung verloren. Ihr gehören Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, Japan und die Vereinigten Staaten an.
BRICS-Staaten: Aufstieg und Herausforderungen
Der jüngste, schnell wachsende Block, die BRICS, bestand ursprünglich aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Kürzlich hat er sechs neue Mitgliedstaaten eingeladen, ihm ab Januar 2024 beizutreten: Ägypten, Iran, Saudi-Arabien, Äthiopien und Argentinien.
Ab 2024 wird das Gesamt-BIP der BRICS das der G7 übersteigen, und der Abstand zwischen ihnen wird immer größer.
Autokratie der wahre Maßstab
Die "reifen Kapitalismen" der G7 haben alle überlebt und sind gewachsen, weil die Arbeitnehmer die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Organisation der Arbeit akzeptiert haben. Inmitten und trotz der endlosen ideologischen Feier der Demokratie in den G-7-Ländern haben die Arbeitnehmer das völlige Fehlen von Demokratie in den kapitalistischen Unternehmen akzeptiert.
Abgesehen von einigen Ausnahmen und Widerständen wurde es zur Gewohnheit, dass die repräsentative Demokratie in die Wohngemeinschaften gehörte, aber nicht in die Arbeitsgemeinschaften. In kapitalistischen Unternehmen war Autokratie die Norm.
Die Arbeitgeber herrschten über die Arbeitnehmer, aber sie waren ihnen gegenüber nicht demokratisch verantwortlich. In jedem kapitalistischen Unternehmen bereicherten die Arbeitgeber einen ausgewählten Kreis, indem sie sich selbst, den Eigentümern des Unternehmens und einigen wenigen Spitzenmanagern einen Teil des Gewinns zukommen ließen.
Dieser Kreis hatte einen außerordentlichen politischen und kulturellen Einfluss. Sie kompensierten das Fehlen von Demokratie in ihren Unternehmen, indem sie Demokratie außerhalb der Unternehmen nur formal aufrechterhielten.
Die Regierungen im Kapitalismus wurden in der Regel durch die bezahlten Lobbyisten dieses ausgewählten Kreises, durch Wahlkampfspenden und durch die bezahlte Produktion der Massenmedien beeinflusst. Im modernen Kapitalismus tauchen die Könige und Königinnen, die in früheren Jahrhunderten verbannt waren, in veränderter und verlagerter Form wieder auf, und zwar als Vorstandsvorsitzende immer größerer kapitalistischer Unternehmen, die ganze Gesellschaften beherrschen.
Der "Konsumismus" als Gewinn
Der tatsächliche oder erwartete Widerstand der Arbeitnehmer gegen den Ausschluss der Demokratie am Arbeitsplatz hat den Kapitalismus schon immer heimgesucht. Ein wichtiges Mittel der Arbeitgeber, diesen Widerstand zu unterdrücken, ist die enge Definition ihrer Verpflichtung gegenüber den Arbeitnehmern in Form von konsumgerechten Löhnen.
Der Lohn, der den Konsum ermöglicht, wurde zum notwendigen und explizit ausreichenden Entgelt für die Arbeit. Implizit wurde er auch zur Entschädigung der Arbeiter für den Mangel an Demokratie am Arbeitsplatz. Steigender Konsum der Lohnabhängigen galt als Zeichen eines "erfolgreichen" Kapitalismus. Im krassen Gegensatz dazu wurde die zunehmende Demokratie am Arbeitsplatz nie zu einem vergleichbaren Maßstab für die Bewertung des Systems.
Der Konsum als Sinn und Zweck der Arbeit trug zu einer gesellschaftlichen Überbewertung des Konsums an sich bei. Auch die Werbung hat zu dieser Überbewertung beigetragen. Die moderne kapitalistische Gesellschaft hat den "Konsumismus" in ihren Katalog moralischer Verfehlungen aufgenommen. Kleriker warnen uns regelmäßig davor, im Konsumrausch die geistigen Werte aus den Augen zu verlieren (zu diesen geistigen Werten gehören natürlich selten die demokratischen Rechte am Arbeitsplatz).
Die schrumpfenden Imperien und Volkswirtschaften der G7, die von China und den BRICS-Staaten herausgefordert und überholt werden, laufen nun Gefahr, den Massenkonsum immer mehr einzuschränken. In untergehenden Imperien bewahren die Reichen und Mächtigen ihren Reichtum und ihre Privilegien, während sie die Kosten des Niedergangs auf die Masse der Arbeitnehmer abwälzen.
Die Automatisierung von Arbeitsplätzen, ihre Verlagerung in Niedriglohnregionen, der Import billiger Arbeitsmigranten und Massenkampagnen gegen Besteuerung sind bewährte Mechanismen, um diese Abwälzung zu erreichen.
Solche "Sparmaßnahmen" sind heute fast überall in vollem Gange. Sie erklären einen großen Teil der massiven Wut und Verbitterung der Arbeiterklasse in den alten Kapitalismen (vom Typ G7), die sich in Gesten gegen die sozialen "Eliten" ausdrückt.
Angesichts der Tatsache, dass der Kapitalismus seit Langem seine rechten Anhänger gegenüber seinen linken Kritikern bevorzugt, sollte es niemanden überraschen, dass Wut und Verbitterung zuerst rechte Formen annehmen (Donald Trump, Boris Johnson, Geert Wilders, Alternative für Deutschland und Giorgia Meloni).
Die politische Versuchung für die Linke wird darin bestehen, sich wie in der Vergangenheit auf die Forderung nachsteigendem Konsum zu konzentrieren, jetzt, da ein schrumpfender Kapitalismus diesen untergräbt. Der Kapitalismus hat einen steigenden Konsum versprochen, den er nun nicht mehr halten kann. Das ist gut, aber nicht gut genug. In der Vergangenheit war der Kapitalismus oft in der Lage, steigende Reallöhne und einen höheren Lebensstandard für die Arbeiter zu erreichen. Und er kann es wieder. China ist sogar dabei, genau das zu erreichen.
Sozialismus heute: Mehr als nur eine Ideologie
Die klare Lehre daraus ist, dass die Linke eine neue und andere Antwort auf die Frage benötigt, was zu tun ist. Ihre Kritik muss den Kapitalismus wirksam kritisieren und bekämpfen, wenn und wo er für steigende Löhne sorgt, und ebenso, wenn und wo er es nicht tut.
Es ist an der Zeit, die Entdemokratisierung des Kapitalismus am Arbeitsplatz und die daraus resultierenden sozialen Missstände (Ungleichheit, Instabilität und nur formale politische Demokratie) aufzudecken und anzugreifen.
Die Ziele der Arbeitnehmer mussten und durften sich nie auf die Erhöhung der Löhne beschränken, so wichtig dies auch war und ist. Diese Ziele können und sollten die Forderung nach voller Demokratie am Arbeitsplatz einschließen. Andernfalls können alle Reformen und Errungenschaften, die durch den Kampf der Arbeitnehmer erreicht wurden, später wieder zunichtegemacht werden (wie es mit dem New Deal in den Vereinigten Staaten und der Sozialdemokratie in vielen anderen Ländern geschehen ist).
Streben nach Sicherheit
Die Arbeiter mussten lernen, dass nur demokratisierte Arbeitsplätze die von den Arbeitern erkämpften Reformen absichern können. In den alten, im Niedergang begriffenen Zentren des Kapitalismus muss der Klassenkampf die Demokratisierung der Unternehmen einschließen. Der Übergang zu einer Wirtschaft, die auf Arbeiterkooperativen basiert, ist das strategische Ziel.
In den neuen aufstrebenden Kapitalismen der Welt, den BRICS, führt eine andere Logik wieder zu Arbeiterkooperativen als Hauptziel sozialistischer Politik und Organisierung. In den BRICS-Ländern werden Fabriken, Büros und Geschäfte nach dem gleichen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Modell organisiert.
Im Gegensatz zu den G-7-Staaten sind die Arbeitgeber relativ häufig nicht privat. Stattdessen leiten einige Arbeitgeber Unternehmen in Privatbesitz, während andere Staatsbeamte sind, die Unternehmen in Staatsbesitz leiten. In der Volksrepublik China, wo etwa die Hälfte der Unternehmen privat und die andere Hälfte staatlich ist, haben fast alle Unternehmen das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Organisationsmodell übernommen.
Dort, wo der Staat eine große, bedeutende oder dominierende Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung spielt, und insbesondere dort, wo die eine oder andere sozialistische Ideologie diese Rolle begleitet und rechtfertigt, ist die Zeit reif für eine Hinwendung zu Genossenschaften der Arbeitnehmer. Sie wird für viele in diesen Ländern als notwendige nächste Stufe des Sozialismus attraktiv sein.
Die "Entwicklung", die dort erreicht wurde, oder die sozialistischen Veränderungen auf der Makroebene, die bereits erreicht wurden (durch Entkolonialisierungskämpfe und Revolutionen), werden gefeiert, aber auch weithin als unzureichend angesehen. Diese Kämpfe und Revolutionen waren durch größere soziale Ziele und Veränderungen motiviert. Die Demokratisierung von Unternehmen hebt "Entwicklung" auf eine neue Ebene, um diese Ziele zu erreichen.
Es gibt eine weitere Quelle für die Antwort auf die Frage "Was tun?". Die Qualitäten der Demokratie, die innerhalb der G7, der BRICS oder der meisten anderen Länder erreicht wurden, waren bisher eher formaler als inhaltlicher Natur.
Dort, wo Wahlen von Repräsentanten stattfinden, machen der Einfluss von Wohlstands- und Einkommensunterschieden, die soziale Macht der CEOs und ihre Kontrolle über die Massenmedien die Demokratie eher symbolisch als real. Viele Menschen wissen das, und noch mehr spüren es.
Die Ausweitung der Demokratie auf die Wirtschaft und insbesondere auf die interne Organisation von Unternehmen ist ein wichtiger Schritt, um die politische Demokratie von einer rein formalen und symbolischen zu einer substanziellen und realen Demokratie zu machen. Dasselbe gilt für die Überwindung des Sozialismus in seinen früheren Formen.
Der alte Aufruf an die Arbeiter der Welt, sich zu vereinigen – "Ihr habt nichts zu verlieren, außer euren Ketten" – war eine frühe Teilantwort auf die Frage: "Was tun?". Nach anderthalb Jahrhunderten Entwicklung und Sozialismus können wir heute eine viel umfassendere und spezifischere Antwort auf diese Frage geben.
Um den Kern des Kapitalismus – die Produktionsbeziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern – zu überwinden, müssen wir diese Beziehungen explizit durch einen demokratisierten Arbeitsplatz ersetzen, um die hierarchischen kapitalistischen Unternehmen durch selbstverwaltete Genossenschaften der Arbeitnehmer zu ersetzen.
Der Artikel erscheint in Kooperation mit dem Independent Media Institute. Sie finden das englische Original hier [1]. Übersetzung: David Goeßmann [2].
Richard D. Wolff ist emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Massachusetts, Amherst, und Gastprofessor im Graduiertenprogramm für internationale Angelegenheiten der New School University in New York. Seine drei jüngsten Bücher sind "The Sickness Is the System: When Capitalism Fails to Save Us From Pandemics or Itself", "Understanding Marxism" und "Understanding Socialism".
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-9605203
Links in diesem Artikel:
[1] https://asiatimes.com/2024/01/what-is-to-be-done/
[2] https://www.telepolis.de/autoren/David-Goessmann-7143590.html
Copyright © 2024 Heise Medien