Konkurrenz oder Kooperation? Das ist die entscheidende Frage
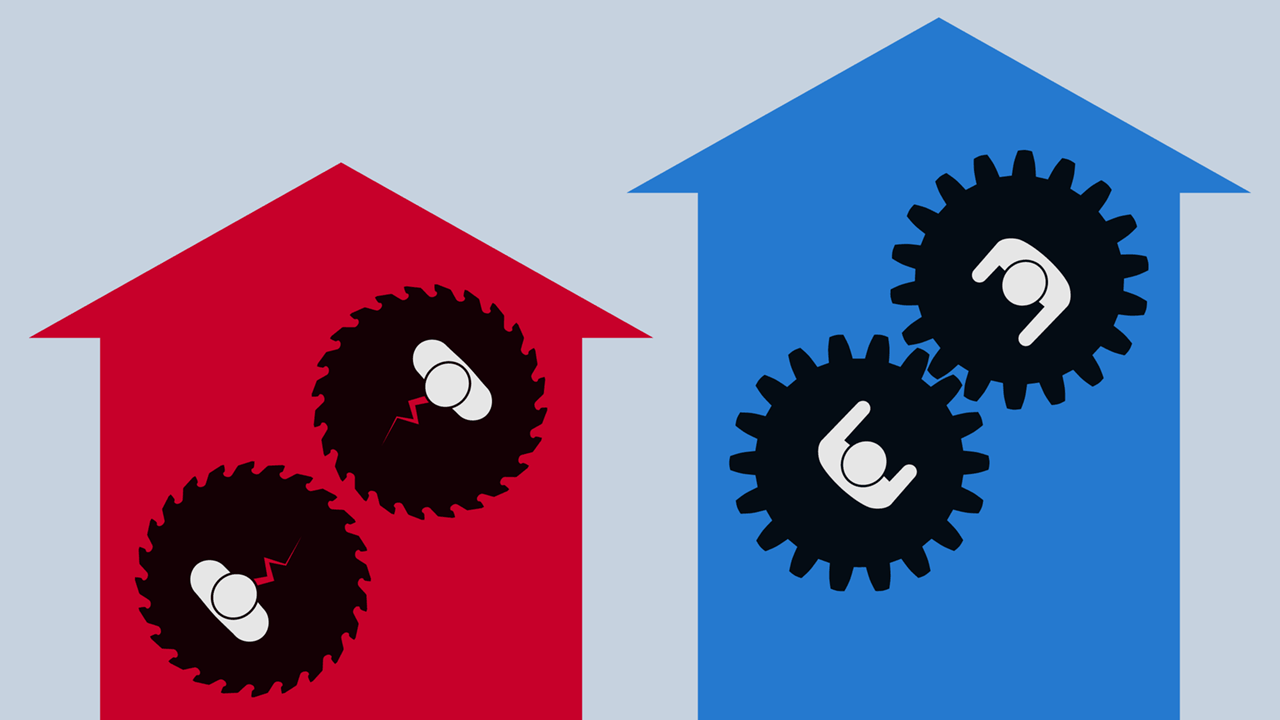
- Konkurrenz oder Kooperation? Das ist die entscheidende Frage
- Benutzte Literatur
- Auf einer Seite lesen
Die Ansicht, der Mensch sei von Natur aus ein Wesen, das konkurrenzorientiert ist und seine beste Leistung in einer Konkurrenzsituation erzielt, erscheint als eine Gewissheit, die keines Beweises bedarf. Was aber sagt die Wissenschaft?
"Die Menschen sind genetisch so veranlagt, dass sie konkurrieren - um einen Partner, im Sport, bei der Arbeit. Wettbewerbe mit einem Anreiz zwingen die Menschen, unter vorgegebenen Randbedingungen ein klares Ziel zu verfolgen, das die Lösung eines Problems ist," erklärt der Unternehmer Peter Diamandis, überzeugt.
Tatsächlich: Wohin das Auge blickt, herrscht Konkurrenz. Die Gesetze des Wettbewerbs bestimmen das Leben. Sei es in der Schule, bei der Bewerbung oder am Arbeitsplatz, in der Freizeit auf dem Sportplatz oder bei der Casting-Show im Fernsehen, nicht zuletzt sogar bei der Anzahl der Freunde auf Facebook. Zwischen Unternehmen herrscht Konkurrenz. Zwischen Schulen und zwischen Universitäten. Zwischen gewerblich genutzten Standorten und auch zwischen Krankenhäusern. Und letztendlich herrscht auch zwischen den Staaten ein gnadenloser Wettkampf, sei es um Ressourcen, die Positionierung in der Weltwirtschaft oder im internationalen Steuerwettbewerb.
Die effizienteste Methode, die wir kennen
Wettbewerb ist das A und O in der Wirtschaft, die das Denken und Handeln auch in immer mehr Bereichen bestimmt, die früher nicht in diesen Kategorien gedacht wurden wie beispielsweise Schulen, Universitäten und Krankenhäuser. Der Grund hierfür ist einfach: "Der Wettbewerb ist die effizienteste Methode, die wir kennen", wie die neoliberale Wirtschaftswissenschaftler Friedrich von Hayek feststellte.
Nicht nur erscheint der Wettbewerb als die effizienteste Methode, um auch das Niveau auf Schulen, Universitäten und Krankenhäuser zu maximieren, sondern entspricht dem Wesen der Natur des Menschen. So die weitverbreitete Gewissheit. In diesem Sinne formuliert auch der Guardian-Journalist George Monbiot die Merkmale des Neoliberalismus:
Der Neoliberalismus betrachtet den Wettbewerb als das bestimmende Merkmal der menschlichen Beziehungen. Er definiert die Bürger neu als Verbraucher, deren demokratische Entscheidungen am besten durch Kauf und Verkauf getroffen werden, ein Prozess, der Verdienste belohnt und Ineffizienz bestraft. Er behauptet, dass "der Markt" Vorteile bietet, die durch Planung nie erreicht werden könnten.
Leistung und Leistungsgesellschaft
Es kann eigentlich kein Zweifel bestehen, dass die Annahme im Kapitalismus der Wirklichkeit entspricht, der Mensch könnte am stärksten durch Konkurrenz motiviert werden und so seine Höchstleistungen erreichen. Es erscheint einleuchtend, dass ein Menschen bei einem Wettrennen schneller läuft als beim einsamen Training. Tatsächlich lässt sich dies wissenschaftlich auch recht einfach belegen: Bei einem simplen Experiment mit zwei Pilates-Gruppen wurde einer Gruppe als Motivation mitgeteilt, in einer unbekannten Trainingsgruppe könnten 80 Prozent der Teilnehmer die anstrengende Prank-Übung deutlich länger halten. Nach dieser Nachricht steigerten die Probanden ihre Leistung erkennbar.
Drei Grundannahmen liegen der Überzeugung zugrunde, Konkurrenz sei unabdingbar:
- Menschen werden dadurch motiviert, besser als andere zu sein. Frei nach dem Motto: jede Erfolgsgeschichte beginnt mit einem Kind, das Niederlagen hasst. Denn, wie der US-amerikanischer Football-Trainer Vince Lombardi erklärte: "Gewinnen ist nicht das Wichtigste. Gewinnen ist alles."
- Menschen sind angeblich von Natur aus faul. Daher benötigen sie einen äußeren Ansporn, um ihre beste Leistung zu bringen.
- Die Erfahrung der Niederlage ist ein zentraler Bestandteil des Lebens. Stellvertretend erklärt ein Leitartikel der "Los Angeles Times", es sei für ein Kind nie zu früh, zu lernen, dass es immer "einen gibt, der zuletzt gewählt wird". Oder wie die "New York Times" titelte: "Verlieren ist gut für dich".
Konkurrenz: zentraler Motor der Evolution
Nicht nur naheliegende Erwägungen legen die Bedeutung der Konkurrenz nahe, sondern auch die Evolutionsgeschichte an sich ist ein scheinbar unwiderlegbarer Beweis, dass der Mensch von Natur aus ein Konkurrenzwesen ist. Charles Darwin, der die Evolution als erbarmungslosen "Krieg der Natur" (war of nature) und als "Kampf ums Überleben" (struggle for life) beschrieb, betonte das Recht des Stärkeren. In der Evolution ist Egoismus die Handlungsmotivation. Und der Konkurrenzkampf die Rahmenbedingung des Daseins. So schrieb Darwin:
Wie jedes andere Tier ist auch der Mensch ohne Zweifel auf seinen gegenwärtigen hohen Zustand durch einen Kampf um die Existenz infolge seiner rapiden Vervielfältigung gelangt, und wenn er noch höher fortschreiten soll, so muss er einem heftigen Kampfe ausgesetzt bleiben. Es muss für alle Menschen offene Konkurrenz bestehen, und es dürfen die Fähigsten nicht durch Gesetze oder Gebräuche daran gehindert werden, den größten Erfolg zu haben.
Der Meisterarchitekt der Evolution
Ein näherer Blick auf Darwins Werk fördert aber eine deutlich differenziertere Darstellung zu Tage. Denn Darwin selbst sah durchaus einen wichtigen Platz für Altruismus und Kooperation trotz oder gerade wegen der Logik der Evolution:
Wenn ein Stamm viele Mitglieder besitzt, die aus Patriotismus, Gehorsam, Mut und Sympathie stets bereitwillig anderen helfen und sich für das allgemeine Wohl opfern, so wird er stets über andere Völker den Sieg davontragen; dies würde natürliche Zuchtwahl sein.
Der Mathematiker und Biologen Martin. A. Nowak von der Universität Harvard hat sich in seinem Buch "Kooperative Intelligenz: Das Erfolgsgeheimnis der Evolution" intensiv mit der Frage beschäftigt, ob Konkurrenz oder Kooperation die Evolution bestimmt. Entgegen der populärwissenschaftlich verzerrten Darstellung von Charles Darwin ist Nowaks Ergebnis eindeutig: "Ihre Kooperationsfähigkeit ist der eigentliche Grund dafür, dass es Menschen gelungen ist, sich in fast jedem irdischem Ökosystem einen Lebensraum zu erkämpfen und über die Erde hinaus weit in den Weltraum vorzustoßen." Daher ist für ihn "Kooperation (...) ein Kernelement der Evolution auf unserem Planeten." Kooperation ist für ihn nichts Geringeres als der "Meisterarchitekt der Evolution".
Was das menschliche Gehirn belohnt
Das Belohnungszentrum des menschlichen Gehirns reagiert positiv auf Situationen und Eigenschaften, die der Natur des Menschen entsprechen, und versucht mittels Ausstoßes von Dopamin sicherzustellen, dass die entsprechenden Handlungen auch tatsächlich durchgeführt werden. Daher sollte eine Untersuchung des Belohnungszentrums Aufschluss darüber geben, ob der Mensch von Natur aus eher nach Konkurrenz oder Kooperation strebt.
Tatsächlich zeigen eine Reihe von Experimenten, dass das Belohnungszentrum bei menschlicher Kooperation aktiv wird, nicht aber in einer Konkurrenzsituation. Es ist nicht nur aktiv, wenn wir kooperieren, sondern auch wenn andere mit uns kooperieren.
Joachim Bauer, Professor für Psychoneuroimmunologie an der Universität Freiburg, resümiert daher:
Das natürliche Ziel der Motivationssysteme sind soziale Gemeinschaft und gelingende Beziehungen mit anderen Individuen.
Ein ultrakooperativer Primat
Auch die Entwicklungsgeschichte der Menschheit zeigt eindrücklich die besondere Rolle und Bedeutung der Kooperation. Der Anthropologe und Verhaltensforscher Michael Tomasello, Co-Direktor des Max-Planck-Instituts in Leipzig, benennt nach zahlreichen Experimenten die zentralen Unterschiede zwischen Menschen und Menschenaffen, die interessanterweise alle eng mit der Kooperation zusammenhängen. So sind die soziale Interaktion und Organisation der Menschen in jeder Hinsicht kooperativer als die der Menschenaffen. Auch die Einzigartigkeit menschlichen Denkens besteht laut Tomasello darin, dass es "grundsätzlich kooperativ" ist. Er bezeichnet daher den homo sapiens als "ein ultrakooperativer Primat".
Von Geburt auf Kooperation eingestellt
Bereits ein Blick auf ein Neugeborenes spricht Bände. Bekanntlich kann ein Mensch nach seiner Geburt nur äußerst kurz Zeit alleine überleben. Die allererste und grundlegende Erfahrung des Menschen ist deshalb: Er muss unbedingt kooperieren, um zu überleben. Kooperation ist sein Lebensmodus. Das Verhalten einjähriger Kinder bestätigt zudem, dass der Mensch von Natur aus nach Kooperation strebt. Kleinkinder bevorzugen Personen, die sich kooperativ verhalten, und bringen ihnen mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung entgegen.
Auch das Verhalten des Kleinkindes steht im Zeichen von Kooperation. Matthieu Ricard, promovierter Zellgenetiker und weltbekannter buddhistischer Mönch, fasst den Forschungsstand wie folgt zusammen: Die "Verhaltensweisen der Kooperation und der selbstlosen Hilfe treten beim Kind spontan auf. Diese Verhaltensweisen treten sehr früh auf - im Alter von vierzehn bis sechzehn Monaten -, lange bevor die Eltern ihren Kindern die Regeln sozialen Verhaltens eingebläut haben und sie werden nicht durch äußeren Druck verursacht. In unterschiedlichen Kulturen treten sie zudem in der gleichen Altersstufe auf."
Eindeutiges Wahlergebnis bei Kleinkindern
Was geschieht, wenn man in einem Experiment Kleinkinder vor die Wahl zwischen Kooperation und Konkurrenz stellt? Genau dies untersuchte Michael Tomasello. In mehreren Experimenten mit 14-24 Monate alten Kleinkindern gab er ihnen jeweils die Möglichkeit, eine Aufgabe oder ein Spiel alleine oder gemeinsam durchzuführen. Zum Vergleich führte er dasselbe Experiment mit Schimpansen durch. Sein Ergebnis ist eindeutig:
Im Gegensatz zu Schimpansen kooperieren Kleinkinder zwischen 14 und 24 Monaten in der Spielsituation, als auch bei der Lösung instrumentellen Aufgaben. (...) Oft stecken sie sogar ihre Belohnung in ein Gerät, damit die Handlung von neuem beginnt.
Weitere Studien von Tomasello bestätigten das Ergebnis.
Auch eine Studie von Forschern um den Entwicklungspsychologen Daniel Haun, die sowohl dreijährigen Kindergartenkinder als auch Schimpansen zwischen einer kooperativen und einer nicht-kooperativen Lösungsvariante wählen ließen, ist eindeutig: Mehr als drei Viertel aller Kinder entschieden sich, gemeinschaftlich die Aufgabe zu lösen, während hingegen den Schimpansen diese Wahl fast gleichgültig war.
Die Schule: Eine Vorbereitung auf das Leben
"Es ist nur ein Spiel? Der Wettkampf im Schulsport bedroht" lautete der vielsagende Titel einer britischen Studie. Die Studie thematisiert die Frage, ob Kinder und Jugendliche Konkurrenz oder Kooperation im Sport bevorzugen. Knapp zwei Drittel der befragten Kinder und Jugendlichen gestehen, erleichtert zu sein (oder nichts dagegen zu haben), wenn das Element des Wettkampfes beim Sport verschwinden würde. 86 Prozent der Kinder sind sogar davon überzeugt, dass der Sieg für die Eltern wichtiger war als für sie selber.
Knapp 40 Prozent der Kinder sind darüber hinaus sicher, ihre Eltern schauten ihnen nur wegen des Wettkampfs beim Sport zu. Die parallele Befragung der Eltern gibt dem feinen Gespür der Kinder Recht. Fast alle Eltern gaben nämlich zu, dass sie tatsächlich ihren Sprösslingen nur wegen des Wettkampfs zusahen; und fast alle Eltern räumen ein, für sie selbst sei der Sieg wichtiger als für die Kinder.
Der naturgegebene Hang zur Konkurrenz: Ein Mythos
Der hier dargelegte Sachverhalt ist so wichtig, dass er noch einmal ausdrücklich eine Wiederholung verdient: Betrachtet man die Evolution und das menschliche Gehirn sowie Experimente mit Kleinkindern zeigt sich eindeutig, dass der Mensch keineswegs von Natur aus ein konkurrenzorientieres Wesen ist, sondern er ist zutiefst auf Kooperation ausgerichtet.
Tatsächlich zeigt sich die Vorliebe für Kooperation auch, wenn man Kindern nicht stets Wettkämpfe zur Pflicht macht, weil man davon überzeugt ist, dass sie nur so ihr bestes Geben, sondern ihnen die Wahl lässt. Kinder bevorzugen Kooperation nicht Konkurrenz. Der Sachbuchautor Alfie Kohn betont, dass er trotz jahrzehntelanger Recherche keine einzige Studie finden konnte, die belegen würde, dass Kinder die Konkurrenzsituation bevorzugen.
Bevor der geneigte Leser nun Sorge hat, dass ohne Wettkampf die Schüler keine Motivation zum Sport haben, sollte er eine US-amerikanische Untersuchung zur Kenntnis nehmen. Sie belegt, die Hauptmotivation für Kinder Sport zu treiben sei Spaß. Der zweitwichtigste Faktor ist, sein Bestes zu geben. Das Wort "gewinnen" taucht nur abgeschlagen auf dem neunten Platz auf.
Die destruktive Seite der Konkurrenz
Die Überzeugung, auf die der Kapitalismus aufbaut, der Mensch sei von Natur aus ein konkurrenzorientiertes Wesen, stellt sich somit als Mythos heraus. Bevor wir die Frage betrachten, ob die zweite Überzeugung des Kapitalismus, Konkurrenz sei der beste Motivator, tatsächlich mit der Wirklichkeit übereinstimmt, sei der Fokus hier kurz auf ein Thema gerichtet, das bei der Reflexion über das Wesen der Konkurrenz gerne leicht unter den Tisch fällt: Wie wirkt sich Konkurrenz auf die Psyche der Menschen aus? Insbesondere auf ihr Selbstwertgefühl, auf zwischenmenschliche Beziehungen?
Alle verlieren
Es bedarf keiner Erklärung, dass Niederlagen und Scheitern am Selbstwertgefühl nagen. Dies ließe sich vielleicht noch achselzuckend mit dem Hinweis ignorieren, es könne halt nur einen Sieger geben und die Spreu müsse vom Weizen getrennt werden, um die wirkliche Elite herauszufiltern. Erstaunlich jedoch, dass die Mutmaßung, Erfolg steigere das Selbstwertgefühl, alles andere als unbestritten ist. Tatsächlich ist die Beweislage in der wissenschaftlichen Forschung hierzu "enttäuschend schwach". Hinzu kommt auch, dass hyperkompetitive Menschen "stark narzisstisch" sind und über "ein geringes Selbstwertgefühl" verfügen. Daher schreibt Alfie Kohn pointiert:
Konkurrenz ist für das Selbstwertgefühl wie Zucker für die Zähne.
Aus Mitmenschen werden Konkurrenten
Auch die zwischenmenschlichen Beziehungen sind durch die immer stärkere Präsenz der Konkurrenzsituation belastet. Im Alltag der Konkurrenz werden aus Mitmenschen Gegner, denn diese sind nichts anderes als Hindernisse zum eigenen Erfolg, die es zu überwinden gilt. Sei es in der Schule, in der Ausbildung, an der Universität oder bei der Arbeit.
Eine Übersicht zahlreicher Experimente und Studien sollte zu denken geben:
- Konkurrenz erhöht das Misstrauen zwischen den Menschen und reduziert Empathie.
- Konkurrenz erhöht die Aggressivität. Interessanterweise ist das Ergebnis dabei davon unabhängig, ob die Kindern den Sieg davontragen oder geschlagen werden.
- Konkurrenz kann Kindern das Gefühl geben, nicht Herr des eigenen Schicksals zu sein.
- Konkurrenz wird als frustrierend empfunden. Auch hier ist dies unabhängig vom Ergebnis. Dieses Paradox löst sich umgehend auf, wenn man berücksichtigt, dass der Wettkampf für Kinder als Bedrohung empfunden wird, weil immer auch die Ungewissheit des Ausgangs herrscht und stets eine Niederlage droht.
- Konkurrenz stiftet Angst und Unsicherheit. Zum einen natürlich die Angst vor der Niederlage. Zum anderen aber paradoxerweise auch die Angst vor dem Sieg. (Beispiele von Sportlern, die im Angesicht des sicheren Sieges plötzlich versagen, gibt es viele - der berühmte "Wackelarm" beim Tennis).
Alfie Kohn findet einmal eine pointierte Zusammenfassung:
Wenn wir zwischenmenschliche Beziehungen sabotieren wollten, hätte uns kaum etwas Besseres als Konkurrenz einfallen können.
Aufgezwungene Konkurrenzsituation
"Forced Ranking" wurde von Jack Welch, dem ehemaligen Chef von General Electric, eingeführt. Jedes Jahr erhielten in jedem Arbeitsteam die besten 20 Prozent der Mitarbeiter Boni. 70 Prozent landeten auf einem Mittelplatz ohne Konsequenzen, während die schwächsten 10 Prozent ihre Entlassung erhielten. Durch einen so angestachelten, ständigen Wettbewerb in den Teams sollen die Mitarbeiter zur ständigen Verbesserung motiviert und verhindert werden, dass sie "einrosten".
Das Ausmaß der hier waltenden Perversion macht sprachlos. Es steht ja von vornherein zwingend fest, dass es Verlierer gibt, unabhängig von der Qualität der geleisteten Arbeit. Zudem bedarf es schon eines gesteigerten Grades an Schizophrenie, um in einem Team eine echte Kooperation zwischen den Mitarbeitern erschaffen zu wollen, wenn diese nicht nur auf die wenigen begehrten Plätze auf der Beförderungsliste schielen, sondern ausnahmslos jeder von dem Fallbeil seiner eigenen Kündigung bedroht ist, falls er nicht eine gewisse Mindestanzahl an Teamkollegen hinter sich lässt. In Deutschland arbeiten derzeit geschätzte 15 Prozent der Unternehmen mit "Forced Distribution".
Offenbar mag diese Idee in betriebswirtschaftlichen Augen absolut logisch sein (nicht zuletzt entspricht sie dem kapitalistischen Menschenbild). Sie hält jedoch nicht einmal einem wissenschaftlichen Test im Hinblick auf ihre Effizienz Stand. Ein Experiment des Bonner Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit zeigt, dass sich die Probanden tatsächlich mehr anstrengen, um Mitarbeiter zu übertreffen. Dabei wählen sie aber auch den einfachsten Weg: Sie sabotieren ihre Teamkollegen. Dadurch sinkt die Produktivität der Gruppe insgesamt.
Hauptsache, ich gewinne!
All die aufgeführten und belegbaren Argumente gegen Konkurrenz könnten zumindest in gewisser Hinsicht aufgewogen werden, wenn sich zumindest ein Credo des Kapitalismus in der Wirklichkeit nachweisen ließe: dass die Konkurrenzsituation zu besseren Leistungen führe.
Ein grundlegender Gedankengang zeigt bereits auf, weshalb Konkurrenz in vielen Situationen gar nicht zur besten Leistung des Einzelnen führen kann. Die Motivation in der klassischen Konkurrenzsituation (die wir in verschiedenen Sportarten exemplarisch antreffen) ist extrinsisch. Ebenso die Zielsetzung. Der Psychologe Edward L. Deci (Universität Rochester) warnt daher, dass Menschen in einer Konkurrenzsituation der Frage, wie sie den anderen übertrumpfen und gewinnen können, vielmehr Aufmerksamkeit widmen als dem Streben nach einer bestmöglichen Lösung der Aufgabe.
Denn es geht eben bei der Bewältigung von Konkurrenzsituationen nicht darum, seine beste Leistung zu bringen, sondern vor allem darum, gegen den Gegner zu gewinnen, genauer noch: Es geht darum, dass ich gewinne und der Gegner verliert. Alfie Kohn fragt daher ganz zu Recht: "Wie können wir unsere beste Leistung erzielen, wenn wir unsere Energie damit vergeuden, andere zu besiegen?" Konkurrenz und Drucksituationen verhindern also gerade ein Ausschöpfen des eigenen Potenzials.
Druck ist leistungshemmend
Die Erfahrung von Unterlegenheit beeinträchtigt das Denkvermögen. Eher durchschnittliche Schüler werden keineswegs von leistungsstarken Schülern mitgezogen. Im Gegenteil: Sie fühlen sich verunsichert. Besonders erschütternd: Dass dieser Effekt sogar 50 Jahre später noch feststellbar ist, wie eine aktuelle Studie belegt. Wer als Kind auf eine Schule mit besseren Schülern ging und selbst eher durchschnittliche Noten erzielte, hatte später ein geringeres Einkommen als jemand, der eine Schule mit schwächeren Schülern besuchte.
Druck und Konkurrenz sind aber auch insgesamt leistungshemmend, also auch bei den "Siegern". Denn Stress, Angst und Druck reduzieren die Signalfrequenz der Spiegelneuronen massiv. Als Resultat nimmt nicht nur das Mitgefühl ab, sondern auch die Fähigkeit zu lernen. Eine zentrale Erkenntnis, die dringend Eingang in die Schulen finden sollte.
Druck reduziert nicht zuletzt auch die Kreativität. Menschen, die gewohnt sind, sich permanent selbst unter Druck zu setzen, sind deutlich weniger in der Lage, komplizierte Probleme zu lösen, wie in einem Experiment nachgewiesen werden konnte. Die Autoren bemerken hierzu: "Die Urgenz, mit der sie das Problem behandelten, machte die Resultate stereotyp und unproduktiv." Leistungsdruck ist kaum ein Leistungsgarant.
Es geht besser
Bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg stellte der Psychologe Morton Deutsch in einem Experiment mit High School-Schülern fest, dass Kooperation deutlich produktiver als Konkurrenz ist. Im Jahr 1973 existierten bereits dreizehn weitere Studien, die sein Ergebnis bestätigten. 1981 führten dann David und Roger Johnson von der Universität Minnesota eine Meta-Studie von 122 Studien durch: 65 Studien kamen zu dem Schluss, dass Kooperation zu besseren Leistungen als Konkurrenz führt. Hingegen belegten nur acht Studien das Gegenteil. In einer weiteren Meta-Analyse derselben Autoren untersuchten sie später 369 Studien zwischen 1898 und 1989 (wobei nur ein Teil hiervon sich auf Schüler und Studenten bezog). Auch wenn die Daten etwas veraltet sind, ist das damalige Ergebnis in seiner Eindeutigkeit beeindruckend: Kooperation führt in nicht weniger als 87 Prozent zu besseren Resultaten.
Forschungsergebnisse bestätigen zudem, dass Kooperation auch bessere und günstigere Auswirkungen auf das zwischenmenschliche Verhältnis in der jeweiligen Arbeitsgruppe hat. Dieses Ergebnis zeigt eine weitere Meta-Studie von David und Roger Johnson, die fast einhundert Studien zwischen den Jahren 1944 und 1982 auswerteten.
Christian Felber, der Begründer der Gemeinwohl-Ökonomie, resümiert:
Die besten Leistungen kommen nicht zustande, weil es eine KonkurrentIn gibt, sondern weil Menschen von einer Sache fasziniert, energetisiert und erfüllt sind, sich ihr hinzugeben und in ihr ganz aufzugehen. Den Wettbewerb braucht es nicht.
Das Leistungspotential der Kooperation
Kooperation muss den Leistungsvergleich mit der Konkurrenzsituation als Motivation keineswegs scheuen. Das legendäre Planspiel der NASA bestätigt dies eindrücklich. Die Ausgangslage des Planspiels: Ihr Raumschiff hat eine Bruchlandung erlitten und der Weg zum Mutterschiff ist weit. Eine Reihe von Gegenständen ist aber unbeschadet geblieben und Sie dürfen genau 15 Gegenstände auswählen, um Ihr Überleben auf dem Weg zum rettenden Mutterschiff zu sichern. In aller Regel sind Gruppen näher an der Lösung als ein einzelner Spieler. Besonders gut schneiden hierbei die Gruppen ab, die die einzelnen Rollen unter einander verteilen, um eine strukturierte Diskussion zu ermöglichen.
Die Stärke der Kooperation belegen auch eine ganze Reihe von beeindruckenden Leistungen, die nur gemeinsam gelingen konnten. Natürlich sind hier Wikipedia und das Computersystem Linux zu nennen, aber ein besonders Beispiel für das Potential des Kooperativs ist das Polymath Projekt. Im Jahr 2009 startete Tim Gowers ein Experiment, indem er auf seinem Blog seine Leser um Mithilfe bei der Lösung eines bisher ungeklärten mathematischen Problems bat. Was nach schlichter kapitalistischer Ansicht keinesfalls funktionieren konnte (denn mancher Helfer würde mehr und andere weniger zur Lösung beitragen, aber bei einem Erfolg müssten sich die Fähigsten die Ehre mit allen teilen müssen), gelang. Mehr als 40 Mathematiker beteiligen sich und unter dem Pseudonym D. H. J. Polymath wurde nicht nur das betreffende mathematische Problem erstmals in der Menschheitsgeschichte gelöst, sondern eine ganze Reihe weiterer bisher ungelöster mathematischer Probleme konnte seitdem geknackt werden. Inzwischen ist sogar die dreizehnte Auflage dieses Projekts vom Erfolg gekrönt.
Falsche Rahmenbedingungen
So sicher die Gewissheit im Kapitalismus ist, der Mensch sei von Natur aus ein konkurrenzorientiertes Wesen und folglich am besten durch Konkurrenz zu motivieren, so sicher stellt eine genauere Analyse heraus, dass es sich hierbei schlicht um passende Mythen handelt. Aber es sind sehr mächtige Mythen, denn der Wettbewerbsgedanke erfasst immer mehr Bereiche des menschlichen Lebens. Besonders bedenklich hierbei der Wettbewerb zwischen Schulen, Universitäten und Krankenhäusern. Daher ist es von existentieller Wichtigkeit, die Rahmenbedingung in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, die heute fast ausschließlich auf Konkurrenz gestellt sind, zu überdenken und zu verändern, damit sie tatsächlich der Natur des Menschen entsprechen.
Der Wirtschaftswissenschaftler Ernst Fehr von der Universität Zürich formuliert eine zentrale Erkenntnis: "Wenn der Glaube vorherrscht, dass die anderen kooperieren, dann ist die Kooperation jedes Einzelnen hoch; wenn der Glaube vorherrscht, dass die anderen nicht kooperieren, dann kooperiert tatsächlich keiner." Wir haben also die Wahl, ob wir der Kooperation, die der Natur des Menschen viel stärker entspricht als die Konkurrenz, Tür und Tor öffnen wollen, damit immer mehr Menschen kooperieren oder ob wir weiterhin auf Konkurrenz setzen und dadurch mögliche Kooperation zerstören.
Die Notwendigkeit globaler Kooperation
Betrachtet man die globalen Probleme, die die Existenz der Menschheit gefährden, kann es keinen ernsthaften Zweifel daran geben, dass eine Zunahme der Kooperation notwendig ist und schlussendlich globale Probleme nur durch globale Kooperation bewältigt werden können und nicht durch eine "My country first!"-Haltung. Das Streben nach globaler Kooperation ist daher überlebenswichtig.
Zum Schluss soll noch einmal Charles Darwin das Wort erteilt bekommen, der zu oft als Kronzeuge für die konkurrenzorientierte Natur des Menschen herhalten musste. Er war der Überzeugung, dass die Kooperation unter den Menschen tatsächlich eines Tages global sein kann:
Wenn der Mensch in der Zivilisation vorschreitet und kleine Stämme sich zu größeren Gemeinschaften verbinden, so wird der schlichteste Verstand jedem Individuum sagen, dass es seine geselligen Instinkte und Sympathien auf alle Mitglieder des Stammes ausdehnen müsse, mögen sie ihm auch persönlich unbekannt sein. Ist das einmal erreicht, so verhindert nur noch eine künstliche Schranke, dass er seine Sympathie auf die Individuen aller Völker und Rassen erstreckt.
Von Andreas von Westphalen ist im Westend Verlag das Buch erschienen:
Die Wiederentdeckung des Menschen
Warum Egoismus, Gier und Konkurrenz nicht unserer Natur entsprechen
