Infiziert und doch nicht krank
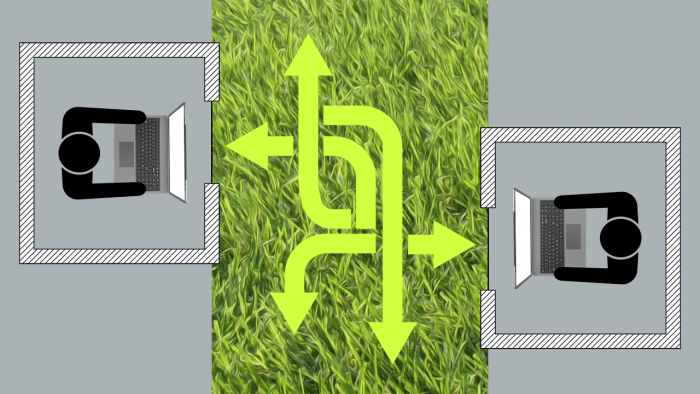
Wie sich Stadt und Urbanität nach Corona verändern werden
An düsteren Prognosen ist dieser Tage wahrlich kein Mangel, und von Verunsicherung zu reden ist schon fast euphemistisch. Es lässt sich kaum absehen, was die Corona-Pandemie auf lange Sicht für unseren Alltag bedeutet. Da ist es umso erstaunlicher, wie viele Menschen sich ausmachen lassen, die mit bemerkenswerter Sicherheit wissen, was zu tun ist. Doch gerade die, die am meisten über die Verbreitung des Virus wissen, die Virologen, gestehen ein, dass ihre Kenntnis mangels Daten und Erfahrung durchaus Grenzen hat. Das ist tröstlich, weil es daran erinnert, wie dünn das Eis ist, auf dem wir gehen.
Pandemie-bedingt waren und sind auch viele Menschen aus ganz anderen als "prekären" Verhältnissen von Einschränkungen betroffen oder haben, zumindest zeitweise, einen Eindruck solcher Betroffenheit kennen lernen müssen: In Existenznot geratene Selbstständige, gut situierte Eltern in Sorge um die Bildung ihrer Kinder, Familien, die nicht in den Urlaub fahren können usw. Man kann durchaus behaupten, dass die Pandemie annähernd die gesamte Gesellschaft zwingt, Benachteiligungs-Situationen am eigenen Leib zu erfahren.
Die Corona-Krise hat über Nacht deutlich gemacht, wie abhängig die Stadt von der arbeitsteiligen Organisation städtischer Planungsvorgänge, Versorgungskreisläufe, Produktionswege und vieler einfacher Dienstleistungen ist - und wie wenig es braucht, diese außer Kraft zu setzen. "Die Idee einer rein konsumtiven Stadt", so der Stadttheoretiker Kaye Geipel, "gründet auf einem mehrfachen Irrtum: Man bezahlt etwas, dann ist es da; man benutzt es und schmeißt es in den Müll, dann ist es wieder weg."
Die Vorzüge der Stadt waren über Nacht passé. Dichte und kollektiv genutzte Güter sowie Infrastrukturen vermehren Ansteckungsgefahren, kleine Wohnungen muten wie Gefängnisse an, die Vielfalt der Formen des Zusammenlebens schrumpft auf Kernfamilien. Damit stellt sich akut die Frage, wie verändern die sanitären Sicherungsmaßnahmen die Leitbilder von Stadt, die ihrer Planung seit Dekaden unhinterfragt unterliegen.
Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich ein Verständnis für den Zusammenhang zwischen Städtebau, Hygiene und Epidemiologie in einer wissenschaftlichen Lesart herauskristallisiert. So wurden etwa hohe Außentemperaturen in Kombination mit mangelhaften hygienischen Verhältnissen in Städten mehr und mehr als Treiber von Krankheiten unterschiedlicher Art erkannt. Untersuchungen zum Zusammenhang von Kanalisation und Trinkwasserqualität oder von Sümpfen und Quartierstrukturen waren gleichermaßen Treiber für medizinische und städtebauliche Innovationen.
Doch während sich Epidemien in früheren Zeiten insbesondere auf "eine Unterversorgung mit Hygienetechnologie" zurückführen lassen, gehen pandemische Gefährdungen heutiger Städte mehr und mehr aus "einer industriellen Überproduktion" hervor. Zudem "fällt auf, dass die damligen Gefährdungen im Unterschied zu den heutigen eben in die Nase bzw. die Augen stachen, also sinnlich wahrnehmbar waren, während Zivilisationsrisiken heute sich typischerweise der Wahrnehmung entziehen und eher in die Sphäre chemisch-pysikalischer Formeln angesiedelt sind".
Das hat der Soziologe Ulrich Beck bereits 1986 in seinem Buch "Risikogesellschaft" festgehalten. Gefährdungen wie das Coronavirus zeichnen sich "durch die Globalität und ihre modernen Ursachen" aus; sie seien "Modernisierungsrisiken", und als solche "pauschales Produkt der industriellen Fortschrittsmaschinerie", obendrein würden sie "systematisch mit deren Weiterentwicklung verschärft". In der Konsequenz machen sie aus Städten ökologische Labors, auf deren Territorium und unter Einbezug der Zivilgesellschaft kleinräumige Lösungen für die "Folgeprobleme der technisch-ökonomischen Entwicklung" gefunden werden müssen.
In der Summe greifen die Corona-bedingten Einschnitte die städtische Substanz zumindest in ihrem alltäglichen Lebensvollzug an. Zugleich ist es geboten, nicht ständig mit dem Brustton größter Überzeugung neue Wahrheiten zu verkünden. Zum Beispiel darüber, wie sich Architektur und Stadt ändern wird und muss. Ob nun Wohnen und Leben im ländlichen Raum angesagt ist. Dass Bürogebäude anders werden müssen. Wie Innenstädte und Einzelhandel umgekrempelt werden. Ob unsere Alltagsmobilität klimaangepasster und schadstoffärmer wird, oder ob im Gegenteil das private Auto den Gewinner der Krise abgibt. Darüber kann man derzeit nur spekulieren.
Eine Sache indes scheint gewiss: Die technologische Entwicklung wird beschleunigt. Wir werden in einer anderen Welt leben, wenn die Krise vorbei ist. Augenscheinlich gibt es gerade eine starke Zunahme der Teilhabe an der Digitalisierung. Die Auswirkung des Virus verstärken jetzt einen Trend, der vor einigen Jahren bereits eingesetzt hat. Viele Dinge, die sonst in der physischen Welt stattfanden, sind nun in die digitale Welt hinübergewandert. Das hat natürlich ein positives Potenzial. Es versetzt uns auch während eines Lockdowns in die Lage, isoliert zu arbeiten und miteinander zu interagieren. Es gibt Vorteile, aber auch Probleme und Gefahren.
Freilich wäre es für die Diskussion hilfreich zu unterscheiden zwischen dem, was schon vor dieser Krise richtig war und dem, was spezifisch für sie ist. So formuliert etwa die Fachwelt seit Jahrzehnten recht vergebens ihre Hoffnung auf die ökologische, verkehrsvermeidende Wirkung von gemischten Quartieren. Und schon in den 1980er Jahren hatte Ulrich Beck gezeigt, dass der Wohnungsmarkt am Bedarf vorbei baut und es unmöglich macht, dass sich familienübergreifende Unterstützungszusammenhänge, wie es im Soziologendeutsch heißt, organisieren lassen. Der Publizist und Stadtforscher Christian Holl schreibt dazu:
Die Lage gibt also wenig Grund zur Hoffnung, die Krise werde helfen, Fehlentwicklungen zu korrigieren. Eher fordert sie heraus, weiterhin unermüdlich all das weiter zu verfolgen, wofür man bislang schon eintrat. Und zwar nicht, weil es die aktuelle Krise erfordert. Sondern weil die aktuelle Krise zeigt, wie wenig wir auf sie vorbereitet waren, gerade weil wir alle anderen Krisen ignoriert haben, weil wir so viele wichtige Dinge nicht entschieden angepackt haben. Die Bodenfrage nicht, den Wohnungsmarkt nicht, die Verkehrspolitik nicht, die Gleichberechtigung auch nicht.
Christian Holl
Der wirkliche Freiraum des Individuums verlagert sich in den öffentlichen Raum
Fraglos gibt es eine Vielzahl virulenter Sachverhalte, die zu klären - oder überhaupt nur ernsthaft zu bearbeiten - viel zu lange versäumt wurde. Zugleich gibt es Einsichten und Gewissheiten, die Bestand haben. Max Weber beschrieb die Essenz des Stadtlebens als "Miteinander unter Unbekannten". Eine andere Metapher kommt aus dem Volksmund, der die Stadtluft einatmet, die frei macht. Die Stadt war die Verheißung eines anderen Lebensentwurfs.
Temps perdu? Nein! Zwar mögen kollektives Zusammensein und Selbstbestimmung gerade nicht sehr angesagt sein. Aber das verändert die Urbanität nicht grundlegend und auf Dauer.
Einerseits ließ sich während der Krise eine Reduktion von kollektiven sozialen Situationen im öffentlichen Raum beobachten. Was bedeutet, dass es nicht mehr so viel Zufall gab. Der aber ist wesentlich für unser Leben. Denn wer nicht mehr auf der Straße oder im Park - ohne es vorher zu planen - zufällig auf Menschen trifft, bleibt in alltägliche Routinen gefesselt.
Andererseits forderten Homeoffice und Kontaktreduzierung offenkundig einen Ausgleich in der Natur. Menschen, die vor lauter Hektik nie zur Ruhe kamen, machten plötzlich ausgiebige Spaziergänge. Selbst die Manager im Homeoffice und beim Homeschooling sind auf den Laden um die Ecke für den schnellen Einkauf und den "eben mal erreichbaren" Quartierspark zum Joggen angewiesen. Und zu Ostern oder Pfingsten drängten sich so Viele in die Grünanlagen, dass das geforderte "social distancing" dort kaum zu wahren war, was ohnehin vor allem eine räumliche Distanz aus sozialer Fürsorge vor der Ansteckung meint.
Das bestätigt alte planungstheoretische Einsichten aufs Neue. Der wirkliche Freiraum des Individuums verlagert sich in den öffentlichen Raum, und wird damit, wenn man so will, zum letzten Refugium des Privaten, unkontrolliert im doppelten Sinne, frei von festgelegter Organisation und frei für Ungeplantes. In Zeiten von Schließungen jeglicher Freizeitangebote und Kontaktsperren bekommt der Aufenthalt draußen und in der Natur allein oder zu zweit eine hohe Relevanz. Der öffentliche Freiraum ist ein Erlebnisort, der vielerlei Formen des Verhaltens ermöglicht - und darin offenbart sich auch eine gewisse "Krisentauglichkeit".
"Orte, wo (noch) nichts geschieht"
Wenn es eine eindeutige Schlussfolgerung aus der Corona-Krise gibt, dann die, dass die öffentliche Daseinsvorsorge keinem Effizienz-Dogma unterworfen werden darf. Und daraus sind auch städtebaulich Konsequenzen zu ziehen. Wenn man Dichte als urbanes Konzept versteht, als wichtig für die soziale Struktur - weil Menschen sich miteinander auseinandersetzen müssen -, dann bedeutet das zugleich, dass man Plätze und Grünanlagen, dass man öffentliche Räume schafft. Und die bemessen sich weniger nach Quadratmetern denn in der Qualität, und die wiederum ist in vielen Stadtentwicklungsprojekten defizitär.
Es braucht gewissermaßen weiße Flecken im geordneten, zweckgebundenen Stadtplan - im Großen wie im Kleinen. Sie sind nicht mit Leere gleichzusetzen (ein Begriff, der im aktuellen Planerjargon en vogue ist). Es geht um konkrete Räume und Orte, wo wenig vorbestimmt und vordeutend codiert ist. Oder, mit den Worten von Peter Handke: "Orte, wo (noch) nichts geschieht."
Dieser Aspekt findet auch in der Architektur seinen Niederschlag; es sei hier nur an Hermann Muthesius erinnert. Er, der entscheidende Protagonist bei der Gründung des Werkbundes 1907, erachtete Haus und Garten als ein eng verschmolzenes Ganzes. Von diesem Zeitpunkt an war der Garten als "Wohnraumerweiterung", zugeordnet den Funktionen der Zimmer, zwar ein Teil der Moderne. Aber im Bauwirtschaftsfunktionalismus verlor sich dieser Gedanke schnell wieder im Ungefähren.
Der Zukunftsforscher Matthias Horx hat jüngst geschrieben: "Die kommende Welt wird Distanz wieder schätzen - und gerade dadurch Verbundenheit qualitativer gestalten. Autonomie und Abhängigkeit, Öffnung und Schließung, werden neu ausbalanciert." Wie unverzichtbar eine aufgelockerte und durchgrünte Stadt für das Wohlbefinden der Bevölkerung ist, wie unverzichtbar innerstädtische Parks mit Rasenflächen und Bäumen, einladend gestaltete Uferzonen oder Freiflächen sind: Das erschließt sich spätestens bei der nächsten Pandemie.
