Corona: Rückgang der Fallzahlen durch natürliche Immunität
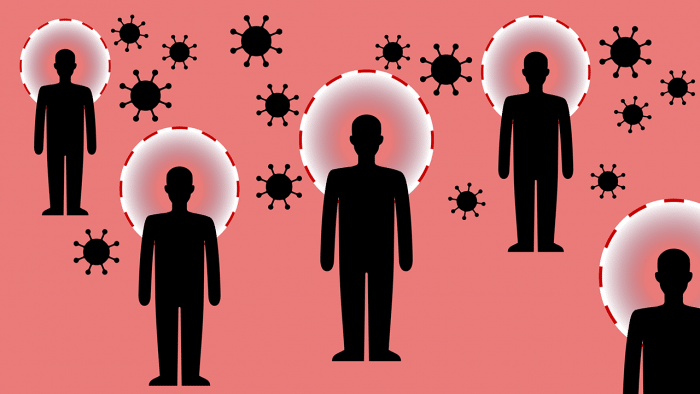
Während Lockdowns kaum Wirkung zeigen, bremst nun der erhebliche Anteil derer, die nach einer Infektion immun sind, die Ausbreitung des Virus
In den meisten europäischen Ländern sind die Corona-Fallzahlen von ihren zeitweiligen Spitzenwerten zurückgegangen. Auch in Deutschland bewegen sie sich ungefähr wieder auf dem Niveau von Ende Oktober. Die Regierungen von Bund und Ländern wollen dies nun darauf zurückführen, dass der von ihnen verordnete harte Lockdown nach acht Wochen endlich wirkt. Um "diesen Erfolg nicht zu gefährden", wurde er um weitere vier Wochen verlängert. Auch die meisten Medien führen den Rückgang ungeprüft auf den Lockdown zurück.
Belege dafür bleiben sie schuldig. Belastbare Daten dazu und über das Infektionsgeschehen allgemein wurden nicht erhoben. Die Verantwortlichen waren bisher nicht willens oder nicht fähig, entsprechende Studien durchführen zu lassen, mit deren Hilfe man abschätzen könnte, welche der verschiedenen Maßnahmen tatsächlich etwas zum Rückgang der Fallzahlen beigetragen haben und wenn ja, wieviel. Dabei wäre dies zur Beurteilung ihrer jeweiligen Verhältnismäßigkeit an sich zwingend geboten.
Vieles spricht allerdings dagegen, dass abendliche Ausgehverbote, rigide Beschränkungen privater Kontakte, das Schließen von Restaurants und kulturellen Einrichtungen oder eine der sonstigen massiven Restriktionen eine deutliche Wirkung hatten, die über die der selbstverständlichen Maßnahmen wie Einhaltung von Hygieneregeln, Abstandhalten und Selbstisolation von Infizierten oder das Verbot von größeren Veranstaltungen, hinausgehen.
Wenn die Infektionszahlen nun nach etlichen Wochen oder Monaten mitten im Winter zurückgehen, so ist das wahrscheinlich viel mehr auf den inzwischen erheblich gewachsenen Anteil von Menschen zurückzuführen, die nach einer Infektion bereits immun sind, und so für das sorgen, was Wissenschaftler eine "kleine Herdenimmunität" nennen.
Kein erkennbarer Effekt harter Lockdown-Massnahmen
Allein die lange Dauer der Lockdowns in Deutschland und anderen europäischen Ländern sowie die sehr unterschiedliche Entwicklung ihrer Fallzahlen, trotz ähnlicher Restriktionen, sprechen gegen die ihnen unterstellte, direkte Wirkung. Obwohl Frankreich und Spanien bereits ab Ende August immer schärfere Maßnahmen verhängten, blieben die Infektionsraten dort bis heute relativ hoch, höher als z.B. in der Schweiz, wo Maßnahmen erst wesentlich später und weniger restriktiv verhängt wurden oder in Schweden, das weiterhin auf einen Lockdown verzichtete. Mittlerweile sind die Zahlen der positiv Getesteten und der Todesfälle in nahezu allen Ländern zurückgegangen ‒ unabhängig von ihrer Anti-Corona-Politik.
Auch eine Reihe von Studien über die Effektivität von Lockdowns im Frühjahr deutet auf einen höchstens geringen Nutzen hin. Die Einflussfaktoren auf die Ausbreitung des Corona-Virus sind natürlich vielfältig und komplex sowie zum Teil auch zufällig [1].
So kam eine im November veröffentlichte Studie von Quentin De Larochelambert und Kollegen [2] zum Schluss, dass das Risiko von Menschen eines Landes, an Covid-19 zu sterben, überwiegend von einer ganzen Reihe länderspezifischer Faktoren wie geographische Lage, Umwelt, Lebenserwartung, Altersstruktur und Qualität des Gesundheitssystems abhängt.
Die Autoren konnten jedoch keinen Zusammenhang mit Regierungsmaßnahmen erkennen. Ein vom renommierten Epidemiologen John Ioannidis und Kollegen durchgeführter Ländervergleich [3] fand keinen Hinweis dafür, dass die Wirkung harter Lockdowns, über die von weniger restriktiven Maßnahmen hinausging.
Ein weiteres Indiz dafür, dass die verordneten Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung zumindest nicht annähernd so durchschlagend wirken, wie von den Modellrechnungen der Regierungsberater vorausgesagt, liefert ein Vergleich der Fallzahlen in den Bundesländern. Trotz weitgehend gleicher Restriktionen zeigen sie völlig unterschiedliche Entwicklungen.
Die Corona Data Analysis Group (CoDAG) an der LMU München, die die Effektivität von Maßnahmen anhand dieser Entwicklungen untersuchte, kam zum Schluss [4], dass die Lockdown-Verschärfung Anfang Dezember "generell nur eine geringe Wirkung hatte und in den meisten Fällen ein Absenken der Infektionszahlen nicht erreicht werden konnte". (s. a. CoDAG-Analyse: Lockdown in Deutschland zeigte kaum Wirkung [5]).
Beträchtlicher Teil der Bevölkerung in Deutschland bereits immun
Wahrscheinlich liegt die geringe Wirkung harter Restriktionen zunächst daran, so auch die Vermutung von Ioannidis und Kollegen, dass die Vorsichtsmaßnahmen, die die meisten Menschen angesichts steigender Infektionszahlen selbständig ergreifen, in der Regel schon viel bewirken. (Wenn viele beim ersten Anzeichen einer Infektion Abstand halten und möglichst zuhause bleiben, wird die Ausbreitung des Virus sicherlich schon erheblich gebremst, werden darüber hinaus selbst kurze oder nicht sehr enge Kontakte zwischen den übrigen, zu über 99 Prozent gesunden Menschen unterbunden, aber kaum.)
Sobald die Infektionszahlen über längere Zeit recht hoch waren, wird die weitere Ausbreitung zwangsläufig auch immer mehr durch den wachsenden Anteil derer zusätzlich gebremst, die durch eine überstandene Infektion immun geworden sind.
In Deutschland waren bis zum 8. Februar insgesamt 2,3 Millionen positiv auf Corona getestete Fälle gemeldet worden. Die Dunkelziffer ist jedoch beträchtlich. Das RKI schätzt [6] den Faktor, um den die Zahl der tatsächlich bereits Infizierten in Deutschland aktuell vermutlich höher liegt, auf vier bis sechs, das Expertenteam um den Internisten Matthias Schrappe [7] auf circa fünf und der Virologe Christian Drosten [8] auf sechs bis acht.
Eine im Auftrag des Robert-Koch-Instituts in Kupferzell durchgeführte Studie [9] kam für die erste Welle auf mindestens Faktor zehn.
Wenn wir vom mittleren Faktor sechs ausgehen, so können Anfang Februar hierzulande bereits rund 14 Millionen Menschen infiziert gewesen sein, 17,5 Prozent der Bevölkerung. Mit den aktuell wöchentlich gemeldeten 60.000 bis 70.000 Fällen wächst die Zahl Woche für Woche hochgerechnet um rund 0,4 Millionen, d.h. fast 0,5 Prozent. Ähnlich viele immune Menschen kommen im Moment durch Impfen hinzu [10].
Die sich unter Berücksichtigung der Dunkelziffer ergebende Infektionssterblichkeit (Infection Fatality Ratio, IFR) stimmt auch ungefähr mit Schätzungen der Sterblichkeitsrate von Infizierten überein. Bei ca. 62.000 bisher mit oder an COVID-19 Gestorbenen kommt man bei 14 Millionen Infizierten auf eine Rate von 0,44 Prozent. Eine von der WHO veröffentlichte Metastudie des international angesehenen Epidemiologen John Ioannidis von der Stanford University schätzt den Medianwert der IFR über alle untersuchten Länder auf 0,23 Prozent. Sie ist aber stark abhängig von der Altersstruktur der Infizierten.1 [11]
Da in Deutschland die höheren Altersgruppen überdurchschnittlich von Infektionen betroffen waren, ist eine etwas höhere IFR durchaus zu erwarten.
Studien in anderen Ländern weisen breitere Immunität nach
Ein Anteil von 17,5 Prozent bereits Immuner entspricht auch ungefähr den Ergebnissen von Antikörperstudien in Ländern, in denen regelmäßig entsprechende repräsentative Studien durchgeführt werden. Nach den aktuellen Daten der britischen nationalen Statistikbehörde [12] (Office for National Statistics, ONS) hatten in England Anfang Februar ein Sechstel bis ein Siebtel der Getesteten schon Antikörper, in London sogar 21 Prozent. In der Schweiz wurde die Zahl der Infizierten Anfang des Jahres auf 1,7 Millionen geschätzt [13], fast 20 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ihr Anteil variierte je nach Region zwischen zehn und 25 Prozent.2 [14]
In Spanien konnten bereits in der zweiten Novemberhälfte landesweit bei zehn Prozent der Getesteten Antikörper nachgewiesen [15] werden, in Madrid bei 18,6 Prozent. Seither hat sich die Zahl der gemeldeten Fälle im Land noch einmal fast verdoppelt.3 [16]
Die Genauigkeit der Tests auf Antikörper ist allerdings sehr unterschiedlich. Sie ist einerseits natürlich abhängig von ihrer Art und Qualität anderseits aber auch vom zeitlichen Abstand der Untersuchung zu einer Infektion. Zwar halten sich gewisse Antikörper gegen das Sars-CoV-2-Virus noch lange nach einer Infektion im Körper ‒ einer aktuellen Studie zufolge [17] über den gesamten bisherigen achtmonatigen Beobachtungszeitraum. Da andere, leichter nachzuweisende Antikörper jedoch mit der Zeit wieder aus dem Blut verschwinden, können gängige Tests eine Infektion nach einigen Monaten oft nicht mehr registrieren. Die Zahl der Infizierten dürfte daher meist deutlich höher liegen, als in den Studien nachgewiesen wurden.
So stellten Forscher der Northwestern University in Chicago, die in einer neuen Studie [18] frühere Tests mit einem besonders empfindlichen Verfahren nachprüften, beispielsweise fest, dass aktuelle kommerzielle Tests etwa 25 Prozent der Menschen mit Antikörpern übersehen.
Der Epidemiologe Klaus Stöhr [19], lange Jahre Leiter des Global-Influenza-Programms und Sars-Forschungskoordinator der WHO schätzt daher, dass in den USA vielleicht bereits 40 Prozent der Bevölkerung immun sind. Ähnlich sei es wahrscheinlich auch in Schweden und der Schweiz. 4 [20]
"Kleine Herdenimmunität" bremst zunehmend die Ausbreitung Wie die Beispiele Madrid und London zeigen, kann der Anteil der bereits immunen Menschen in regionalen Hotspots wesentlich höher sein als im Landesdurchschnitt. In Stockholm lag er im November bereits [21] bei über 30 Prozent. Überdurchschnittlich ist der Anteil auch bei Personengruppen, die durch Art und Häufigkeit ihrer Kontakte ein höheres Risiko haben, wie die Angestellten in Kliniken oder auch Menschen, die in prekären Verhältnissen leben [22], z.B. in Wohnheimen für sozial Benachteiligte oder Obdachlosenunterkünften.5 [23]
Auch mit 30 Prozent ist noch lange keine "Herdenimmunität" erreicht. Der Begriff ist in der Öffentlichkeit stark in Verruf geraten, da er oft mit der Strategie einer ungebremsten Ausbreitung eines Erregers gleichgesetzt wurde. Er beschreibt jedoch nur den Grad an Immunität, den eine Bevölkerung erreicht haben muss, damit sich das Virus nicht mehr ausbreiten kann ‒ unabhängig davon, ob er durch Infektionen oder Impfen erreicht wird.
Sofern keine mögliche Vorimmunität durch andere Coronaviren berücksichtigt wird, gilt dieser Grad als erreicht, wenn 60 bis 70 Prozent immun sind.
Doch auch geringere Anteile von 15 oder 20 Prozent können die weitere Ausbreitung des Virus deutlich bremsen. Diese natürlich erworbene Immunität wird in der aktuellen Debatte völlig ausgeblendet, obwohl sie noch eine ganze Weile gegenüber der zusätzlichen, durch Impfen erreichte, überwiegen wird.
Ausschlaggebend für die Wirkung einer solchen Teilimmunität der Bevölkerung sind nicht die regionalen oder landesweiten Durchschnittswerte, sondern die Prozentsätze in den jeweiligen Hotspots und bei den Bevölkerungsgruppen, die aufgrund ihrer häufigeren täglichen Kontakte stärker zur Ausbreitung beitragen, sich genau deswegen aber auch schon häufiger angesteckt haben. Unter letzteren kann der Anteil leicht mehr als doppelt so hoch liegen wie im regionalen Durchschnitt, in Hotspots kann er dadurch leicht auf über 40 Prozent steigen.
Corona-Pandemie: Begrenzte Immunisierung in Bergamo
Ein gutes Beispiel für die erhebliche Wirkung einer begrenzten Immunisierung ist die norditalienische Provinz Bergamo, die im Frühjahr besonders hart von der Pandemie heimgesucht worden war. Als in Italien die Infektionszahlen mit dem Herbstbeginn wieder drastisch zu steigen begannen, besonders auch in der Lombardei, zu der Bergamo gehört, blieb die Provinz einigermaßen verschont. Während die Covid-19-Fälle in der restlichen Lombardei zwischen dem 2. und 23. Oktober um bis zu 65 Prozent zunahmen, stiegen sie in Bergamo nur um sieben Prozent.
Mitte November gab es in der Provinz Bergamo im Schnitt täglich 20 neue Fälle pro 100.000 Einwohner, in der Provinz Mailand dagegen 81. Mitte Januar [24] waren sie in Mailand auf 22,3 gesunken, in Bergamo aber schon auf 7,4.
Da die Verhältnisse und das Verhalten der Menschen innerhalb der Lombardei sicherlich ähnlich sind, führt Prof. Giuseppe Remuzzi, Direktor des Mario Negri Instituts die Unterschiede auf den erreichten "Grad an natürlicher Immunität" in Bergamo zurück. Einer repräsentativen Studie der italienischen Statistikbehörde Istat zufolge waren hier im Sommer bei einem von vier Einwohnern Antikörper gefunden worden, gegenüber einem von 13 Einwohnern in der Provinz Mailand und einem von 40 in ganz Italien.
Bei Tests in den am schlimmsten betroffenen Gebieten Bergamos wiesen sogar 57 Prozent der getesteten 10.000 Personen Antikörper auf [25].
Schon 15 bis 25 Prozent von Menschen mit Antikörpern können viel bewirken, erklärte dazu Luca Foresti, Physiker und Geschäftsführer der Klinikgruppe "Centro Medico Agostino". Sie können z.B. reichen, um die Reproduktionsrate des Virus von etwas über eins auf unter eins zu drücken und so die Zahl der neuen Fälle exponentiell sinken zu lassen. "Dieser kleine Unterschied kann in ein paar Tagen einen großen Unterschied bewirken. ... Ich nenne es kleine Herdenimmunität."
Ein weiteres gutes Beispiel ist Madrid, das zu Beginn der Pandemie ebenfalls zu den besonders hart getroffenen Zentren in Europa zählte. Die Stadt konnte die ab September angestiegenen Fallzahlen bis Anfang Dezember wieder reduzieren, ohne, wie die anderen spanischen Städte, Geschäfte, Restaurants etc. zu schließen. Auch hier halten Wissenschaftler, wie Daniel Lopez Acuna, ehemaliger Direktor der WHO-Abteilung für Gesundheitsmaßnahmen in Krisenfällen (HAC), die hohe Immunitätsrate zwar nicht für den einzigen aber für den entscheidenden Faktor.
Es gebe zwar keine Herdenimmunität in der gesamten Region, so Elena Vanessa Martinez, Leiterin der spanischen epidemiologischen Gesellschaft, "aber an bestimmten Orten können ganze Cluster infiziert sein" und das mache "es für das Virus schwieriger, andere Gruppen zu erreichen" [26].
Wie lange und wie gut eine Immunität nach einer Infektion schützt, kann man nicht genau sagen, genauso wenig wie bei einer durch Impfung erworbenen. Sie lässt in beiden Fällen, wie auch bei Grippeviren, mit der Zeit und aufgrund von Mutationen nach. Eine erneute Infektion ist jedoch seltener, verläuft in der Regel milder und ist daher weniger ansteckend.
Die bremsende Wirkung einer "kleinen Herdenimmunität" auf die Ausbreitung wird dadurch mit der Zeit geschwächt aber nicht aufgehoben. Im Falle einer neuen Infektionswelle wird sie wieder durch den Anteil derer gestärkt, die sich im Laufe dieser Welle infizieren. Dadurch wird ihr Anstieg stets nach einigen Wochen wieder gebremst.
Lockdown-Verteidiger führen als Beleg dafür, dass ein hoher Grad einer solchen natürlichen Immunisierung keinen größeren Einfluss habe, als Gegenbeispiel die Entwicklung in Manaus an. In der brasilianischen Großstadt sollten einer Studie zufolge [27] im Oktober bereits drei Viertel der Bevölkerung die Corona-Infektionen hinter sich gehabt haben.1 Damit hätte sie Herdenimmunität erreicht. Dennoch stiegen die Fallzahlen im Januar erneut heftig an. Die Hochrechnungen der Antikörperstudie, die auf der Untersuchung von Blutproben basieren, die ab März genommen wurden, werden von vielen Wissenschaftlern jedoch stark angezweifelt [28].
Ihr größter Schwachpunkt ist die fehlende Repräsentativität von Blutspendern. Eine frühere Studie schätzte, dass im Juni 14 Prozent der Einwohner von Manaus infiziert waren und damit wesentlich weniger als die Blutproben-Studie, die für diesen Monat 66,2 Prozent ermittelte.6 [29] Da Manaus im Frühjahr sehr heftig getroffen wurde, könnte die Wahrheit in der Mitte liegen.
Die Infektionsraten in der Stadt blieben nach ihrem Höhepunkt Ende April 2020 auch bis Dezember relativ niedrig. Ihr starker Anstieg im Januar kam daher überraschend. Nachlassende Immunität bei manchen Einwohnern, die sich zum großen Teil schon vor acht Monaten infiziert hatten, ist zwar nicht auszuschließen, könnte aber, so auch eine im medizinischen Fachmagazin The Lancet veröffentlichte Analyse [30], einen solch starken Anstieg nicht erklären.7 [31]
Wahrscheinlicher ist, neben der Überschätzung der Ansteckungsrate bis Oktober, eine geringere Immunabwehr gegen die neue Variante des Virus. Dies zeigt, dass Infektionswellen bei Sars-CoV-2 wie bei der Grippe immer wieder auftreten können, widerlegt jedoch nicht, dass diese mit der Zeit durch wachsende Immunisierung wieder abgeschwächt werden.
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-5061192
Links in diesem Artikel:
[1] https://jg-nachgetragen.blog/2021/01/08/corona-sterblichkeit-unterschiede-zwischen-laendern-ueberwiegend-zufall/
[2] https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.604339/full
[3] https://jg-nachgetragen.blog/2021/01/18/studie-von-ioannidis-und-kollegen-sieht-keine-wirkung-von-lockdowns/
[4] https://www.covid19.statistik.uni-muenchen.de/pdfs/codag_bericht_7.pdf
[5] https://jg-nachgetragen.blog/2021/01/26/codag-analyse-lockdown-in-deutschland-zeigte-kaum-wirkung/
[6] https://www.tagesschau.de/faktenfinder/dunkelziffer-corona-neuinfektionen-101.html
[7] http://www.matthias.schrappe.com/index_htm_files/Thesenpap7_210110_endfass.pdf
[8] https://www.ndr.de/nachrichten/info/68-Coronavirus-Update-Harter-Lockdown-jetzt,podcastcoronavirus272.html#Dunkelziffer
[9] https://www.rnd.de/gesundheit/was-die-dunkelziffer-uber-die-gefahr-von-corona-aussagt-und-was-nicht-LLY4GNDHIBHWJHCQ2SZ4BEXDX4.html
[10] https://www.t-online.de/digital/id_89192054/covid-19-impfungen-in-deutschland-mehr-als-eine-millionen-menschen-sind-vollstaendig-geimpft.html
[11] https://www.heise.de/tp/features/Corona-Rueckgang-der-Fallzahlen-durch-natuerliche-Immunitaet-5061192.html?view=fussnoten#f_1
[12] https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronaviruscovid19infectionsurveyantibodydatafortheuk/3february2021
[13] https://www.tagblatt.ch/leben/haben-wir-die-herdenimmunitat-bald-erreicht-ld.2083255
[14] https://www.heise.de/tp/features/Corona-Rueckgang-der-Fallzahlen-durch-natuerliche-Immunitaet-5061192.html?view=fussnoten#f_2
[15] https://www.handelsblatt.com/politik/international/corona-pandemie-in-spanien-waechst-die-angst-vor-der-dritten-welle-fast-jeder-dritte-infizierte-zeigt-keine-symptome/26722530.html
[16] https://www.heise.de/tp/features/Corona-Rueckgang-der-Fallzahlen-durch-natuerliche-Immunitaet-5061192.html?view=fussnoten#f_3
[17] https://www.rnd.de/gesundheit/neue-studie-immunitat-gegen-corona-kann-acht-monate-anhalten-UXDE5E4DVNHSDEO6EVKBENM4TQ.html
[18] https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-coronavirus-antibody-testing-chicago-rate-northwestern-20201009-jxzpyewzlrcgnny2fyflupqdcq-story.html
[19] https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/corona-ist-auf-dem-rueckzug-li.139546
[20] https://www.heise.de/tp/features/Corona-Rueckgang-der-Fallzahlen-durch-natuerliche-Immunitaet-5061192.html?view=fussnoten#f_4
[21] https://swprs.org/new-antibody-data-for-the-us-and-sweden/
[22] https://www.msf.org/high-coronavirus-covid-19-rates-found-amongst-people-living-hardship-paris
[23] https://www.heise.de/tp/features/Corona-Rueckgang-der-Fallzahlen-durch-natuerliche-Immunitaet-5061192.html?view=fussnoten#f_5
[24] https://www.bergamonews.it/2021/01/16/covid-nelle-ultime-24-ore-475-decessi-in-italia-in-lombardia-2-134-positivi-a-bergamo-82/415924/
[25] https://www.politico.eu/article/bergamo-italy-covid-second-wave-build-community-immunity/
[26] https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-spain-madrid-idUSKBN28S197
[27] https://science.sciencemag.org/content/371/6526/288.long
[28] https://www.the-scientist.com/news-opinion/study-estimates-76-percent-of-brazilian-city-exposed-to-sars-cov-2-68272
[29] https://www.heise.de/tp/features/Corona-Rueckgang-der-Fallzahlen-durch-natuerliche-Immunitaet-5061192.html?view=fussnoten#f_6
[30] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00183-5/fulltext
[31] https://www.heise.de/tp/features/Corona-Rueckgang-der-Fallzahlen-durch-natuerliche-Immunitaet-5061192.html?view=fussnoten#f_7
Copyright © 2021 Heise Medien