Die Corona-Krise und ihre Folgen
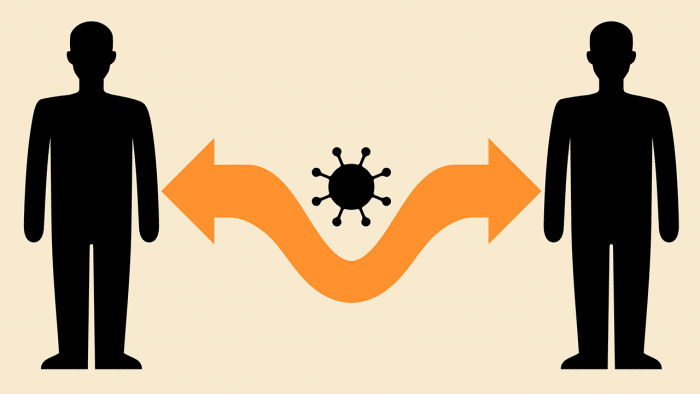
Corona-Pandemie zeichnet sich durch hohe Mortalität aus. Sie hat auch die gesundheitspolitischen Defizite offenbart. Eine adäquate Analyse steht aus.
Die durch das Virus Sars-CoV-2 ausgelöste Pandemie ist kein singuläres Ereignis. Deshalb muss die hier vorgetragene Einschätzung anhand vergleichbarer epidemiologischer Konstellationen kritisch überprüft werden.
Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen Auszug aus dem Sachbuch "Blinde Passagiere: Die Corona-Krise und ihre Folgen [1]" von Karl Heinz Roth, erschienen 2022 beim Verlag Antje Kunstmann. 480 Seiten, 30 Euro (print).
Auf die Darstellung der umfangreichen Quellen wurde in diesem Buchauszug verzichtet.
Es besteht somit Anlass, zu den in der Einleitung dieser Untersuchung aufgeworfenen Fragen zurückzukehren. Ein solcher vergleichender Rückgriff gestattet es uns, Distanz zum aktuellen Geschehen zu gewinnen und den methodischen Fehler zu vermeiden, Covid-19 als einmaliges Geschehen wahrzunehmen, das sich nur aus sich selbst zu erklären vermag.
Im Gegensatz zur Einleitung werde ich mich mit den komparativen Problemen jetzt quantifizierend auseinandersetzen. Dabei ist ein entscheidendes Phänomen wegweisend: Sars-CoV-2 ist mit den Influenzaviren zwar nur entfernt verwandt, bei seinen humanen Wirten verhält es sich jedoch hinsichtlich seiner Übertragungswege, Infektiosität, Pathogenität und des Befalls des Atemsystems sehr ähnlich.
Sicher gibt es auch einige gewichtige Unterschiede, so etwa bezüglich der Risiko- gruppen, wo bestimmte Influenzaviren nicht nur den Alten und Schwerkranken, sondern auch den Kleinkindern gefährlich werden. Trotzdem ist die Interaktion zwischen den beiden Erregergruppen und den Menschen derart ähnlich, dass der Vergleich der Covid-19-Pandemie mit den schweren Influenzapandemien des 20. und frühen 21. Jahrhunderts besonders naheliegt.
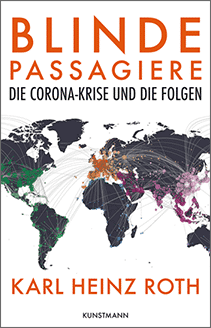
Nach der weltweiten, in der Einleitung skizzierten Grippe-Katastrophe der Jahre 1918–1920 war die Influenza wieder endemisch geworden.
Sie trat seither in jährlichem Turnus auf, und zwar jeweils im Herbst/Winter der südlichen und nördlichen Hemisphäre. Dieses "migrantische" Verhalten verlieh dem Geschehen einen saisonalen Charakter, aus der globalen Perspektive war es jedoch eher ein ganzjähriges Ereignis mit zwei sich überlappenden Anfängen bzw. Ausläufern.
Diese Periodizität war nicht etwa von den Menschen vorgegeben, sondern hatte in der Eigenart der Viren und geografischen Faktoren ihre Ursache. Die Influenzaviren sind bemerkenswert instabil. Sie mutieren häufig und bilden zahlreiche Subtypen, die von Saison zu Saison variieren, in mehreren Varianten gleichzeitig auftreten und sich mit weiteren viralen Erkältungserregern assoziieren, darunter auch einigen relativ harmlosen Coronaviren.
Gemeinsam befallen sie von Jahr zu Jahr die Atemwege von vielen Millionen Menschen. Dabei übernehmen manchmal neue Subtypen die Führung, die ihren menschlichen und tierischen Überträgern (Wildvögel und Schweine) durchaus gefährlich werden können. Das hatte immer wieder massive epidemiologische und medizinische Gegenaktionen zur Folge, die in Teil I dieser Studie thematisiert wurden.
Die seit einigen Jahrzehnten verfügbaren Impfstoffe wirken jedoch häufig nur selektiv und begrenzt. Zum Glück geschah – und geschieht – dies nur selten, aber die schweren Influenza-Pandemien hielten die kollektive Erinnerung an die Katastrophe von 1918 bis 1920 bis heute wach.
Die Spanische Grippe und die drei großen Influenza-Wellen
Die auf die "Spanische Grippe" von 1918 bis 1920 folgenden schweren Influenza-Pandemien brachen 1957, 1968 und 2017 aus. Sie verliefen in mehreren Wellen vom Herbst bis zum Frühling des Folgejahrs, manchmal aber auch in längeren Intervallen (so etwa die Hongkong-Grippe von 1968 bis 1970).
Sie wurden in der Regel von einem Subtyp dominiert, 2017/18 waren es drei. Ihre Infektiosität war hoch, mehrere hundert Millionen Menschen erkrankten. Trotz der vergleichsweisen niedrigen Sterblichkeit verloren insgesamt drei bis fünf Millionen Menschen ihr Leben; die meisten Opfer (2,2 Millionen) forderte die Asiatische Grippe 1957/58.
Die Folgen waren gravierend und führten zu schweren Belastungen der Gesundheitssysteme. Sie wurden jedoch von den politischen Instanzen und den Medien heruntergespielt. Es wurden auch keine über die seuchenhygienische Routine hinausgehenden Maßnahmen ergriffen.
Nur während der Influenza-Katastrophe von 1918 bis 1920 schlossen einige US-Bundesstaaten die Schulen und schränkten das öffentliche Leben ein – mit mäßigem Erfolg, wie sich später herausstellte.
Methodisch ist er problematisch, denn die auf die zweite Welle folgende dritte Welle von Covid-19 war Anfang Mai 2021 noch nicht abgeebbt und in die zu erwartende endemische Phase übergegangen. Wir vergleichen deshalb ein noch nicht abgeschlossenes Ereignis mit länger zurückliegenden historischen Prozessen.
Aufschlussreich ist diese Momentaufnahme aber auf jeden Fall. Bis zur letzten Aprilwoche 2021 hatten sich weltweit schätzungsweise 910 Millionen Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Etwa 4,1 Millionen Erkrankte waren verstorben, und dies entsprach einer Letalitätsrate von 0,45 Prozent. Damit übertraf die Sars-CoV-2-Pandemie sechzehn Monate nach ihrem Ausbruch die schweren Influenza-Pandemien der zweiten Hälfte des 20. und frühen 21. Jahrhunderts deutlich.
Zur Influenza-Katastrophe von 1918 bis 1920 bestand jedoch ein erheblicher Unter- schied. Damals hatte sich die Hälfte der Weltbevölkerung mit dem Influenza-Erreger angesteckt. Bis Ende April 2021 waren zwölf bis 15 Prozent mit Covid-19 infiziert; im Gegensatz zu damals wurde die inzwischen angelaufene Impfkampagne die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung vor der Infektion bewahren. Ferner folgten damals wie heute mehrere Pandemiewellen aufeinander, von denen die Zweite bzw. die Dritte am aggressivsten war.
Der größte und wichtigste Unterschied offenbart sich schließlich beim komparativen Blick auf die Sterblichkeit. Während der "Spanischen Grippe" starben zwischen 5,7 und zehn Prozent aller Infizierten; den neuesten Studien zufolge überlebten 40–50 Millionen die Influenza nicht.
Verglichen damit ist die Pathogenität von Sars-CoV-2 deutlich geringer ausgeprägt. Die Mortalität ist zwar von Welle zu Welle gestiegen. Sie beschränkte sich aber im Wesentlichen auf chronisch erkrankte und betagte Menschen, sodass sich die Letalitätsrate zwischen 0,5 und 0,8 Prozent einpendelte.
Damit hat sich die aus der Analyse des Pandemieverlaufs gewonnene Einschätzung auch im historischen Vergleich bestätigt. Covid-19 ist die schwerste Viruspandemie des Atemsystems, die die Menschheit seit der Influenza-Katastrophe von 1918 bis 1920 heimgesucht hat.
Schwerste Pandemie seit 1918, aber nicht so katastrophal
Aber es handelt sich nicht um eine Katastrophe vom Ausmaß der "Spanischen Grippe" von 1918 bsi 1920. Sie hat die gravierenden Schwächen aufgedeckt, die die Gesundheitssysteme seit ihrer Deregulierung in den 1990er-Jahren auszeichnen.
Soweit ein erster komparativer Überblick. Weitere Differenzierungen sind erforderlich und teilweise auch schon möglich.
Die Zahl der offiziell registrierten Sars-CoV-2-Infizierten lag Ende April 2021 noch deutlich unter dem Influenza-Durchschnitt; nur bei einer Schätzung unter Berücksichtigung der Dunkelziffer ergab sich ein annähernder Gleichstand. Hinsichtlich der Mortalität manifestierte sich jedoch ein gravierender Unterschied.
Einer typischen Influenza-Pandemie fallen jährlich 389.000 bzw. 409.100 Menschen zum Opfer, und dies entspricht einer Mortalität von 6 Verstorbenen pro 100.000.
Im Zusammenhang mit Covid-19 starben hingegen in den ersten 16 Monaten offiziell 2,77 Millionen sowie geschätzt 3,6 Millionen Menschen, was einer Mortalität von 36 bzw. 46 Todesopfern pro 100.000 Personen entspricht.
Während einer typischen saisonalen Influenza infizieren sich in Deutschland durchschnittlich sieben bis neun Millionen Personen, während bis Ende April 2021 schätzungsweise 11,84 Millionen mit dem Corona-Virus in Kontakt kamen (offiziell wurden knapp 3,382 Millionen positiv getestet).
Die Sterblichkeit war jedoch um ein Vielfaches höher: 82.850 Menschen überlebten ihre Erkrankung nicht; die Mortalität war mit knapp 100 Verstorbenen pro 100.000 Einwohner im Durchschnitt der beiden Schätzungen 18-mal höher als bei einer typischen Influenza. Somit ist die Infektiosität ähnlich, aber Sars-CoV-2 ist weitaus pathogener und gefährlicher als ein durchschnittliches Influenzavirus.
Von großer Bedeutung ist schließlich die Frage nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen einer typischen saisonalen Influenza und der Covid-19-Pandemie hinsichtlich der regionalen Verteilung der Sterbefälle im Weltmaßstab.
Während sich im subsaharischen Afrika kaum Diskrepanzen zwischen der durch eine typische Influenza und der durch Covid-19 bedingten Mortalität ergaben (5, 6 bzw. sieben Todesfälle pro 100.000), war die influenzabedingte Sterblichkeit in der westlichen Pazifikregion noch 16 Monate nach dem Ausbruch von Covid-19 um das Zweieinhalbfache größer (5,1 bzw. 2 pro 100.000).
In Südostasien verhielt es sich dagegen umgekehrt (5,8 bzw. 14 Todesopfer pro 100.000 Personen). Noch größer war der Unterschied in der östlichen Mittelmeerregion (4,5 Influenza-Opfer gegenüber 25 Covid-19-Toten pro 100.000).
Am größten war die Diskrepanz der letalen Folgen von Covid-19 zu einer durchschnittlichen Influenza jedoch in den Dauer-Epizentren der Pandemie, den beiden Amerikas und Europa. Bei einer durchschnittlichen Influenza bewegt sich die in diesen Kontinenten beobachtete Sterblichkeit in Größenordnungen von 6,2 bzw. 5,3 Todesopfern pro 100.000 Personen. Nach 16 Monaten Covid-19 stieg sie hingegen auf 148 bzw. 116 Verstorbene pro 100.000 der Grundeinheit.
Die vergleichende Analyse der regionalen Mortalitätsunterschiede bei Covid-19 und Influenza hat überraschend große regionale Unterschiede sichtbar gemacht. Eine wesentliche Rolle dürfte dabei die von Kontinent zu Kontinent sehr diskrepante Altersstruktur der Bevölkerung gespielt haben.
Leider reichten die statistischen Unterlagen zur regionalen Altersstruktur der Sars-CoV-2-Pandemie nicht aus, um diese Bezugsgröße in die quantifizierende Untersuchung einbeziehen zu können. Es bleibt zu hoffen, dass die Lücke bald geschlossen wird.
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-9235988
Links in diesem Artikel:
[1] https://www.kunstmann.de/buch/karl_heinz_roth-blinde_passagiere-9783956144844/t-2/
[2] https://www.kunstmann.de/buch/karl_heinz_roth-blinde_passagiere-9783956144844/t-2/
Copyright © 2023 Heise Medien