"Multikulti" bis "Querdenken": Ist unsere Gesellschaft polarisiert?
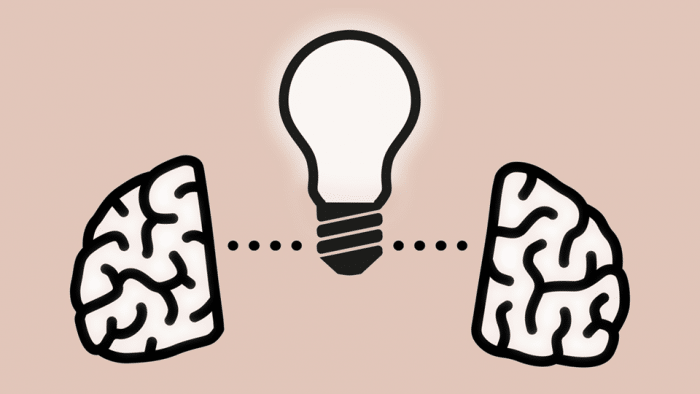
Ein Überblick über empirische Untersuchungen (Teil 1)
In Medienberichten heißt es wiederholt, unsere Gesellschaft sei "polarisiert" [1]. Themen wie Migration, Globalisierung, Klima werden genannt, die ungleiche Verteilung von Vermögen und Bildung als eine der Ursachen festgemacht, rechtsextreme Bewegungen, Pegida oder die AfD als Beleg herangezogen.
"Corona" gilt als "Verstärker" der Spaltungstendenzen. Die mediale Öffentlichkeit sieht in der "Querdenken"-Bewegung ein weiteres Polarisierungspotential. Verfolgt man die Presse- und sonstige Medienberichte und Kommentare, dann könnte man denken, Deutschland sei ein tief gespaltenes oder vielfach fraktioniertes Land, in dem sich grundlegend gegensätzlich orientierte Bevölkerungsteile gegenüberstehen. Dies wird dann als "Bedrohung der Demokratie" beklagt und von einer "Krise der Demokratie" gesprochen.
Es ist klar, dass ein bloßer Eindruck subjektiv und für eine Beantwortung der Fragen unzureichend ist. Es bleibt nichts anderes übrig, als auf möglichst repräsentative Befragungen zurückzugreifen. Die hier herangezogenen Untersuchungen haben meist ähnliche Fragestellungen, die sich in der Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt bündeln; einige stellen ihre Untersuchung in größere Zusammenhänge, andere fokussieren sich auf Teilaspekte.
Studie zu Akzeptanz und Vielfalt
Nehmen wir als erstes die Frage nach der Akzeptanz von gesellschaftlicher "Vielfalt". Dazu gibt es eine neuere und sehr komplexe repräsentative Umfrage der Robert-Bosch-Stiftung von 2018/19 [2].
Es wurden "sieben ‚Vielfalts‘-Dimensionen identifiziert und messbar gemacht: Lebensalter, Behinderung, Geschlecht, sexuelle Orientierung, ethnische Herkunft, Religion und sozioökonomische Schwäche."
Die Studie kommt zu dem Schluss, auf das Ganze gesehen werde "gesellschaftliche Vielfalt in Deutschland überwiegend positiv bewertet." Für ganz Deutschland ergibt sich ein Bejahungsindex von 67,71 von 100). Dabei werden deutliche regionale Unterschiede und ein Nord-Süd- sowie ein West-Ost-Gefälle sichtbar: In Hamburg ist der Akzeptanzwert am höchsten (72,30), in Baden- Württemberg liegt er in der Mitte (67,50) in Sachsen am niedrigsten (61,49). In den Dimensionen finden "sozioökonomische Schwäche" (58,33) und "Religion" (44,17) am wenigsten Wertschätzung.
Überraschend ist, dass Vielfalt in Bezug auf "ethnische Herkunft" einen hohen Akzeptanzwert hat (72,54).
Studie: Zugehörigkeit und Gleichwertigkeit
In eingeschränktem Maße wird die relativ hohe Zustimmung zur "Willkommenskultur" in einer speziellen Studie der Universität Bielefeld und der Mercator Stiftung: "Zugehörigkeit und Gleichwertigkeit - ZuGleich" [3] einigermaßen bestätigt.
Dem Statement "Ich freue mich, dass Deutschland noch vielfältiger und bunter wird" stimmen 46,7 Prozent der Befragten ohne Migrationshintergrund zu, wobei es zusätzlich weniger ausgeprägte, aber positive Zustimmungen gegenüber Migranten gibt. Die Zustimmung zur Zuwanderung ist nicht unbeschränkt, worauf ich noch eingehen werde.
Welche Gruppen sind es, deren Vorbehalte gegenüber "dem anderen" größer sind und damit die Bereitschaft zu Akzeptanz oder produktiver Auseinandersetzung geringer? Nach der Studie der Robert-Bosch-Stiftung sind es zum einen "Ältere" (u.a. Männer), die in Zeiten geprägt wurden, in denen in der bundesrepublikanischen Gesellschaft fester gefügte Normen bestanden als heute in Gesamtdeutschland.
Zum anderen sind es diejenigen, die das Gefühl haben von der Globalisierung weniger zu profitieren oder unter den neuen Bedingungen benachteiligt zu sein. Allerdings seien - so die Studie - "weder die 'Verlierer' noch die 'Gewinner'… per se besonders akzeptierend bzw. in außergewöhnlich hohem Maße ablehnend."
Überhaupt kommt die Studie zum Ergebnis, dass individuelle und persönliche Aspekte bedeutender seien als strukturelle. Individuelle ökonomische Prosperität und bessere Bildung stärken zwar die Akzeptanz von Vielfalt, aber geringeres Einkommen oder Arbeitslosigkeit sind nachrangig gegenüber persönlichen Einstellungen. Es kommt eher auf die wirtschaftliche Lage in der Region an: "in Regionen mit höheren Einkommensunterschieden (ist) auch die Akzeptanz von Vielfalt höher ..."
Was fördert Vielfalt?
Als persönliche, die Akzeptanz fördernde Einstellungen werden "Empathiefähigkeit, die (eher linke) politische Orientierung und eine positive Einstellung zur Globalisierung" genannt.
Ein überraschendes Nebenergebnis ist die Sicht auf die Rolle der Internetnutzung, die oft vertretenen Ansichten widerspricht: "Je h��her das Ausmaß der täglichen Internetnutzung ist und damit ein Verständnis des Internets als 'Tor in die Welt', desto höher ist auch das Ausmaß der Akzeptanz von Vielfalt." (Hier müsste man vielleicht einschränken, dass es auch darauf ankommt, wo man sich im Internet bewegt!)
Nach den Autoren ist die "Akzeptanz von Vielfalt" neben dem Vertrauen in Institutionen und in die Mitmenschen die entscheidende "Stellschraube", um gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Es gebe "einen positiven Zusammenhang zwischen der Akzeptanz von Vielfalt und sozialem Zusammenhalt." Wo Vielfalt und Zusammenhalt stark ausgeprägt ist, seien die Menschen auch "glücklicher und zufriedener mit ihrem Leben."
Entgegen oft geäußerter Ansicht kommen die Autoren der der Auffassung, dass da, wo Vielfalt erlebbar ist, Vielfalt auch eher akzeptiert wird. Sie vermuten, "dass das Vorhandensein einer gewissen Vielfalt Grundvoraussetzung ist, um überhaupt einen konstruktiven Umgang mit ihr erlernen und einüben zu müssen." Als Feld der Einübung von Vielfalt und Akzeptanz empfehlen sie vor allem die Nachbarschaft.
Studie: "Vom Unbehagen an der Vielfalt"
Die Studie der Bertelsmann-Stiftung "Vom Unbehagen an der Vielfalt" [4] kam zum Teil zu anderen Ergebnissen. Ihr Fokus war der "populistisch orientierte Antipluralismus in Deutschland". Dabei zeichnet die Studie ein differenziertes Bild des Bevölkerungssegments der mehr oder weniger "antipluralistisch" Eingestellten. Sie werden in "Zweifler", "Verunsicherte", "Frustrierte" und "Ausgegrenzte" kategorisiert.
Entgegen der Robert-Bosch-Stiftung-Studie sehen die Autoren bei den Frustrierten und Ausgegrenzten eine starke strukturelle Benachteiligung: sie leben in strukturschwachen Regionen, unter schlechten Wohnverhältnissen, sind nicht in soziale Netzwerke eingebunden, haben ein niedriges Einkommen und eine unterdurchschnittliche Bildung. Das Vertrauen in Mitmenschen, die gesellschaftlichen und politischen Institutionen ist gering.
Dennoch kommen die Autoren am Schluss zu einer "optimistischen" Beurteilung "über das Ausmaß des engeren, populistisch orientierten Antipluralismus in Deutschland." Es seien "etwa zwölf Prozent der Befragten, denen eine verringerte Lebenszufriedenheit, eine pessimistische Lebenseinstellung, persönliche und gesellschaftliche Frustrationserfahrungen, eine fehlende soziale Einbindung sowie unzureichende materielle Ressourcen gemein sind."
Es findet sich hier eine resignative Grundhaltung, aber auch Protest- und am Rande-Gewaltbereitschaft. Die Anti-Pluralismus-Haltung ist auch nach dieser Studie im Osten Deutschlands ausgeprägter als im Westen, aber nicht nur dort zu finden.
Fazit: Keine starke Polarisierung, aber auch keine Homogenität
Überblickt man diese Untersuchungen, dann kann man nicht von einer starken Polarisierung der deutschen Gesellschaft im Zusammenleben sprechen. Die Gesamttendenz der Untersuchungen besagt, dass in Deutschland die Akzeptanz von Vielfalt und Zugehörigkeit früher ausgegrenzter Gruppen gewachsen ist und einen starken Anhalt in der Bevölkerung hat.
Es sind marginale, wenn auch unübersehbare Gruppen, die sich im Widerspruch zum "Vielfaltstrend" in der Gesellschaft befinden. Das enthält allerdings Konfliktpotential und bleibt nicht ohne Auswirkungen auf das gesellschaftliche Klima. Homogen oder ohne Spannungen ist die deutsche Gesellschaft nicht.
Diese Tendenz kann sich verändern - gerade in schwierigen Zeiten wie gegenwärtig - ist aber auch ausbaufähig. Darin unterscheidet sich die deutsche Gesellschaft immer noch von der anderer Länder wie die USA oder Polen, wo es starke Polarisierungen gibt, bei denen vorerst wenig Aussicht auf Überwindung zu bestehen scheint.
Man kann davon ausgehen, dass in Deutschland Konfliktfragen in den Medien und in der Politik überbetont werden. Auch das medienwirksame rechtspopulistische Getöse ist kein "Mehrheitsdiskurs", so der Konfliktforscher Andreas Zick in Zeit Online.
Kritische Haltung zu Eliten und Politik
Bemerkenswert ist eine Ausnahme, auf die die Autoren der Robert-Bosch-Stiftung-Studie am Rande eingehen, eine Aversion gegen "Eliten". "Die Nichtakzeptanz von Vielfalt bezogen auf Aspekte wie Reichtum, ökonomische Macht und geistige Kompetenz ist deutschlandweit ausgeprägt." (42 Punkte von 100). Auch hier gibt es regionale Ausprägungen. In Hamburg und Baden-Württemberg ist diese Nichtakzeptanz am geringsten, in Ostdeutschland und im Saarland am höchsten.
Studie: "Die andere deutsche Teilung"
Die umfangreichste und ergiebigste neuere Studie zu Grundhaltungen und Wertorientierung der Deutschen ist die Studie von "More in Common e. V. Deutschland": "Die andere deutsche Teilung: Zustand und Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft" (2019) [5].
Nach dieser Studie sind 52 Prozent der Befragten unzufrieden, 48 Prozent zufrieden mit der Demokratie in Deutschland. 70 Prozent meinen, Deutschland bewege sich in die falsche Richtung. Hier ist in kurzer Zeit ein Sinken der positiven Bewertungen eingetreten. In der Bertelsmann-Studie von 2017 hatte die Aussage: "Alles in allem bin ich mit der Demokratie, wie sie in Deutschland besteht, zufrieden" noch einen Zustimmungswert von 0,6 (von eins) erreicht. Die Aussage "Die Demokratie ist die beste Staatsform" fand einen Wert von 0,5.
Polarisierung oder Segmentierung?
Ein differenzierter Blick auf das Gesamtergebnis zeigt aber große Unterschiede in verschiedenen Bevölkerungsteilen. Die Studie geht weniger nach sozioökonomischen, demografischen oder parteipolitischen Kategorien vor, sondern eher nach sozialpsychologischen Gesichtspunkten. Sie identifiziert in der deutschen Gesellschaft sechs Typen mit unterschiedlichem Wertfundament und Blick auf die Gesellschaft:
Die Offenen: Menschen, denen Selbstentfaltung, Weltoffenheit und kritisches Denken und Dialog wichtig ist. Demokratie hat einen hohen Stellenwert. Dabei bejahen sie den gesellschaftlichen Wandel. Sie sind eher linksorientiert und europäisch ausgerichtet. Sie gehören überwiegend zu den Jüngeren. - 16 Prozent der Bevölkerung.
Die Involvierten: Menschen mit Bürgersinn, die gesellschaftliches Miteinander schätzen und bereit sind gesellschaftliche Errungenschaften zu verteidigen. Sie sind eher zufrieden mit dem Funktionieren der deutschen Demokratie und haben zu 51 Prozent Vertrauen in Politiker auf Bundesebene. Sie fühlen sich zugleich deutsch und europäisch. In diesem Segment dominieren Ältere: 17 Prozent.
Die Etablierten: Menschen, denen Verlässlichkeit und gesellschaftlicher Frieden wichtig ist. Sie sind stolz auf ihr Land und am zufriedensten mit dem Status quo. Politisch stehen sie in der Mitte, ideologisch sind sie wertkonservativ und oft religiös ausgerichtet. Unter ihnen finden sich eher Männer und Ältere: 17 Prozent.
Die Pragmatischen: Menschen, denen Erfolg und privates Fortkommen wichtig ist, die sich weniger für Politik interessieren und ihren Mitmenschen nicht blind vertrauen. Ihr Verhältnis zum politischen System ist nutzenorientiert, das Verhältnis zur Gesellschaft und ihren Normen vage oder distanziert. Sie sind oft nicht sozial eingebunden. Sie sind mit Abstand die Jüngsten, und unter ihnen sind überdurchschnittlich viele mit Migrationshintergrund: 16 Prozent.
Die Enttäuschten: Menschen, denen das Gefühl von Gemeinschaft verloren gegangen ist und die sich Wertschätzung und Gerechtigkeit wünschen. Die Demokratie- und Politikzufriedenheit ist sehr gering. Man denkt eher national als europäisch und fühlt sich vom gesellschaftlichen Wandel bedroht: 14 Prozent.
Die Wütenden: Menschen, die Kontrolle, nationale Ordnung und häufiger autoritäre Führung mit (plebiszitären Elementen) schätzen; sie sind wütend aufs System, betrachten Medien, Institutionen und Politiker als abgehobene "Elite", die sich mehr um Minderheiten und Neuankömmlinge kümmere als um das "eigenen Volk".
Sie fühlen sich fremd in der Gesellschaft, interessieren sich aber für Politik, haben klare politische Ansichten, die nach rechts tendieren und kompromisslos vertreten werden. Das Weltbild ist geschlossen. Gegenüber raschem gesellschaftlichem Wandel plädieren sie für ein traditionsbewusstes Deutschland, wobei sie konservativ-autoritäre Traditionen bevorzugen. Sie zeichnen sich durch Abwertung bestimmter Minderheiten und Ablehnung des Islam als "kulturfremd" aus: 19 Prozent.
Keine dieser Gruppen hat eine Mehrheit. Mit der Studie der Robert-Bosch-Stiftung sieht diese Untersuchung eine einigermaßen gleiche Verteilung der unterschiedlichen Einstellungstypen im Osten wie im Westen Deutschlands. Die "Offenen" gibt es etwas seltener und die "Wütenden" etwas häufiger im Osten.
Die Autoren der Studie sprechen von einer Dreiteilung der Gesellschaft: den Stabilisatoren (Involvierte, Etablierte) - das sind 34 Prozent, den Extrem-Polen (Offene, Wütende) - 35 Prozent und dem "unsichtbaren Drittel" (Pragmatische, Enttäuschte) - 30 Prozent. Diese Einteilung erscheint nicht unbedingt schlüssig.
Man könnte die kompromissbereiten "Offenen" und Teile der "Pragmatischen" zu den gesellschaftsstabilisierenden Bevölkerungsteilen dazu rechnen und käme dann mit den Involvierten und Etablierten auf einen Wert von circa 60 Prozent.
Dies würde sich anderen Befragungen annähern, die eine grundsätzlich positive Einstellung zur "Vielfalts-Gesellschaft", aber mit Ambivalenzen annehmen. Die Studie berücksichtigt nicht fließende Übergänge zu den einzelnen Positionen, die anzunehmen sind.
Betrachtet man nur die Pole, könnte man von einer Polarisierung der Gesellschaft reden. Dies verkennt aber, dass es ein breites Mittelfeld gibt, wie immer das man auch bezeichnet. Man könnte von den Befunden her eher von einer Segmentierung oder Fraktionierung der deutschen Gesellschaft sprechen. Das trifft aber auch nur teilweise zu, denn: "70 Prozent der Menschen wünschen sich, dass wir trotz unserer Unterschiede zusammenfinden", befürworten also Zusammenhalt und gesellschaftliche Zusammenarbeit.
Die Aussage: "Im Grunde haben die allermeisten Menschen gute Absichten (trotz unterschiedlichen Überzeugungen, Religionen, Kulturen)" bejahen 69 Prozent. Dies trifft sich wieder mit der Studie der Robert-Bosch-Stiftung, die eine starke Bejahung der gesellschaftlichen Vielfalt feststellte. Gesellschaftliche "Spalter" sind also von der Mehrheit nicht erwünscht.
Die große Mehrheit beklagt, dass die "gesellschaftliche Debatte" in Deutschland immer schwieriger und hasserfüllter werde oder dass "selbst berechtigte politische Meinungen nicht mehr öffentlich geäußert werden, ohne dass man dafür angegriffen wird." (Letzteres wird besonders stark von den "Etablierten", "Enttäuschten" und "Wütenden" vertreten.)
Zumindest an den "Polen" tut sich hier ein Widerspruch auf: Offenheit und Kompromissbereitschaft auf der einen Seite steht gegen Beharren auf der eigenen Meinung und Durchsetzungsbestreben auf der anderen Seite. Diese Divergenzen sind wohl ein Grund dafür, dass trotz des Wunsches nach Zusammenhalt eine große Skepsis darüber herrscht, ob der Zusammenhalt (noch) einmal hergestellt werden könnte (53 Prozent).
Der Wunsch nach Kohärenz zeigt, dass eine starke Mehrheit zwar die Defizite in der Gesellschaft sieht, aber nicht grundsätzlich gesellschafts- oder systemfeindlich ist, auch nicht nur ichbezogen agieren möchte, sondern auf Veränderungen hofft. Frust mit Demokratie und Politik bedeutet nicht automatisch Abwendung.
Politik enttäuscht
Nach Ansicht der meisten Befragten kümmert sich die Politik nicht ausreichend um die - unterschiedlich gesehenen - "wichtigen Probleme" (wie Digitalisierung, Alterssicherung, bezahlbarer Wohnraum, Klimaschutz, Bekämpfung von Rechtsextremismus, Sicherheit, Begrenzung der Zuwanderung u.a.) (76 Prozent); man meint, Politiker interessierten sich nicht dafür, was die Leute denken (82 Prozent) und man bekäme zu wenig vom wirtschaftlichen Erfolg ab (65 Prozent).
Die Autoren kommentieren das so: "dass sich Deutschland für viele Bürgerinnen und Bürger wie ein Land im Wartezustand anfühlt - was dessen Zukunftsfähigkeit gefährdet." Andererseits sind 53 Prozent überzeugt, dass Bürger durch ihre Entscheidungen und Handlungen die Gesellschaft verändern können. Was Bürger vom Staat und der Politik erwarten, ist Abhilfe bei Missständen und "Gerechtigkeit". Hier steht vor allem die soziale Versorgungssicherheit im Vordergrund (71 Prozent). Gerechtigkeitsfragen beschäftigen die Gesellschaft mehr als etwa die Themen Migration oder Klima.
Verlieren Medien wirklich Vertrauen?
Demokratie lebt von Debatte. Debatte lebt von Austausch und Information. Dabei zeichnet sich nach dieser Studie ein großer Bruch in den Vermittlungskanälen ab. In der Rangliste, wie Informationen vermittelt und Meinungen gebildet werden, steht das persönliche Umfeld an erster Stelle (84 Prozent). Dann folgen "Experten" (68 Prozent). "Journalisten konkurrieren als klassischste Informationsquelle mit 31 Prozent unmittelbar mit persönlichen Social-Media-Kontakten (32 Prozent) … abgeschlagen rangieren Vertreter der Bundesregierung" (20 Prozent)." Die Autoren kommentieren das so:
Damit drohen mittelfristig - mit Ausnahme der Experten - allgemeinverbindliche und übergreifende Informationsquellen wegzubrechen … Dies erschwert womöglich die Bildung eines gesamtgesellschaftlichen Diskursraums, der auf gemeinsamen Maßstäben und geteilten Grundannahmen beruht.
Studie: "Informationsquellen in der Corona-Pandemie"
Ein von dieser Befragung abweichendes Bild zeigt eine repräsentative Befragung zu Beginn der Corona-Pandemie (durchgeführt vom 24. bis 26.03.20): "Gut informiert durch die Pandemie? Nutzung unterschiedlicher Informationsquellen in der Corona-Pandemie" [6].
Die Studie zeigt sehr komplexe Zusammenhänge auf und ich kann hier nur einige Tendenzen referieren. Die "Trias" der Informationsbeschaffung durch private Kontakte, soziale Netzwerke und journalistische Medien wird bestätigt, doch mit anderen Schwerpunkten. Die tägliche Nutzung öffentlich-rechtlicher Medien und Zeitungen wird schon vor der Corona-Krise wesentlich höher angegeben, als in der "More in Common"-Studie (50 Prozent)
Zu Beginn der Pandemie erfuhr sie einen Aufschwung (66 Prozent), wobei auch "Informationen von Behörden und Forschungseinrichtungen" starken Zuspruch fanden (57 Prozent). Das Vertrauen in die etablierten Medien war relativ groß (volles Vertrauen 51 Prozent und 35 Prozent teils/teils). Außerdem überwog der Eindruck einer eher konstruktiven Debatte und hilfreicher Hinweise in diesen Medien.
Dies korrespondierte mit einem starken Gefühl der Zusammengehörigkeit (55 Prozent) und einer überwiegend positiven Bewertung des Krisenmanagements der Entscheidungsträger (49 Prozent und 38 Prozent teils/teils).
Nach dem ersten Abflauen der Krise ging das Informations- und Gesprächsbedürfnis zurück, die Relevanz der Informationskanäle, das Vertrauen in Medien und Politik sowie das Zusammengehörigkeitsgefühl sank, aber nicht drastisch. Das Informationsverhalten "normalisierte" sich, die Ausdifferenzierung der Informationsbeschaffung nahm wieder zu. Nach dieser Befragung verloren die öffentlich-rechtlichen Medien ( minus 12,4 Prozent) und Zeitungen am wenigsten an Nutzungsintensität.
Je nachdem von welchen Informationsquellen Bürgerinnen und Bürger ihre Informationen bezogen, prägte das das Bild der Corona-Krise. Schon während der Anfangsphase der Pandemie informierten sich Befragte mit niedrigem Vertrauen in die etablierten Medien deutlich häufiger aus alternativen Onlinequellen. Deren Tendenz sich gegen den "Mainstream" zu richten, trug zur Etablierung von "Gegenöffentlichkeiten" bei.
Mainzer Studie: "Medienvertrauen 2020"
Von denselben Einrichtungen und zum Teil denselben Autoren wurde die "Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen 2020 – Medienvertrauen in Krisenzeiten" [7] durchgeführt (1.200 telefonisch Befragte, "statistische Fehlertoleranz 2,8 Prozent"; vgl. auch die Besprechung in Telepolis von Thomas Pany [8], 08.04.21, und ein Interview mit Mitautor Tanjew Schultz bei ZDF Heute [9]).
Die Studie der 7. Erhebungswelle kommt zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass 2020 das Vertrauen in die Medien, vor allem in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (70 Prozent Zustimmung) gestiegen sei. Auch der Corona-Berichterstattung der etablierten Medien wird überwiegend Zutrauen entgegengebracht (63 Prozent), allerdings ist der Anteil der Kritiker nicht unbeträchtlich: 31 Prozent der Befragten sind "viele Medienberichte zu einseitig".
Der "Medienzynismus", also die Ansicht, etablierte Medien "lügen", "manipulieren", "sind Sprachrohr der Mächtigen" oder "untergraben die Meinungsfreiheit" ist zurückgegangen (doch in den einzelnen Aussagen bei elf bis 26 Prozent Zustimmung immer noch beachtlich).
Rein internetbasierten Medien erfahren deutlich weniger Zutrauen - Social-Media-Nachrichten vertrauen nur 5Prozent, alternativen Nachrichtenseiten 14 Prozent.
Interessant sind Fragen zu Konspirationserzählungen: Dem Statement "Bill Gates will Menschen mit Corona-Impfungen Mikrochips implantieren und sie so kontrollieren" stimmen (2020) drei Prozent der Befragten zu. Das Narrativ "Die Pharmaindustrie verbreitet gezielt Krankheitserreger, um danach mehr Medikamente zu verkaufen" halten sechs Prozent für zutreffend (2019 waren es mehr: 18 Prozent).
Studie: "Verschwörung in der Krise"
Genaueres über die Verbreitung des Glaubens an "Verschwörungstheorien" erfährt man aus einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung: Jochen Rose, "Verschwörung in der Krise" [10] (2020) (2019/20 wurden 3250 Personen telefonisch befragt).
Unter den während der Krise Befragten meinten fünf Prozent, dass "das Corona-Virus ein Vorwand sei, um die Menschen zu unterdrücken", neun Prozent halten das für wahrscheinlich. Laut einer etwas später durchgeführten Umfrage des ARD-Politikmagazins Kontraste [11] mit einer ähnlichen (aber undifferenzierten) Fragestellung sind es 17 Prozent, die das so sehen.
Besonders verbreitet ist dieser Glaube unter AfD-Anhängern. Je höher der (formale) Bildungsabschluss ist, desto geringer ist die Akzeptanz. Die Neigung an diverse allgemeine Verschwörungstheorien zu glauben oder sie für wahrscheinlich zu halten, ist wesentlich höher (24 Prozent!) - hat sich aber den Befragungsantworten nach während der Krise nicht verstärkt, sondern etwas verringert.
Unter denen, die das Corona-Virus für einen Vorwand halten, besteht eine hohe Korrelation zum Misstrauen gegenüber politischen Nachrichten in den öffentlich-rechtlichen Medien und einer Bevorzugung des Bezugs politischer Nachrichten in sozialen Medien.
Ob man von einer "zunehmenden Polarisierung" in der Bewertung der etablierten Medien reden kann, hängt stark von der Sichtweise auf die Daten ab. Zusätzliche Analysen der Mainzer Forscher ergaben, dass negative Einstellungen mit wirtschaftlicher Zukunftsangst einhergehen und mit einer Präferenz für politische Ränder, alternative Online-Nachrichten und Nutzerkommentare.
Wie es zu den Diskrepanzen zwischen der "More in Common"- Untersuchung in Hinsicht auf die Bewertung "journalistischer Medien" und beiden Studien der Forschergruppe aus Mainz/ Düsseldorf kommt, lasse ich offen. Man denkt erst, es könnte sich bei den Mainzer/Düsseldorfer-Studien um "ARD-Werbung" handeln. (Das legt sich bei der Nähe der Fachzeitschrift "Media Perspektiven" [12] zur ARD, in der die Studie veröffentlicht wurde, nahe).
Faktisch ist das bei den Ergebnissen so – was aber nicht heißt, dass die Befragungen nicht offen waren. Dem steht die Aussage der Autoren entgegen: "Die Studie ist wissenschaftlich unabhängig, finanziert aus Forschungsmitteln der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler".
Gegen Online-Befragungen [13] gibt es kritische Einwände, so etwa Zweifel an der Repräsentativität. Ein Grund für die Diskrepanz könnte auch sein, dass es im Verlaufe der Pandemie zu einem Einstellungswandel kam. Wenn die Studien verlässlich sind, wären sie eher ein Beleg gegen die These einer starken Polarisierung der deutschen Gesellschaft als dafür.
Gibt es ein Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland?
Es gibt außer der Tatsache, dass man durch Herkunft deutscher Staatsbürger ist, durchaus identitätsstiftende und verbindende Merkmale, worauf die "More-in-Common-Studie" hinweist. Man ist vor allem stolz auf vielfache ehrenamtliche Tätigkeit (83 Prozent), das Grundgesetz (77 Prozent), die wirtschaftliche Leistung (77 Prozent), das kulturelle Erbe (76 Prozent) die Wiedervereinigung (74 Prozent) und die Geschlechtergleichheit (71 Prozent); der Einsatz für die europäische Einigung veranlasst 65 Prozent zu Stolzgefühlen, die Aufnahme von Flüchtlingen 46 Prozent.
Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft wird nicht nur an die deutsche Herkunft gebunden, sondern als "erwerbbar" betrachtet, wobei man einhellig "Integrationsbereitschaft (u.a. Sprachkenntnisse), Normkonformität (Achtung deutscher Gesetze, Werte und Traditionen) und Leistungsbereitschaft" erwartet.
Auch diese Studie zeigt, dass die deutsche Gesellschaft komplex ist und es von "Pol" zu "Pol" beträchtliche Divergenzen gibt. Es stehen sich aber nicht wie in den USA große, durch tiefe Gräben getrennte Blöcke gegenüber, die sich in Schichten, Ethnien, Regionen, zwei Parteien und Medien manifestieren. (Zumindest stellt sich das von außen so dar, wobei bei diesem Blick möglicherweise eine kompromissbereite, aber "ermüdete Mitte" übersehen wird, die "More in Common USA" in einer Untersuchung "Hidden Tribes" [14] feststellte.)
Was sich in Deutschland abzeichnet, ist eine Vertrauenskrise zwischen großen Teilen der Bevölkerung und den politischen Institutionen sowie dem "Establishment" in Politik, Medien und Wirtschaft, wobei es offenbar 2020 eine gegenläufige Tendenz gab. Diese Dissonanz erscheint eher als Herausforderung denn als unlösbare Krise und Spaltung. Die Autoren der "More in Common"-Studie bringen das in ihren Schlussworten zum Ausdruck:
Ziel muss eine Demokratie bleiben, die für alle Menschen da ist und in der jede und jeder eine echte Chance hat, zu Wort zu kommen und gehört zu werden. Diesbezüglich Vertrauen zurückzugewinnen, ist eine massive Gestaltungsaufgabe für politische Verantwortungsträger und gesellschaftliche Institutionen. Dies gilt auch für die Medien, deren Funktion als objektive Berichterstatter derzeit von sehr vielen Menschen in Deutschland ernsthaft in Zweifel gezogen wird.
Die Autoren "laden dazu ein, sich von manch vorschneller Annahme über die großen Trennlinien in unserem Land zu verabschieden." Sie meinen, es bestünden Chancen zu mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt durch Bemühungen um eine "offene Gesprächsatmosphäre", den "Austausch mit Andersdenkenden" und eine stärkere Partizipation vernachlässigter Bevölkerungsteile am politisch-gesellschaftlichen Geschehen.
Gegen die Validität statistischer Befunde bei Meinungsumfragen lässt sich einiges einwenden. Trotz möglicher Fehlerquellen bilden sie aber bei professioneller Durchführung der Befragungen Einstellungstendenzen ab, die der Realität entsprechen. Eines vom Wichtigsten, was man aus den Studien lernen kann, ist, dass die subjektive Wahrnehmung der Verbreitung der eigenen Position und der anderer täuschen kann. Eine "Objektivierung" durch die Untersuchungen lässt die "Vielfalt" im Meinungsspektrum der deutschen Gesellschaft in den Blick kommen, was man auch positiv sehen kann.
Angemerkt sei hier, dass Polarisierungstendenzen in einer demokratischen nicht unbedingt negativ zu bewerten sind. "Weder in seinen werte- noch in seinen handlungsbezogenen Dimensionen ist politische Polarisierung der Demokratie grundsätzlich wesensfremd." (siehe Ludger Helms, Polarisierung in der Demokratie: Formen und Wirkungen [15]).
Polarisierungen fordern zur "Debatte" und zu Korrekturen heraus. Sofern polarisierende Positionen nicht den grundlegenden Ideen und Kommunikationsformen einer liberalen Demokratie verpflichtet sind, sind sie allerdings "hochproblematisch und eindeutig schädlich für die Demokratie", so Helms.
Dr. theol. Wolfram Janzen, Studium der Theologie und Germanistik, vor seiner Zurruhesetzung tätig als Religionspädagoge in Schulen, Hochschule und Lehrerinnenaus- und -fortbildung. Veröffentlichungen im pädagogischen und religionswissenschaftlichen Bereich. War an religionssoziologischen Forschungen zu "Jugend und Religion" beteiligt.
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-6033562
Links in diesem Artikel:
[1] https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/corona-polarisierung-gesellschaft-rassismus-101.html
[2] https://www.bosch-stiftung.de/de/presse/2019/04/vielfaltsbarometer-2019-gesellschaftliche-vielfalt-deutschland-ueberwiegend-positiv
[3] https://www.stiftung-mercator.de/content/uploads/2020/12/ZugleichIII_Stiftung_Mercator_Langfassung.pdf
[4] https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/LW_Studie_2017_Unbehagen_an_der_Vielfalt.pdf
[5] https://www.dieandereteilung.de/
[6] https://www.ard-werbung.de/fileadmin/user_upload/media-perspektiven/pdf/2020/1011-20_Viehmann_Ziegele_Quiring.pdf
[7] https://medienvertrauen.uni-mainz.de/files/2021/04/Medienvertrauen_Krisenzeiten.pdf
[8] https://www.heise.de/tp/features/Corona-Krise-Vertrauensplus-fuer-Medien-6009350.html
[9] https://www.zdf.de/nachrichten/digitales/medienvertrauen-uni-mainz-medienstudie-2019-100.html
[10] https://www.kas.de/documents/252038/7995358/Verschw%C3%B6rung+in+der+Krise+%28PDF%29.pdf/7703c74e-acb9-3054-03c3-aa4d1a4f4f6a?version=1.1&t=1608644973365
[11] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1181727/umfrage/offenheit-gegenueber-verschwoerungstheorien-in-der-corona-krise/
[12] https://www.ard-werbung.de/media-perspektiven/
[13] http://www.thielsch.org/download/thielsch_2009_onlinebefragungen.pdf
[14] https://www.newyorker.com/news/daily-comment/a-new-report-offers-insights-into-tribalism-in-the-age-of-trump
[15] https://webapp.uibk.ac.at/ojs2/index.php/OEZP/article/viewFile/1817/1477
Copyright © 2021 Heise Medien