Vergesellschaftet Twitter!
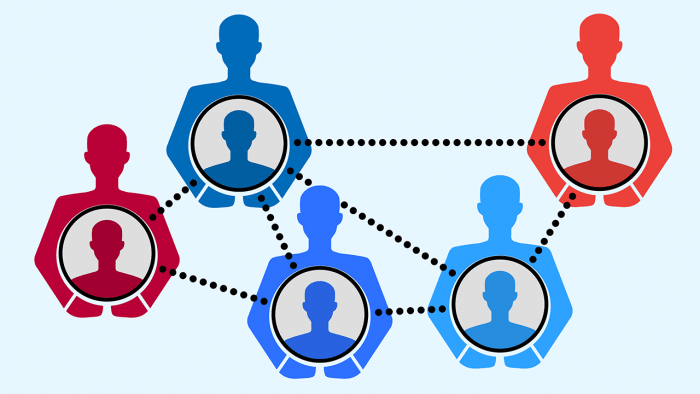
Soziale Netzwerke sind wichtig. Die Plattform-Unternehmen drücken Kosten. Darunter leidet die Qualität. Arbeitsverhältnisse der Moderatoren sind bedrückend. Das muss nicht so sein.
Digitale Plattformen prägen unser Leben und die Öffentlichkeit. Um trotz der einsetzenden Wirtschaftskrise profitabel zu bleiben, entlassen sie Mitarbeiter und verknappen und verteuern ihre Leistungen. Aber was schuldet die Bevölkerung eigentlich den digitalen Grundherren?
Ohne freie Rede keine freiheitliche Gesellschaft, ohne Meinungsfreiheit keine Demokratie – wer würde dem widersprechen? Auch der Milliardär Elon Musk nennt sich einen "Meinungsfreiheitsfanatiker".
Um der Redefreiheit wieder zu ihrem Recht zu verhelfen, kaufte er letztes Jahr Twitter, für schlappe 44 Milliarden US-Dollar. Denn der Kurznachrichten-Dienst hatte Falschaussagen von Donald Trump mit Warnhinweisen versehen und ihn nach der Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 schließlich ganz verbannt. Andererseits unterdrückte die Plattform einen Bericht, der der Demokratischen Partei im Wahlkampf hätte schaden können.
Seit Herbst 2022 gehört Twitter also einem der reichsten Menschen der Welt. Als erstes ließ Musk darüber abstimmen, ob Trump sich wieder über die Plattform äußern darf. Knapp 52 Prozent sagten ja, der Ex-Präsident bekam seinen Account zurück. "Vox populi vox dei", kommentierte Musk, die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes.
Die Stimme Gottes wird kostenpflichtig
Die Pointe der Geschichte: im März 2023 entschied der neue Twitter-Chef, dass nur noch zahlende Abonnenten abstimmen dürfen. Wer keine sieben US-Dollar im Monat übrig hat, dessen Votum ist nicht gefragt. Die Stimme Gottes wird kostenpflichtig.
So steht es um die Struktur der Öffentlichkeit. In seinem digitalen Reich agiert Elon Musk wie ein Fürst. 133 Millionen Menschen haben seine Kurznachrichten abonniert, eine beachtliche Gefolgschaft. Worüber das Volk abstimmen darf, entscheidet der Souverän. Fällt das Ergebnis unangenehm aus, fühlt er sich nicht daran gebunden.
Zu den ersten Entscheidungen gehörte, einen Kanal zu schließen, der seine unzähligen Privatflüge dokumentierte. Als ihm US-Reporter mit ihrer kritischen Berichterstattung auf die Nerven fielen, wurden sie kurzerhand gesperrt.
Das Problem
Prominente Antisemiten und Rassisten bekommen ihr digitales Megaphon zurück, während Twitter im Auftrag von Regierungen missliebige Nachrichten unterdrückt. So ist in Indien eine BBC-Fernsehdokumentation nicht mehr erreichbar, weil sie den hindunationalistischen Machthabern nicht gefällt.
Natürlich sind diese Zustände älter als Musks Twitter-Übernahme, und sie beschränken sich auch nicht auf diese Plattform. Alle weltweit tätigen Suchmaschinen, Soziale Medien und Nachrichtenapps kooperieren mit den Machthabern vor Ort.
Sie schließen Oppositionelle aus – zum Beispiel Facebook auf Anfrage der türkischen Regierung die kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG –, zensieren Nachrichtenkanäle – zum Beispiel Snapchat, den Sender Al Jazeera auf Anfrage der saudi-arabischen Regierungen –, stellen der politischen Polizei Informationen über Regierungskritiker zur Verfügung.
Bürgerversammlungen in privatisierten Veranstaltungsräumen
Der Begriff "Plattform" hat sich eingebürgert, aber er hat etwas Ideologisches. Die Unternehmen bieten digitale Dienste an: Suchen, Vernetzen, Kommunizieren … Sie stellen sich gerne als neutrale Vermittler dar, die sich freundlicherweise nicht näher bestimmten Gemeinschaften zur Verfügung stellen ("Community!").
Aber die Plattformen ermöglichen nicht nur einen Austausch, sie bestimmen die Regeln des Austauschs. Sie finanzieren sich, indem sie sich einen Teil der Umsätze aneignen, wenn finanzielle Transaktionen stattfinden, oder indem sie die anfallenden Daten für Werbezwecke vermarkten.
Twitter, Whatsapp, Youtube: Gesellschaftliche Infrastruktur
Twitter, Whatsapp, Youtube etc. sind zu einer gesellschaftlichen Infrastruktur geworden – Orte des kulturellen Lebens und der politischen Meinungsbildung. Dabei verhalten sich die Plattformen aber keineswegs neutral. Sie wählen aus, was sie löschen, was sie verstecken oder im Gegensatz nach oben spielen. Sie entscheiden, mit welchen Inhalten sich Einkünfte erzielen lassen und mit welchen nicht.
Bei dieser Steuerung geht es den Betreiber darum, ihre eigenen Einnahmen zu steigern (zum Beispiel, indem sie möglichst kurze Beiträge über möglichst lange Zeiträume präsentieren). Kurz, sie verhalten sich, als hätten sie das Hausrecht, obwohl in ihren Räumen Bürgerversammlungen stattfinden.
Einige aus dem liberalen und neoliberalen Lager halten jede inhaltliche Einflussnahme der Plattformen-Betreiber für illegitim. Aber Kontrolle ist aus mehreren Gründen unverzichtbar: um die technische Sicherheit trotz Hacking zu gewährleisten, damit trollende Minderheiten nicht jede Kommunikation sabotieren können, schließlich weil manche Aussagen und Bilder zu Recht verboten sind.
Es braucht menschliche Vernunft und Arbeit (und anständige Entlohnung)
Inhaltskontrolle und technische Wartung lassen sich nicht automatisieren. Es braucht menschliche Vernunft und Arbeit, um die entsprechenden, teilweise subtilen Entscheidungen zu treffen. Algorithmen können Menschen dabei höchstens als Werkzeug dienen.
Für Arbeitskraft zu bezahlen, passt aber nicht so richtig zum Geschäftsmodell der Internetkonzerne. Sie wollen immer größere Datenmengen bei gleichbleibenden Ausgaben verarbeiten, um die erwünschte Rendite zu erzielen. Ihre Dienste müssen "skalieren", um es im IT-Jargon zu sagen.
Deshalb drücken die Unternehmen die Kosten und leisten nur das Allernotwendigste – manchmal nicht einmal das. Ein skandalöses Beispiel sind die Übergriffe gegen die muslimische Minderheit der Rohingya in Myanmar ab dem Jahr 2012. Sie wurden über Facebook angestachelt, teilweise sogar organisiert, bis zu der massenhaften Vertreibung der Rohingya im Jahr 2017.
Die Plattform unternahm nichts dagegen; sie hatte zu diesem Zeitpunkt nicht einmal Mitarbeiter vor Ort, die der Landessprache mächtig waren.
Trotz einiger Lippenbekenntnisse hat sich an der Unterfinanzierung der Inhaltskontrolle nichts geändert. Die Arbeitsverhältnisse der Moderatoren sind bedrückend. Sie machen einen äußerst belastenden Job für erbärmliche Löhne, unter enormen Zeitdruck, ohne angemessene Unterstützung, Anerkennung oder berufliche Aufstiegsmöglichkeiten.
Darunter leidet auch die Qualität: Inhaltskontrolle in ihrer heutigen Form ist eine Art digitales Fließband. Den Beschäftigten fehlt die Zeit für schwierige Abwägungen, um sich zu informieren, um Rücksprache zu halten mit den Betroffenen.
Muss das eigentlich sein? Warum muss das so sein?
Big Brother und der freie Markt
Im Zentrum der Kritik an der Macht der Plattformen standen nicht die Arbeitsverhältnisse oder ihre marktbeherrschende Stellung, sondern die Angst vor Desinformation, politischer Polarisierung und Kontrollverlust.
Regierungen nahezu aller Länder bauten in den 2010er-Jahren ihre Kontrolle aus (wobei sich ihr Einfluss umso deutlicher geltend machte, je bedeutsamer der Markt für die Plattform-Betreiber war). Die Anbieter wurden einer gesetzlichen Regulierung unterworfen, die sie zu einer engeren Zusammenarbeit mit den Aufsichts- und Polizeibehörden und einer schärferen Inhaltskontrolle verpflichtet.
Im Gegensatz dazu fehlt der Zivilgesellschaft weiterhin die Möglichkeit, Entscheidungen der Plattformen zu beeinflussen. Zwar haben einige Unternehmen begonnen, Plattform-Räte einzurichten. Diese sind aber höchstens beratend tätig und letztlich rein symbolisch. Die Unternehmen optimieren mit ihren Inhalten wie bisher ihre (Werbe-)Einnahmen, während sie sich bei umstrittenen Themen an etablierten Institutionen orientiert.
So haben die widerstrebenden Interessen Kommerzialisierung und Staatssicherheit einen Ausgleich gefunden. Den Plattformen wäre zwar jeder Inhalt recht, der Aufmerksamkeit erzeugt, die sich wiederum in Werbeeinnahmen umsetzen ließe, aber sie kommen den Wünschen der jeweiligen Machthaber nach, wenn diese bestimmte Beiträge oder Debatten unterbinden wollen.
Das freie Unternehmertum hat die zunehmende staatliche Kontrolle nicht verhindert, was selbst Teile der netzpolitischen und bürgerrechtlichen Bewegung hofften. Kurz, die Alternative lautet nicht "Big Brother-Überwachung oder Kommerz", beides kann heute Hand in Hand gehen.
Mehr Stress für Mitarbeiter, schlechtere Infrastruktur für alle
Die nachlassende Nachfrage und die steigenden Zinsen machen den Plattformen zu schaffen. Auch Elon Musk braucht dringend Geld. Laut der Financial Times hat Twitter Schulden in Höhe von insgesamt 13 Milliarden US-Dollar und muss jährlich über eine Milliarde Zinsen zahlen.
Geradezu manisch sucht das Management nach Möglichkeiten, Einkünfte zu erzielen. Wer nicht kostenpflichtig abonniert, dessen Tweets werden anderen Nutzern nicht mehr empfohlen. Sogar Links zu anderen Internetseiten und Diensten wurden zeitweilig gesperrt, bis der Protest der Gemeinde zu laut wurde. Weil zusätzliche Leistungen wie die "Authentifizierung" kaum nachgefragt werden, bekommen die Nutzer noch mehr Werbung zu sehen. Auch die Regeln für politische Werbung in den USA wurden gelockert.
Seit Herbst 2022 wurden etwa drei Viertel der Twitter-Mitarbeiter entlassen (wobei diese Zahlen aufgrund der Auslagerung nicht alles sagen). Gekündigt wurde auch im Bereich Wartung und Sicherheit, weshalb das Risiko gestiegen ist, dass personenbezogene Daten abhandenkommen oder Schadsoftware auf das Endgerät gelangt.
Musk fordert Hardcore-Arbeitseinstellung
Viele Stellen wurden unmittelbar nach der Kündigung mit geringeren Gehältern neu besetzt. Von den verbliebenen Mitarbeitern forderte Musk eine "Hardcore-Arbeitseinstellung … lange Arbeitszeiten bei hoher Intensität" und warnte, dass "nur außergewöhnliche Leistungen" den Arbeitsplatz sichern könnten.
Ähnliche Entwicklungen finden sich bei allen Plattformen, nicht nur im Bereich Social Media, sondern auch bei Liefer- und Fahrdiensten und im E-Commerce.
Meta-Chef Mark Zuckerberg kündigte ein "Jahr der Effizienz" an: Die Kosten müssen runter! Mitarbeiter werden entlassen oder verdienen trotz härterer Arbeit weniger. Dennoch fließen weiterhin hohe Anteile des Umsatzes an die Aktionäre und das Management. Die digitale Infrastruktur wird teurer und damit auch undemokratischer, weil ärmere Nutzer ausgegrenzt werden.
Muss das eigentlich sein? Warum muss das so sein?
Wie kommen wir raus aus dem digitalen Kapitalismus?
Die Kritik an der Macht der Internetkonzerne teilte bisher die libertären Grundannahmen des Silicon Valley. Selbst die netzpolitische Bewegung bewegte sich oft im Rahmen der Kalifornischen Ideologie.
Ihr zufolge entstehen digitale Innovationen spontan, idealerweise in einer Garage. Herausragende Erfinderunternehmern treiben sie voran. Ihre Programme steigern die Produktivität enorm, aber sie lassen sich nicht planen, und der Staat soll sich um Himmels Willen aus diesem Bereich heraushalten. Neue Technik löst gesellschaftliche Probleme.
Auf dieser Grundlage lässt sich die Privatisierung allerdings nicht zurückdrängen. Alternativen zu Twitter und Google sind nur möglich, wenn die notwendige Arbeit organisiert und finanziert wird (wobei das Verhältnis zwischen bezahlter Lohnarbeit und unbezahlter Freiwilligenarbeit sicher unterschiedlich gewählt werden kann). Sie werden nicht spontan aus der Community entstehen. Ein brisantes Beispiel ist die Frage der Inhaltskontrolle.
Noch jede Gesellschaft hat die öffentliche Rede reglementiert. Die Auseinandersetzungen darüber, was gesagt werden darf und was nicht, gehört selbst zum politischen und kulturellen Prozess.
Die pauschale Ablehnung jeder Zensur umgeht, einigermaßen denkfaul, die entscheidende politische Frage: Welche Art von Plattformen nutzt einer demokratischen Öffentlichkeit und einer freiheitlichen Gesellschaft? Wie kann Selbstorganisation möglich werden? Innerhalb einer individualistische Auffassung von Gesellschaft, die sich aus Internet-Monaden zusammensetzt, ergibt die Frage freilich keinen Sinn.
Die Lösung
Die Lösung heißt Vergesellschaftung. Die digitale Infrastruktur muss zu einem öffentlichen Dienst werden, kommerziellen Interessen entzogen werden.
Zu diesem Zweck müssen Software und Hardware in öffentliches Eigentum überführt werden (inklusive des sogenannten geistigen Eigentums, mit dem die Plattformen verhindern, dass andere ihre Verfahren und Programme benutzen).
Auf diesem Weg lässt sich ein beachtlicher Teil des Datenhandels austrocknen, einfach weil vergesellschaftete öffentlich finanzierte Plattformen keine Daten sammeln müssen, um sie über personalisierte Werbung zu monetarisieren.
Die Vergesellschaftung von Twitter, Whatsapp, Google und den anderen Plattformen dient aber nicht nur dem individuellen (Daten-)Schutzbedürfnis, sondern dem freiheitlichen und demokratischen Diskurs. Um nur ein Beispiel zu nennen, sie ermöglicht transparente Empfehlungsalgorithmen, die Nutzer nicht in die erwünschte Richtung schubsen und ihre Verweildauer maximieren.
Die notwendigen Aufwendungen, um sie zu programmieren und zu betreiben, sind finanzierbar, das Know-how ist vorhanden. Dann können Plattformen gute Arbeitsverhältnisse für alle bieten, ohne die absurden Gehaltsunterschiede wie bei den privaten Konzernen, wo ein Vorstandsvorsitzender Millionen einstreicht und Content-Moderatoren ganz knapp über dem Mindestlohn bezahlt werden.
Wenn sie und die anderen Plattform-Beschäftigten sich die Forderung nach Vergesellschaftung zu eigen machen, kann diese noch ziemlich abstrakte Idee konkret und wirksam werden.
Vergesellschaftung bedeutet nicht Verstaatlichung
Es ist wahr: Wenn Regierung oder staatlichen Stellen Zugriff auf die digitale Infrastrukturen bekommen, erhalten sie erschreckende Möglichkeiten für Manipulation und Überwachung. Andererseits verhindert das bisherige Privateigentum an den Plattformen sie nicht (nicht einmal im chinesischen Überwachungsstaat: auch Weibo oder Wechat gehören börsennotierten Unternehmen).
Vergesellschaftete Infrastrukturen müssen wirklich staatsfern sein. Auch der etwas subtilerer Einfluss auf Einstellungen oder Finanzierung muss verhindert werden. Das geht, wenn Räte der Beschäftigten und der Nutzer (also: der ganzen Bevölkerung) bei allen technischen und inhaltlichen Fragen mitbestimmen.
Nach vier Jahrzehnten Neoliberalismus mutet die Forderung nach Vergesellschaftung utopisch oder naiv an. Gerade die Digitaltechnik und das Internet waren Sinnbilder für privatwirtschaftliche Initiative, Innovation und Effizienz. In Wirklichkeit wurden die Grundlagen der Digitalisierung von staatlichen Stellen entwickelt und finanziert und dann maßgeblich von Bastlern aus Eigeninitiative weiterentwickelt.
Öffentliche Dienste jeder Art wurden seit den 1980er-Jahren immer schlechter ausgestattet, während die Internetunternehmen von den Finanzmärkten mit Geld überhäuft wurden. So konnten sie ihre Dienstleistungen scheinbar kostenlos anbieten und potenzielle Konkurrenten aufkaufen.
Diese Phase kommt nun an ihr Ende. Allerdings können konkurrenzfähige öffentliche Plattformen nicht von idealistischen Programmierern nach Feierabend betrieben werden. Nötig sind qualifizierte Arbeitskräfte, langfristige Stellen und massive Investitionen für ein Gemeingut, das gleichzeitig dem privaten Kapital Einkünfte entziehen würde. Dass so etwas politisch durchgesetzt werden kann – das ist im eigentlichen und guten Sinn utopisch.