5 aus 9: Wenn die Diagnose krankmacht
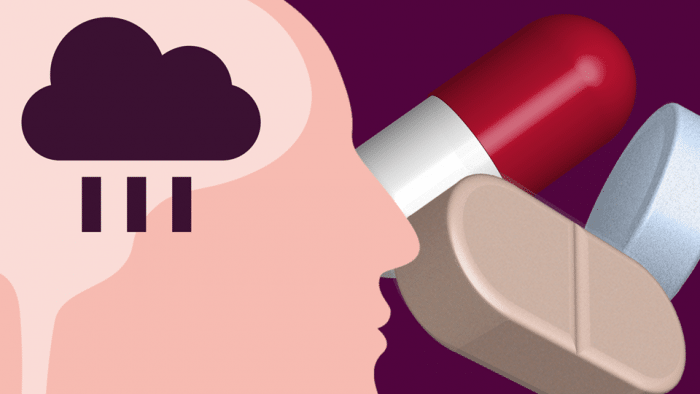
Warum wir den Mut brauchen, psychische Erkrankungen wieder in ihrem gesellschaftlichen Gesamtkontext zu sehen
Depressionen werden mitunter als Volkskrankheit bezeichnet. Nach den weitverbreiteten Richtlinien der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung kann beim Vorliegen von mindestens fünf Symptomen über einen längeren Zeitraum die Diagnose erfolgen. Doch was macht so eine Diagnose mit den Menschen? Warum Psychologie und Psychiatrie mehr sein sollte als nur Checklisten abzuhaken, erklärt die Psychologiestudentin Nina Frohn im folgenden Artikel. Der Essay war zudem die beste Einreichung bei einem Schreibwettbewerb in meiner Wissenschaftstheorie-Vorlesung im Jahr 2019. Mit Empfehlungen von Stephan Schleim.
Risiken schaffen Reflektionsbedarf
In der heutigen Zeit von einem Facharzt oder Psychologen die Diagnose "Depression" ausgestellt zu bekommen, hat nicht mehr viel mit dem gemein, was lange Zeit im freudianischen Zeitalter praktiziert wurde. Nur noch vereinzelt wird der Patient gebeten, sich auf eine Couch zu legen und seine Lebensgeschichte, vorzugsweise mit den frühesten Kindheitserinnerungen, Revue passieren zu lassen.
Heutzutage wird eingeschätzt, ob der Patient eine bestimmte Anzahl an Symptomen erfüllt, welche im international genutzten DSM-5 (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) aufgeführt werden. Ist diese Mindestanzahl, nämlich fünf aus neun, erfüllt und verursachen diese Symptome dazu einen Leidensdruck beim Betroffenen (und/oder schränken den Betroffenen in seinem Leben deutlich ein), so gilt der Patient als depressiv.
Auch wenn Phasen psychischen Ungleichgewichts glücklicherweise in ihrer Mehrheit nicht in Suizid enden, so prägen wir das Leben von Millionen von Menschen mit gegenwärtigen Diagnoseverfahren. Die Art und Weise, wie wir Diagnostik betreiben hat immense Auswirkungen auf das Selbstverständnis unserer Gesellschaft und dem Gelingen von Interventionen. Sie ist maßgeblich entscheidend dafür, ob Menschen sich unterstützt oder missverstanden fühlen, ob sie sich selbst als chronisch krank oder handlungsfähig begreifen.
Daher lohnen sich kritische Blicke auf unser Diagnosesystem gleich doppelt und es muss gefragt werden: Was ist, wenn die gegenwärtige Art mentale Krankheiten zu diagnostizieren die Beschwerden nicht immer lindert, sondern sie teilweise erst hervorruft und sogar verschlimmern kann?
Die Subjektivität der Diagnose "Depression"
Vielleicht waren es die Zweifel an der traditionellen Psychoanalyse, sowie die harsche Kritik an seinen Vertretern, welche den Weg ebneten für ein Kontrastprogramm, welches heute in der gängigen Praxis gelebt wird. Allgemein gesehen sind klinische Diagnosen durchaus sinnvoll, sie erleichtern die Kommunikation zwischen Fachleuten und können helfen, Betroffenen einen Bedeutungsrahmen für das eigene Leiden zu geben. Diese Diagnosen sollten sich allerdings für die Betroffenen nicht nach einer Klassifizierung anfühlen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass das theoretische Fundament der Depression nach wie vor auf wackligen Füßen steht.
Unter den fünf, für das Ausstellen einer Depression erforderlichen Symptomen, muss gemäß DSM-5 zwingend eines der beiden Hauptsymptome auftauchen: Depressive Stimmung oder Verlust von Interesse und Freude.1 Ist dies nicht der Fall, so ist es der Definition nach auch keine Depression. Für die Diagnose ist dabei die Ursache der Symptome unerheblich, es kommt lediglich auf ihre Präsenz oder Abwesenheit an. Dies macht es auch nebensächlich, ob die Symptome inmitten einer schweren Lebenskrise auftreten oder ohne äußeren, erkennbaren Grund. In beiden Fällen gilt die Person als depressiv erkrankt, diagnostiziert mit einer psychischen Störung.
Bis auf das zwingende Vorhandensein einer der beiden Hauptsymptome ist es für die Diagnose ebenfalls unbedeutend, welche der übrigen sieben Symptome auftreten, solange es eben insgesamt fünf sind. So könnten zwei Menschen mit ein- und derselben Krankheit diagnostiziert werden, obwohl sie eventuell nur ein einziges, gemeinsames Symptom teilen.2 Dabei sei gesagt, dass die symptombasierte Definition einer Depression nicht mit dem übereinstimmen muss, was eine Depression wirklich ist. Sie ist das übereingekommene Verständnis von Fachleuten, wie sich der Krankheitszustand einer Depression nach außen hin, also durch die sichtbaren Symptome, manifestiert.
Die Definitionskriterien einer Depression verhalten sich dabei nicht genauso wie andere medizinische Diagnosen. So können wir uns bei der Diagnose eines Beinbruchs ziemlich sicher sein, dass ein Beinbruch wirklich genau das ist, nämlich der Bruch eines Knochens im Bein. Die Depression ist gegenwärtig allerdings das, wozu die Entscheider einer solchen Symptomliste sie gemacht haben. Dies macht sie nicht willkürlich, jedoch zu einem gewissen Grad subjektiv.
Das DSM-5 beruft sich bei der Erstellung einer solchen Symptomliste auf quantitative Daten sowie auf Experteneinschätzungen. Dies bedeutet aber auch: Wären andere Daten zu Rate gezogen worden oder hätten andere Experten beim DSM-5 beratend mitgewirkt, so hätten wir heute mit großer Wahrscheinlichkeit eine andere Definition der Depression. Dies würde dazu führen, dass manche Menschen, die nach heutigem Standard als psychisch gestört gelten, unter anderen Voraussetzungen als gesund eingestuft werden würden.
Zur eigentlichen Substanz der Depression, sowie auch anderer mentaler Krankheiten, gibt es derweil noch immer Debatten zwischen Wissenschaftlern.3 Es ist keinesfalls abschließend erwiesen, was die Depression im eigentlichen Sinne ist und woher sie kommt. Um diesen wissenschaftlichen Unsicherheiten Rechnung zu tragen, darf und muss unser Diagnosesystem fortwährend hinterfragt werden.
Dies macht die derzeitige Symptomauflistung zu einer aktuellen Interpretation der Depression, die keinen absoluten Wahrheitsgehalt im objektiven Sinn besitzt. Dies war natürlich zu Zeiten der frühen Psychoanalyse nicht anders. Das Erklärungsmodell, welches Sigmund Freud und seine Nachfolger erschaffen haben, war die Linse, durch die jede Regung der menschlichen Psyche bewertet wurde. Da sie wissenschaftlich nicht überprüfbar war, da es schlicht nichts gab, was sie widerlegen konnte, blieben Freuds Theorien nicht falsifizierbar. Für das Credo der Wissenschaft, welche aus beobachtbaren und wiederholbaren Fakten neues Wissen gewinnt, war dies nicht tragbar.
Die psychologische Wissenschaft bemühte sich fortan vor allem um Überprüfbarkeit und Transparenz, was sich auch in derzeitigen Trends zur Neurowissenschaft widerspiegelt. In dieser Manier passt das ausschließlich symptombasierte Diagnoseschema gut ins Bild: Entweder Patient A zeigt fünf Symptome und gilt als depressiv, oder eben nur vier und schlittert knapp daran vorbei. Dies ermöglicht eine klarere Trennlinie, welche es auch den Krankenkassen erleichtert, Therapiebedürftigkeiten einzuschätzen und Kassenleistungen zu genehmigen. Abgesehen von der berechtigten Frage zur Medikalisierung normaler, menschlicher Geisteszustände, stoßen wir bei diesem Verfahren auf mindestens zwei Probleme.
Das erste Problem: Interaktionen zwischen Diagnose und Patient
Bei all der Gradlinigkeit und Transparenz, welche die Diagnostik zu bieten hat, drängt sich die Frage auf, warum sich überhaupt etwas ändern sollte. Mentale Krankheiten schließlich gar nicht ernst zu nehmen oder schlimmer noch, Patienten wie Simulanten zu behandeln, ist schlicht nicht tolerierbar und keine Option des 21. Jahrhunderts.
In dieser Hinsicht sind eindeutige Diagnosen und Anerkennung für die Depression als ernste Krankheit wünschenswert. Doch bei genauerem Hinsehen erscheint die Praktik, Patienten beim Erfüllen von fünf Kriterien, die die verschiedensten Ursachen haben könnten, eine ernste mentale Störung zu bescheinigen, als würde der Komplexität der menschlichen Psyche nicht wirklich Rechnung getragen.
Das erste Problem, auf das wir hierbei stoßen ist, dass Diagnosen starke Folgen für die Betroffenen haben können. Sie verändern oftmals sowohl die Wahrnehmung nach außen als auch nach innen, denn wir stehen ständig in Wechselwirkung mit unserer Außenwelt. Ein Mensch, der die Diagnose depressiv erhält, wird von der Außenwelt oft anders behandelt als jemand, der offiziell als gesund gilt.
Angefangen bei den offensichtlicheren Formen des veränderten Umgangs wie zum Beispiel Stigmatisierung, sozialer Ausgrenzung und Mobbing, reichen oftmals schon subtile Veränderungen aus, um das Selbstbild des Betroffenen nachhaltig zu beeinflussen.
Dies kann die Familie sein, welche in der Gegenwart des Betroffenen keine potenziell schwierigen Themen mehr anspricht, aus Sorge, es könnte die Person überfordern, oder aber Kollegen und Vorgesetzte, die dem Betroffenen Verantwortungsbereiche entziehen, um zur Entlastung beizutragen. Auch das generelle Bild, welches in unserer Gesellschaft beim Gedanken an psychisch kranke Menschen nach wie vor verankert ist, sie also tendenziell als schwach, handlungsunfähig und labil wahrzunehmen, kann sich schnell auf den Betroffenen übertragen.
Ian Hacking beschrieb dieses Phänomen bereits 2005 in seinem Artikel "Kinds of People: Moving Targets". Er diskutierte, wie Krankheitsbegriffe und Diagnosen mit den Menschen interagieren, die mit ihnen versehen werden. Er warf die Frage auf, ob es eine bestimmte Art gibt, jemand zu sein, bevor es die Diagnose gibt, welche genau diese Art, jemand zu sein, vorschreibt. Wenngleich etwas kryptisch ausgedrückt, kann dies in etwa übersetzt werden zu: Es gab keine depressiven Menschen, bevor es die Diagnose "Depression" gab.
Wenngleich diese These gewagt wäre, angesichts einer langen Vorgeschichte chronischer Niedergeschlagenheit, lange auch vor der heutigen DSM-5 Definition, regt sie doch zum Nachdenken an. Auch wenn es den Zustand der Depression, der Melancholie oder auch der chronischen Niedergeschlagenheit schon seit jeher gab und vermutlich auch geben wird, erschaffen wir mit einer neuen Definition auch eine neue Realität. Wäre es möglich, dass das Diagnostizieren dazu beiträgt, dass der Betroffene sich selbst im Sinne der Diagnose zu interpretieren lernt, aus ihr heraus handelt und sich gegebenenfalls auch durch sie begrenzen lässt?
Falls ja, würde dies einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung gleichkommen. Diese ist eine Vorhersage, welche ihre Erfüllung selbst bewirkt.4 Das bedeutet, dass wir der Depression selbst erst Leben einhauchen, gerade weil wir sie diagnostizieren.
Nun könnte man mit Recht argumentieren, dass Patienten im Regelfall nur dann einen Psychologen oder Arzt aufsuchen, wenn sie bereits seit Längerem unter bestimmten Symptomen leiden und dies der offiziellen Diagnose vorausgeht. Dem ist nichts entgegenzusetzen, denn wie bereits erwähnt ziehen sich Symptome und Beschwerden, die der heutigen Definition der Depression ähneln, seit jeher durch unsere Menschheitsgeschichte.
Der Punkt, der hier zum Nachdenken anregen soll, ist, dass eine leichtfertige Überschussdiagnostik dazu führen kann, dass Betroffene anfangen sich in demselben Licht wahrzunehmen, wie es die medizinische Diagnostik impliziert. Aus der Perspektive unserer gegenwärtigen Gesellschaft bedeutet dies, sich selbst als krank und behandlungsbedürftig anzusehen, angewiesen auf eine Psychotherapie und in vielen Fällen auch auf Psychopharmaka.
Dies schafft eine Reihe von Menschen, die mit einem Etikett versehen werden, um den Schein von Objektivität und Eindeutigkeit in der psychologischen Diagnostik zu wahren. Die Konsequenzen für die Selbst- und Fremdwahrnehmung werden dabei unterschätzt.
Eine wichtige Antithese
Was ist aber mit der Erleichterung, eine handfeste Diagnose für sein Leiden zu erhalten? Immerhin sorgt sie dafür, dass der Betroffene sein bis dato noch undefinierbares Leiden einem klar definierten Krankheitsbild zuschreiben kann. Die Tatsache, dass es für die eigenen Symptome einen Namen gibt, ein statistisches Diagnosehandbuch, ja auch Behandlungsmethoden, dürfte in vielen Fällen zur Beruhigung beitragen.
Auch kann es sein, dass sich der Einzelne eben nicht mehr schuldig oder verantwortlich für seine Symptome fühlt. Genauso wenig wie man einem Patienten mit Beinbruch vorwerfen kann, keinen Marathon mehr zu laufen, kann man einem Depressiven nicht zur Last legen, dass er in letzter Zeit so energielos daherkommt.
Es soll mit diesem Essay nicht die Meinung vertreten werden, dass ab jetzt in der Psychologie keine Diagnosen mehr ausgestellt werden sollten. Wie beschrieben kann die Diagnose oftmals helfen, dem Patienten einen Bedeutungsrahmen für sein Leiden zu liefern. Auch Angehörige und Arbeitgeber dürften es leichter haben, das Verhalten des Betroffenen durch eine ärztliche Diagnose besser einzuordnen.
Aus dieser Perspektive lockert sich die Verantwortlichkeit für die eigene Krankheit und schützt den Betroffenen möglicherweise vor Aussagen wie: "Nun stell dich doch nicht so an und sei nicht immer so verdammt niedergeschlagen!" Diese Vorteile müssen abgewogen werden mit dem Risiko, Menschen, die vorübergehend eine Kombination aus Symptomen aufweisen den Stempel des depressiv Erkrankten aufzudrücken. Neben den Befürchtungen, dass diese Praxis sich negativ auf das Selbstverständnis der Betroffenen auswirkt, stoßen wir auch noch auf ein zweites Problem.
Das zweite Problem: Gesellschaftliche Sackgassen geraten aus dem Fokus
Der zweite Knackpunkt symptombasierter Diagnosen ist, dass sie die Krankheit ausschließlich im Individuum selbst verankern. Dies bedeutet, dass durch die Diagnose der Depression nicht immer die Verantwortung vom Betroffenen genommen wird, wie oben beschrieben, sondern sie sich auf gewisse Weise eben erst auf ihn verlagert.
Kritik an äußeren Lebensumständen, Gesellschaftspraktiken und kulturellen Entwicklungen haben nämlich keinen Platz in der Diagnostik. Eine Diagnose kann Erleichterung und Akzeptanz schaffen. Genauso jedoch kann sie blind machen für krankmachende Faktoren der Gesellschaft, die einer dringenden Änderung bedürfen.
Dies schlägt sich gegenwärtig nieder in einer Entkontextualisierung der Depression. Die Verantwortung für das, was die Diagnose hervorruft und aufrechterhält, wird voll und ganz im Individuum lokalisiert, denn äußere Umstände finden keine Berücksichtigung. Dies ist allerdings ein Unrecht, denn Symptome treten selten im luftleeren Raum auf, häufig gibt es Auslöser.
Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür ist die Unterdrückung der Frau, welche lange Zeit ihren Platz im Haushalt zugeschrieben bekam, anstatt ihn sich selbst auszusuchen. Zu jener Zeit erkrankten viele Frauen an einer Depression im Sinne der Symptome des heutigen DSM-5. Das heißt, sie schliefen zu viel oder aber zu wenig, fühlten sich wertlos oder verspürten keine Freude mehr.
Würde man nun diese Symptome so isoliert betrachten, wie wir es in der heutigen Praxis tun, so könnte man sich die Frage stellen, was denn, zum Teufel, mit diesen Frauen im Alter von 20 bis 60 nicht stimmt. Ganz im Trend der wachsenden Neuroforschung würde man vielleicht sogar erst einmal bestimmte Fehlschaltungen im Gehirn vermuten, bevor man sich die Mühe machte, sich das Leben dieser Frauen einmal genauer anzuschauen: Sinnentleerte Tätigkeiten bestimmten ihren Alltag, sie konnten ihre Talente, Neigungen und Fertigkeiten weder einsetzen, noch erfuhren sie Anerkennung für ihr tägliches Leben.
Heute, im Rückblick, hielte es wohl niemand für eine gute Idee, diesen Frauen eine psychische Störung zu diagnostizieren. Aus heutiger Sicht auf damalige Verhältnisse ist wohl allen klar, dass die Umstände an den Pranger gestellt werden müssen, nicht die Frauen selbst. Es wäre fatal, wenn jene Hausfrauen sich still und leise mit der Krankheit Depression identifiziert hätten, anstatt für bessere Lebensbedingungen auf die Straße zu gehen.
Doch so wie uns dies aus heutiger Sicht glasklar erscheint, laufen wir Gefahr, wieder in die gleiche Falle zu tappen. Nur weil es für uns heute Normalität ist, 24 Stunden am Tag erreichbar zu sein und sich mit Konsum besser auszukennen als mit zwischenmenschlichem Mitgefühl, so ist dies noch lange kein gesunder Lebensstil. Im Rückblick sind wir immer schlauer, wir verurteilen damalige Zeiten für ihre unhaltbaren Zustände, doch leben selber Tag für Tag in einer Welt, wo zukünftige Generationen (sollten es diese schaffen, unseren Planeten noch zu bewohnen) den Kopf schütteln werden.
Anstatt Symptome auf einer Checkliste abzuhaken und dem Betroffenen das Gefühl zu geben, er wäre im objektiven Sinne krank, muss es wieder ein gesundes Verständnis dafür geben, wie der menschliche Organismus mit seiner Außenwelt interagiert. Anstatt in der neurologischen Forschung für Milliardensummen nach Biomarkern und verirrten Schaltkreisen im Gehirn zu suchen, die vermutlich auch weiter auf sich warten lassen werden, könnte man kurzfristig die Baustellen anpacken, die ziemlich sicher den Ausbruch einer Depression begünstigen. Ein guter Anfang wäre es, Faktoren im unmittelbaren Umfeld des Patienten bei einer möglichen Diagnostik zu berücksichtigen, bevor er pathologisiert wird.
Ein Plädoyer für mehr Gesellschaftskritik und Zurückhaltung in der Diagnostik
Diese Kritikpunkte sollen nicht vermitteln, dass in einer anschließenden Therapie die krankmachenden, persönlichen oder gesellschaftlichen Aspekte nicht zum Thema gemacht werden können. Auch kann der potenzielle Opfermodus des psychisch Erkrankten in der Therapie oftmals erfolgreich aufgelöst werden.
Wir gehen mit der symptombasierten Diagnostik davon aus, dass bestimmte Verhaltensweisen und Gefühle Ausdruck der darunterliegenden Krankheit, der Depression, sind. Was ist aber, wenn z.B. Antriebs- und Mutlosigkeit daher stammen, dass sich das eigene Leben durch sinnentfremdete Tätigkeiten leer und unerfüllend anfühlt? Dies mag dann zwar nach dem Dafürhalten von Experten eine Depression sein, sie wäre jedoch einer Ursache zuzuordnen. Diese Ursache gezielt aufzulösen und damit nicht jahrelang auf Psychopharmaka mit Nebenwirkungen angewiesen zu sein, erscheint da als die bessere Alternative.
Anstatt sich von Jahr zu Jahr über die steigende Anzahl depressiver Menschen zu wundern, wäre es angebrachter die Gesellschaft zu überprüfen, die diesen Anstieg hervorbrachte. Nachdem über Jahre dafür gekämpft wurde, psychische Krankheiten ernster zu nehmen, ist es nun unsere Aufgabe genau hinzuschauen, wie, wann und warum wir mentale Dysfunktionen bescheinigen.
Auf dem Spiel steht das Risiko, die Selbstwahrnehmung des Betroffenen auf den "kranken Menschen" zu reduzieren, wenn ein krankes System der eigentliche Auslöser ist. Dies soll die Echtheit einer Depression in keinster Weise in Frage stellen. Sie ist echt, genauso wie ein Beinbruch, denn die Betroffenen verspüren offensichtlich einen Leidensdruck, der bis zur Selbsttötung reichen kann.
Die Definitionskriterien hingegen, welche die Depression abbilden sollen, haben keine Echtheit im gleichen Sinn. Sie veränderten sich stetig, während das darunterliegende Krankheitsbild weitestgehend stabil blieb. Eine Praxis, welche die Präsenz dieser Kriterien zum einzigen Messinstrument einer gesellschaftlich mitbedingten Krankheit macht, verliert den Fokus aus den Augen.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es vermutlich weit weniger Diagnosen, Kosten für Therapien und Leid geben würde, wäre unsere Welt für jeden ein Ort persönlicher Entfaltung, Freiheit und Sinnhaftigkeit. Umgekehrt stellt sich die Frage, wie man in Zeiten des Social-Media-Wahns, Höher-schneller-weiter-Mentalitäten und den Konsequenzen des Kapitalismus nicht früher oder später mindestens ein, zwei oder eben fünf der notwendigen Symptome einer Depression aufweisen soll.
Nur weil es wie eine Utopie scheint, dass eine Gesellschaft ausschließlich aus erfüllten und glücklichen Menschen besteht, darf dies nicht zu ziviler Untätigkeit führen. Es ist unsere Pflicht, die nicht zuletzt unserer eigenen Gesundheit zugutekommt, Missstände aufzudecken und kulturelle Entwicklungen immer und immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. So könnte aus einer geplagten Gesellschaft eines Tages eine Gemeinschaft werden, die die Depression nicht als salonfähigen Dauerzustand akzeptiert. Denn wir alle haben ein gutes Leben verdient.
Nina Frohn studiert Psychologie im Abschlussjahr an der niederländischen Universität in Groningen. Ihre Interessen fokussieren sich vor allem auf persönliche Weiterentwicklung, theoretisch-philosophische Fragen zu mentalen Krankheiten, sowie Schlüsselelemente der Psychotherapie. Nina Frohn plant für ihre Zukunft, sowohl selbst als Therapeutin tätig zu werden, als auch zeitgleich an einer Universität oder Hochschule zu lehren und zu forschen.
Dieser Artikel erscheint ebenfalls im Blog "Menschen-Bilder" von Stephan Schleim.
