Das sprachlich Infame: ein Sieg des Vulgären
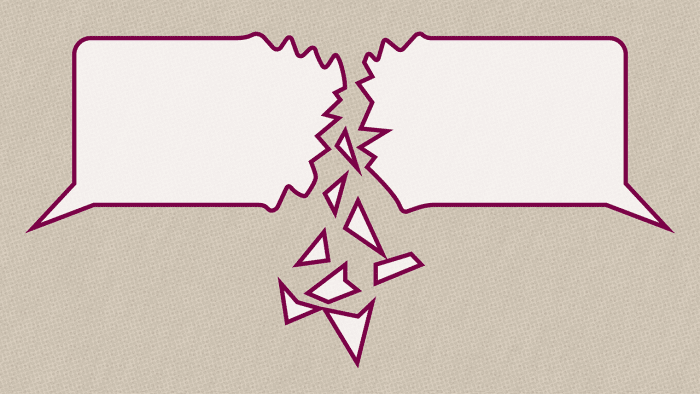
Wenn Dialoge zerbrechen und Widerspruch über die Hassrede zur Pöbelei abdriftet. Über Wirkung und unerwünschte Nebenwirkungen von Sprache
Miteinander sprechen ist nicht immer ein Dialog. Und nicht jeder Dialog bedarf auch der Worte. Gespräche sind zunächst Begegnungen. Ob daraus gegenseitiges Verstehen oder gar Verständnis resultiert, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Dass Kommunikation die Welt nicht mitteilt, sondern einteilt, nämlich in Gesagtes und in Unausgesprochenes, hat Niklas Luhmann in seinem gesellschaftstheoretischen Werk treffsicher formuliert.
Zwischen Mitgeteiltem und Verschwiegenem, zwischen Explizitem und Angedeutetem, fallweise Mitgemeintem, entfaltet sich der Dialograum: von mitreißenden Diskussionen bis zum Erliegen derselben.
Es ist kein Zufall, dass das Dialogisieren – dialégesthai und dialogísomai – seit der griechischen Antike allerhöchstes Ansehen genoss. Als Unterredung, als Begegnung auf Augenhöhe, wiewohl im "Begegnen" bereits das Widerfahren eines "Gegen" enthalten ist.
Doch aus welchen Elementen besteht ein Dialog in pandemischen Zeiten? Wer bestimmt den Diskurs? Etwa Virologen und Politiker? Hat, wer monologisiert, automatisch die Themenführerschaft? Es gibt Gesprächsteilnehmer, die weder zur Selbstkritik noch zur Selbstironie fähig sind, sondern sich im Vollbesitz der Wahrheit oder gar Glaubenswahrheit wähnen.
Wie Missionare ohne Einsicht schrammen diese oftmals am Fanatismus entlang. Immer wieder führen Dialoge jedoch auch zur Erkenntnis, dass Unterredungen trotz guter Absicht sinn- und zwecklos waren. Sprachwege, die aus der Ferne verheißungsvoll aussahen, erweisen sich beim Betreten als verbale Sackgassen.
Gesprächsabbruch: die "pöbelhafte Epoche"
Das derzeitige politische, gesellschaftliche und kulturelle Europa wirkt wie von einem Schleier der Feindseligkeit überzogen. Was, wenn das Phänomen des brüchig gewordenen Dialogs nicht bei Formen von aggressivem Ignorieren stehen bleibt?
Was, wenn auch der letzte Gesprächsfaden reißt? Wenn die Gesprächsverweigerung obsiegt und in weiterer Folge Hassreden und Pöbeleien den Diskurs belasten?
Gegenhaltungen zu allen Formen der Hassrede, die das Gespräch am Leben halten, wären ein möglicher Ausweg. Sie sind Handlungsweisen, Zielsetzungen und Einstellungen, die durch Ethik und Moral bestimmt sind, nicht bloß leerer Habitus.
Doch in Zeiten pandemischer Verdüsterung holt die Vulgarität zum vermeintlich letzten Schlag gegen das kulturelle Miteinander aus, indem sie die Entbehrlichkeit von Respekt sprachlich euphorisch lebt.
Denn erst, wenn die gegenseitige Anerkennung der jeweiligen Gesprächspartner vorliegt, wächst die Chance auf Einvernehmen, ohne deshalb gleich in Eintracht zu schwelgen.
Sobald Anerkennungsverhältnisse symmetrisch sind, kann vorbehaltsloses, behutsames und respektvolles Sprechen realisiert werden. Social Media sind zwar nicht die Ursache des Niedergangs von Sprachkultur, jedoch ein wirkungsvoller Brandbeschleuniger; und dies trotz ihrer ausdrücklich auf das Dialogische gerichteten Strukturen.
Sprachsiege der Vulgarität?
Nach nur zwei Jahren hat eine Pandemie abermals die gesellschaftlichen Extreme überaus deutlich und ungeschönt zutage gefördert.
In den pandemiegeschüttelten Industriestaaten zerbrechen mit zunehmender Geschwindigkeit viele der Schwachen, Benachteiligten und Marginalisierten. Gedanken des "es lohnt sich kaum mehr" nehmen überhand, das Phänomen der Erschöpfung ist mit freiem Auge sichtbar.
Mitten im digitalen Fortschreiten scheint die Gesellschaft zu resignieren. Diskussionen degenerieren zu Scheingefechten, bei denen die Vulgarität die sprachlichen Siege davonträgt. Im Kern der Shitstorms dominierten immer schon das Niedrige, das Pöbelhafte und Fanatische.
Doch in pandemischen Zeiten werden die Sprachwege von der Vereinfachung zum Vorurteil kürzer. Die Grenzen zwischen Angstbildern und Feindbildern verschwimmen und am "globalen Riesenstammtisch" herrscht allumfassender Verkürzungszwang statt differenzierter Debatte.
Das Aufrechterhalten von Missverständnissen und Feindbildern sowie das Schüren von Konflikten kann sprachlich geradezu bequem als Folgewirkung des pandemischen Ausnahmezustands maskiert werden.
Hinzu kommt der diffuse, wachsende Hass auf Forscher und (Natur-)Wissenschaftler im Allgemeinen sowie auf Medienvertreter, die mit politischen Entscheidungen in Verbindung gebracht werden.
Auch Stellvertreter-Aggressionen gegenüber gesellschaftlich Exponierten zählen dazu, wie die massiven Anfeindungen und Bedrohungen von Landes- und Kommunalpolitiker:innen zeigen. Populistische Sprachentgleisungen und Feindbildrhetorik mutieren rasant zur Normalsprache.
"Wokeness" als fragiles Gegenprogramm?
Seit Jahren entstehen gesellschaftliche und sprachliche Gegenpositionen, bei denen gleichfalls Anspruch und Wirklichkeit häufig auseinanderklaffen. Im Kampf um Toleranz und soziale Gerechtigkeit erschöpft sich die Wirkung der sogenannten Mikro-Aggressionen nicht mehr nur im Appell. Ihre geballte Macht beendet auch Karrieren Andersdenkender, Cancel-Culture inklusive.
Ähnlich verhält es sich bei der jüngst zu breiter Bekanntheit gelangten "Wokeness", einer Bezeichnung für gesteigerte Niveaus an Aufmerksamkeit, Wachsamkeit und Feinfühligkeit hinsichtlich sozialer Missstände und Diskriminierungstendenzen.
Trotz positiver Ausrichtung von "woke" dominiert mittlerweile das Appellative, die Gerichtetheit des Anspruchs an das jeweilige Gegenüber, dem "staywoke" abverlangt wird.
Am Wendepunkt
Hätte die Corona-Pandemie die Form einer klassischen griechischen Tragödie, käme es der aristotelischen Tragödientheorie zufolge nunmehr zur sogenannten "Peripetie".
Nach mehreren Episoden markiert die Peripetie eine Änderung des Handlungsverlaufes. Einen Umschwung, der entweder die Lösung des Problems einleitet, oder zur endgültigen Katastrophe führt.
Es bleibt zu hoffen, dass die derzeit ablaufenden Episoden und Prozesse bald ihre fatale Richtung ändern. Dass diese nicht mehr geradewegs auf die Verschärfung des Diskurses, das Aufbrechen der fragilen Cleavages, jener sensiblen Bruchlinien in der Gesellschaft, bis hin zur Spaltung derselben zusteuern. "Covid-19": die pandemische Jahrgangsbezeichnung weist darauf hin, dass bereits zwei Jahre vergangen sind.
In Zeiten der Krise, in der rasches Reagieren, Planen und Handeln Pflichtsache ist, eine besorgniserregend lange Zeitspanne.
Paul Sailer-Wlasits ist Sprachphilosoph und Politikwissenschaftler in Wien. Er ist Autor von "Minimale Moral" (2016) und "Uneigentlichkeit. Philosophische Besichtigungen zwischen Metapher, Zeugenschaft und Wahrsprechen" (2020) sowie zuletzt: "Verbalradikalismus. Kritische Geistesgeschichte eines soziopolitisch-sprachphilosophischen Phänomens" (2021, 2. Aufl.).
