"Die Linke hat jede Orientierung verloren"
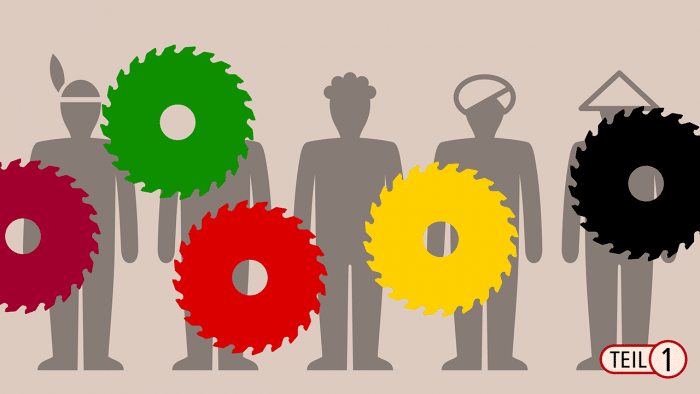
- "Die Linke hat jede Orientierung verloren"
- "Okzidentales Herrschaftsmodell, das zur Ruinierung des Planeten geführt hat"
- "Problematisch wird es, wenn man das Ergebnis zu einer Naturalisierung macht"
- Auf einer Seite lesen
Identitätspolitik, dogmatische Etikettierungen, Rassismus, rationales Denken und Offenheit - wie sieht der Einsatzort für eine Linke in düsteren Zeiten aus? Interview Bernhard Schindlbeck. (Teil 1)
Stets galt die Identitätspolitik als ein "linkes Projekt", das mit der Hoffnung auf Beseitigung von Diskriminierung und einer Ausweitung an Freiheit verbunden war. Gegenwärtig allerdings weht ihr ein scharfer Gegenwind entgegen.
Über alle Parteigrenzen hinweg ist eine Front der Ablehnung entstanden. Allen voran natürlich die Rechten, die in der Gleichstellung der Schwulen und Lesben oder gar der kulturellen Identität der Muslime den Untergang des Abendlandes befürchten.
Aber auch die Liberalen haben sich eingereiht. Sie sehen den demokratischen Konsens im Sinkflug begriffen, wenn durch die Zunahme partikularer Interessen "Parallelgesellschaften" entstehen.
Zuletzt sind auch noch viele Linke dazu gestoßen, die in der ausufernden Identitätspolitik immer kleinerer Gruppen den Einfluss eines neoliberalen Individualismus wittern, der die Einheit und Geschlossenheit der sozialen Bewegung befürchten.
In seiner neuesten Ausgabe hat sich der Widerspruch – Münchner Zeitschrift für Philosophie diesem Thema gewidmet. Telepolis sprach mit dem Redakteur Bernhard Schindlbeck.
Herr Schindlbeck, warum ist Identitätspolitik heutzutage so en vogue?
Bernhard Schindlbeck: Der Hintergrund ist vermutlich der desolate, hoffnungslose Zustand aller Gesellschaften und die traurige Performanz des politischen Personals in aller Welt, egal ob eher demokratisch oder autokratisch.
Die neoliberal kujonierte Demokratie kann nicht halten, was sie verspricht und zu sein vorgibt. Freiheit ist eine von Geld abhängige Variable, Menschenrechte sind ein bloßes Aushängeschild und werden so gut wie nur noch als rhetorische Waffe gegen andere, als feindlich wahrgenommene Regierungen (China, Russland, Iran etc.) missbraucht, während man selber Flüchtlinge bereitwillig im Mittelmeer ertrinken oder in Lagern in Griechenland, der Türkei oder Libyen vegetieren lässt.
Dass alle Regierungen der EU auf ihren Territorien der CIA Foltergefängnisse genehmigten, ist schon wieder vergessen. Die "freie" Marktwirtschaft, die in jedem menschlichen Bedürfnis nur eines sieht, nämlich Profitmöglichkeiten, ist längst totalitär geworden, ihr Gott ist – wie schon Georg Simmel prognostizierte – das Geld. Hauptsache die Wachstumsmaschine läuft, und wie es den Menschen dabei geht, ist den Eliten egal, solange nicht allzu viel Devianz aufkommt und die Loyalität nicht unter ein kritisches Niveau sinkt.
Es werden aber immer mehr Menschen sozioökonomisch abgehängt; in der gnadenlosen Konkurrenzgesellschaft mit ausgeprägter Statushierarchie – und im Status wird bekanntlich die Anerkennung durch den generalisierten Anderen erhofft – hat der drohende Abstieg das Aufstiegsversprechen längt abgelöst. Die "gesetzgeberische Temperierung des Gegensatzes von arm und reich" (Arnold Gehlen) gelingt nicht mehr.
Gleichzeitig hat die Linke jede Orientierung verloren; Sozialdemokratie und Grüne (die früher noch manchmal zur Linken gezählt wurden) haben sich im Neoliberalismus bequem eingerichtet; so etwas wie eine "revolutionäre" Erwartung oder auch nur Hoffnung, geschweige denn ein Potential gibt es nicht mehr.
Das Proletariat hat in Teilen zum Kleinbürgertum aufgeschlossen und mehr zu verlieren als seine Ketten, oder es ist zum Prekariat gemacht geworden. Solange es den "real existierenden Sozialismus" als bloße systemalternative Möglichkeit gab, war der Kapitalismus zu einer gewissen Sozialstaatlichkeit genötigt.
Die wurde stark reduziert, nachdem der Kommunismus kollabierte. Der "Klassenkampf" ist zum Eintreten für etwas höhere Hartz-IV-Sätze und bezahlbaren Wohnraum geschrumpft. Die Hoffnung auf eine echte Veränderung, die diesen Namen verdient und die auch Voraussetzung für eine wirksame Klimapolitik wäre, ist verdunstet.
Dass die Zukunft mehr als düster aussieht, versteht jedes Schulkind. Somit weiß die Linke auch gar nicht mehr, weshalb sie auf der richtigen Seite steht, und wo diese ist. Theoretisch hat sie sich in orthodoxen Sackgassen verlaufen.
Der ersatzreligiöse, messianische Glaube an eine Gesetzmäßigkeit der Geschichte ("auf zum letzten Gefecht") und der gesellschaftlichen Entwicklung (wie mit Hegel und Marx für Lenin, Georg Lukács und vielleicht Domenico Losurdo noch möglich) als Begründung für politisches Engagement ist verlorengegangen.
"Basale Dialektik von Besonderheit und Allgemeinheit"
Und hier ist wohl der Einsatzort für die postmoderne Linke?
Bernhard Schindlbeck: Exakt. Es ist also nicht verwunderlich, dass viele Jüngere sich mit interessierter Neugier postmodernen Denkansätzen und der Dekonstruktion zuwandten, die auch linke ideologisch-dogmatische Verkrustungen in den Blick nahmen, und den Leuten die "Sorge um sich" und ihre unmittelbaren Anliegen (wozu auch personale Identität zählt) wichtig wurden.
Dass das partikularistisch, quasi nur nackter Egoismus sei, narzisstischen Kränkungen entspringe und deshalb auf Kosten von Solidarität und universellen Werten gehe, ist ein logischer Kurzschluss.
Wenn James Baldwin für seine Emanzipation als Schwarzer und Schwuler eintritt, heißt das ja nicht automatisch, dass ihm ausgebeutete weiße Arbeiterinnen egal sein müssen. Dass die früher gängige Beleidigung "Du schwule Sau" auf Schulhöfen heute nicht mehr zu hören ist, darf man als – wenn auch noch so kleinen – Fortschritt betrachten.
Und dass auch andere Gruppen ähnliche Fortschritte für sich verbuchen möchten, ist doch verständlich. Wenn man Identitätspolitik und Universalismus plump einander entgegenstellt, ist das ein allzu simplifizierender, falscher Antagonismus, der die basale Dialektik von Besonderheit und Allgemeinheit ignoriert. Schon Kinder entdecken, dass jeder Mensch etwas Besonderes ist und dass es also gar nichts Besonderes ist, etwas Besonderes zu sein. (Manche finden das später in ihrer Hegel-Lektüre wieder.)
Dass Identität nicht ohne Andersheit gedacht werden kann, hat Platon schon in seinem Sophistes erläutert. "Ich ist ein anderer", sagte Rimbaud, und Julia Kristeva: "Fremde sind wir uns selbst". Würde man sich auf diesen Gedanken endlich einlassen, wäre das Geschrei um Identitätspolitik nicht halb so laut.
"Die Linke operiert immer gerne mit Etiketten"
Mir scheint, als könne man im identitätspolitischen Diskurs eine ad-hominem-Struktur ausmachen, nach der nicht mehr wichtig ist, was, sondern von wem etwas vertreten wird. Stimmen Sie dem bei?
Bernhard Schindlbeck: Das mag sein. Mir fehlt jedoch ein hinreichender Überblick über diesen Diskurs, der aber alles andere als eine sinnvolle und reflektierte Auseinandersetzung zu sein scheint. Die so genannte Linke hatte immer schon einen Hang zur Fraktionierung in immer noch kleinere Gruppen, die dann umso heftiger aufeinander losgingen, sich nicht selten das Links-sein absprachen.
Dies wiederum liegt u.a. daran, dass die Linke vor allem immer gerne mit Etiketten operiert, sodass etwas oder jemand "revolutionär", "revisionistisch", "reaktionär", "faschistoid", "idealistisch" oder "materialistisch", "marxistisch", "sektiererisch", "antikommunistisch", "demokratisch", "totalitär", "bürgerlich", "bildungsbürgerlich", "proletarisch", und jetzt eben "identitär" usw. ist, und das genügt vielen dann schon.
All das gibt es zwar, aber oft ersetzt die dogmatische Etikettierung zusammen mit eloquenter Polemik die Offenheit im Denken. Und innerhalb der Linken wurde ja immer von allen Seiten selber nach Kräften apodiktisch moralisiert, wobei die Verwendung moralischer (also unvermeidlich dogmatischer) Kategorien grundsätzlich zu unversöhnlicher Polemik neigt.
Hinzu kommt, dass man mit den neuen digitalen Möglichkeiten, jede Äußerung, die als Angriff aufgefasst wird, sofort im Affekt kontern kann, was wiederum zu einer schnell rausgehauenen Gegenpolemik führt, wodurch die Aufheizung noch größer wird. Auch bei Auseinandersetzungen innerhalb der Linken geht es oft recht stammtischmäßig zu. Immer schon.
Dennoch ist wohl kein Shit Storm so schlimm wie ein grölendes, schenkelklopfendes CSU-Bierzelt, das am liebsten zum Lynch-Mob mutieren würde, wenn es von einem Transmann erfährt, der in der taz über seine Schwangerschaft interviewt wird.
Hier kommt dann der Ausdruck "nicht normal" ins Spiel, und man spürt das seit je in ihm steckende Drohpotential. Die "normale Identität" mit ihrer Tradition, Frömmigkeit, Heimatverbundenheit, selbstgerechten Zufriedenheit und moralischen Nestwärme fühlt sich durch alles Abweichende, das nicht mehr ausgeschlossen sein will und Forderungen stellt, bedroht und reagiert aggressiv.
Das ist ja die andere Seite des Aufruhrs um die Identitätspolitik, die aus der der Konvention und Tradition immer schon innewohnenden Repression kommt und sich in den Fleischhauers, Poscharts usw. in mediales Getöse übersetzt, für das die identitätspolitischen Gruppen dann haftbar gemacht werden.
Identitätspolitik für eine "Spaltung der Gesellschaft" verantwortlich zu machen, ist jedenfalls naiv und irreführend. Eine Gesellschaft, in der zehn Prozent vom Staat bedingungslos beschützte Reiche zwei Drittel des vorhandenen Vermögens besitzen, ist immer schon so hoffnungslos gespalten, dass Krisen unvermeidlich und auf Dauer unlösbar sind.
Einer solchen Gesellschaft muss man entgegenhalten, dass sie niemals eine Art von Gemeinschaft sein kann. Sie nimmt zwar in Anspruch, ein Allgemeines zu sein, in das sich das Besondere einordnen muss, aber sie ist ein falsches Allgemeines, dessen Ansprüche hohl und nichtig sind.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
