Der Feind in Asien
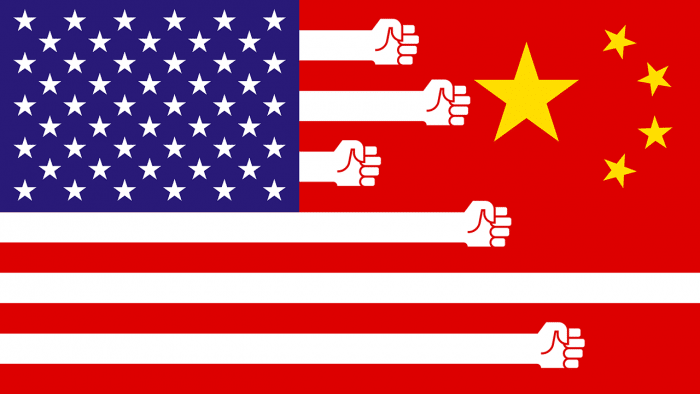
Ein neuer Kalter Krieg der USA gegen China bewegt die Welt. Tatsächlich haben US-Akteure den Konflikt erheblich zugespitzt. Eine vorläufige Übersicht
Droht ein neuer Kalter Krieg, dieses Mal zwischen den USA und China? Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sei an folgende Punkte erinnert:
- Donald Trump hat einen Handelskrieg gegen China geführt, in dessen Verlauf chinesische Waren mit 550 Milliarden Dollar an Strafzöllen belegt wurden. Seine Diplomaten sorgten dafür, chinesische Firmen mit überlegenen Technologie-Angeboten aus westlichen Märkten zu drängen und im Fall von Huawei deren Managerin verhaften zu lassen. Die Biden-Regierung führt die Schutzzoll-Politik ihrer Vorgängerregierung fort und hat sie um ein Gesetz ergänzt, das Regierungsbehörden untersagt, ausländische Waren und Dienstleistungen zu kaufen (Umfang 600 Milliarden US-Dollar).
- Im südostasiatischen Meer finden weitere US-Manöver statt; der sogenannte "Inselstreit" wird von US-Seite mit kleineren Scharmützeln am Leben gehalten, amerikanische Stützpunkte in der Region werden reaktiviert und neu ausgestattet (Philippinen, Guam), die Aufrüstung Taiwans mit US-Waffen forciert.
- Auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2020 hat der US-Verteidigungsminister Mark Esper in einer Brandrede die Notwendigkeit eines westlichen Bündnisses gegen China beschworen. Der G7-Gipfel in London 2021 – unter der Regierung Biden – diente explizit der Anbahnung eines solchen Bündnisses, weshalb auch Australien, Indien und Südafrika eingeladen wurden.
- Begleitet wurde und wird diese Politik durch immer mehr und immer heftigere Anklagen gegen den chinesischen Staat in der westlichen Öffentlichkeit und den Vereinten Nationen. China wird inzwischen des Genozids an einer ethnischen Minderheit, den Uiguren, bezichtigt. Dazu treten im Wochenrhythmus wechselnde Vorwürfe wegen staatlicher Repression gegen Protestierende in Hongkong, Ausbeutung afrikanischer und asiatischer Staaten, Umweltverstößen und nicht zuletzt Schuldzuweisungen und Kritik am autoritären Staatsverhalten in der Corona-Krise.
Kampagnen dieser Art haben dafür gesorgt, dass der chinesische Staat in der Bevölkerung einen ziemlich schlechten Ruf hat – gerade auch bei denen, die dem hiesigen Staat nicht ohne Kritik gegenüberstehen. Dass die USA China so feindselig gegenübertreten und Verbündete für ein Anti-China-Bündnis sammeln, liegt allerdings nicht in den Vorwürfen begründet, die sie lancieren und dann zitieren. Die regierenden Politiker können Feindbild und Feindschaft besser auseinanderhalten als ihre Presse und ihr Volk.
Autoritäres Regieren ist für die USA, das Mutterland von Demokratie und Menschenrechten, per se jedenfalls kein Grund für Feindseligkeiten. Sie haben schon Herrscher von ganz anderem Kaliber zu Freunden erklärt – wie den Saudi-König Salman und den ägyptischen Putsch-General Al Sisi – oder selbst an die Macht gebracht – wie den Schah im Iran oder Pinochet in Chile. Letztere übrigens jeweils gegen demokratisch gewählte Politiker. Und auch bei Menschenrechtsverletzungen gegen Minderheiten, ja selbst Genoziden – mal angenommen, das sei in China so, wie es in westlichen Medien unter Bezug auf hiesige Quellen gemeinhin darstellt wird1 – sind US-Präsidenten nicht gerade zimperlich, wenn es ihnen geopolitisch in den Kram passt. So hat der türkische Nato-Partner Erdogan mit Panzern und Bomben gegen die Kurden bisher freie Hand.
Womit also hat sich China, an dem US-amerikanisches Kapital in den letzten Jahren enorm viel verdient hat und das auch gerade wieder einmal die Weltkonjunktur-Lokomotive darstellt, diese harte Feindschaft der USA verdient?
Vom sozialistischen Entwicklungsland zur kapitalistischen Großmacht
Die Antwort lautet: China zieht diese Feindschaft auf sich, weil es sich so überaus erfolgreich in die US-amerikanische Geschäftsordnung integriert hat. Das hört sich paradox an und ist erklärenswert.
Die sozialistische Volksrepublik hat sich nach 1978, zwei Jahre nach Maos Tod, für westliches Kapital geöffnet und sukzessive ihre vorherige Art der Planwirtschaft aufgegeben; ausländische und zunehmend auch chinesische Firmen verdienen seitdem mit Waren aller Art, die chinesische Lohnarbeiter fertigen, viel Geld am Weltmarkt.
Dass der Zufluss von Kapital aus den etablierten kapitalistischen Ländern nicht zur üblichen "Karriere" eines Entwicklungslandes geführt hat (Ausverkauf des nationalen Reichtums, insbesondere von Rohstoffen, zunehmende Verschuldung, IWF-Diktate, failing states etc.), ist ein welthistorischer Ausnahmefall. Dessen Gründe liegen in der Öffnungsstrategie der kommunistischen Führung des Landes, die gekennzeichnet war durch Vorsicht und Misstrauen gegenüber den westlichen2 Staaten und ihren Unternehmern.
Die Kommunistische Partei hat zunächst nur spezielle Teile ihres Landes für auswärtige Kapitalanlage zur Verfügung gestellt - der Rest blieb davon unberührt; die Versorgung der Bevölkerung wie die Beziehungen zwischen den chinesischen Staatsbetrieben funktionierten zunächst weiter nach Plan. Für das anlagesuchende ausländische Kapital, das mit Sonderkonditionen gelockt wurde (billige chinesische Arbeitskräfte, miese Arbeitsbedingungen, wenig Steuern), gab es strikte Auflagen: Es musste chinesische Partner suchen (joint ventures), Technologietransfer zulassen und lokale Zulieferer einbeziehen; damit sorgte Chinas Führung für die Entwicklung eigener, weltmarktauglicher Unternehmen.
Die chinesische Währung wurde an den Dollar gebunden, ausländisches Finanzkapital nicht zugelassen. Dass die internationalen Kapitale (und ihre Staaten) im Falle Chinas solche Restriktionen auf der anderen Seite hingenommen haben, lag an der Attraktivität, die die Aussicht auf diesen letzten großen weißen Fleck in der kapitalistischen Weltkarte für sie darstellte: Ein Land dieser Größenordnung, das nicht nur über ein riesiges Angebot an Billigarbeitern, sondern auch über 1,3 Milliarden potenzielle Konsumenten verfügte - das war schlicht so perspektivreich, dass keiner sich leisten wollte und konnte, bei diesem neuen Goldrush nicht dabei zu sein.
Ganz gegen die populären Behauptungen von der per se gegebenen Nützlichkeit von Kapitalimporten ist also festzuhalten: Es müssen schon eine ganze Reihe von Bedingungen zusammen kommen, damit auswärtiger Kapitalzufluss für ein "zu spät" in den Weltmarkt eintretendes Land zum Mittel seiner Entwicklung wird und nicht nur den Kapitalgebern dient.3
China ist auf diese Art und Weise nach und nach (einige Friktionen inbegriffen) selbst zu einem relevanten Teil des Weltmarkts geworden, von dem inzwischen der Rest der Welt (auch die USA) abhängen. Westliche Firmen finden heute dort einen wesentlichen Teil ihrer lohnenden Anlagemöglichkeiten und einen sich immer noch stark erweiternden Markt für ihre Produkte.
Umgekehrt machen es die von dort importierten und billigen Konsumgüter möglich, die lohnabhängig Beschäftigten in den westlichen Ländern mit geringen Löhnen und Sozialtransferleistungen abzuspeisen (weder die deutschen Dumpinglöhne noch das Überleben der Hartz-Bevölkerung wäre möglich ohne chinesische Klamotten, Schuhe, Spielzeug). Daneben verkaufen chinesische Firmen inzwischen High-Tech-Produkte, für die es in den westlichen Ländern keine (jedenfalls so kostengünstigen) Alternativen gibt.
Mit dem über Jahrzehnte anhaltenden Wachstum seines Standorts hat sich auch der chinesische Staat erhebliche Mittel verschafft. Steuern und ein stetiger Zufluss an harten Devisen durch Warenexport und Kapitalzufluss erlauben ihm eine Ausweitung seiner Haushaltspolitik – und damit eine beschleunigte Förderung von Wachstum, unter anderem in den bisher noch nicht kapitalistisch entwickelten Provinzen, die ziemlich planmäßig in Wert gesetzt werden.
Gleichzeitig verwendet China viel Geld aus seinem Devisenschatz, der zeitweise auf über drei Billionen US-Dollar angewachsen war, für ausgreifende Infrastrukturmaßnahmen (Projekt Neue Seidenstraße), um seinen Unternehmen zuverlässigen Zugriff auf Rohstoffe und Absatzmärkte zu sichern – in Asien, Europa, Afrika und Südamerika – und hat damit auch seinen politischen Einfluss weltweit massiv gesteigert.
Die ehemals sozialistische Volksrepublik hat also erreicht, was die Vereinigten Staaten den entkolonialisierten Ländern der 3. Welt nach 1945 so generös versprochen hatten: sich zu entwickeln, selbst reich und mächtig zu werden, auf Augenhöhe zu den etablierten Nutznießern dieser Welt aufzuschließen.
Eine Konkurrenz neuen Typs
Und eben das halten vor allem die USA nicht aus – denn das haben sie weder vorhergesehen noch gewollt, als sie Chinas Öffnungspolitik 1978 so freudig begrüßt haben. Das zeigt rückwärts noch einmal, wie die damals kursierende Vorstellung von den "Entwicklungsländern" nicht gemeint war: Das einzige Land, das "es geschafft hat" und jetzt sogar zum Mond fliegt, wird jedenfalls nicht gerade mit Beifall begrüßt und gilt auch nicht als Modell für andere.
Das macht gleichzeitig unmissverständlich deutlich, welchen Anspruch die USA an "ihre" Welt haben: Sie verlangen für sich den Nutzen aus der Ordnung, die sie der Welt gegeben nach 1945 haben.
Nachdem Deutschland mit zwei Versuchen gescheitert war, sich wesentliche Teile der Welt territorial unterzuordnen, haben die siegreichen USA nach Weltkrieg II ein neues Prinzip eingeführt: Globale Freiheit für Handel und Kapitalverkehr in einer Welt souveräner Staaten – eine Ordnung, die ihnen als modernster und produktivster kapitalistischer Macht den ökonomischen Nutzen garantieren sollte.
Das richtete sich – nachdem die Konkurrenten Deutschland und Japan mit ihren Eroberungsplänen fürs Erste erledigt waren – gegen den kolonialen Exklusiv-Besitz ihrer westlichen Alliierten und vor allem gegen den sozialistischen Staatenblock, der die westlichen Unternehmer einfach aussperrte und auf seine Art wirtschaftete.
Gegen dessen Führungsmacht UdSSR haben die USA mit ihren Alliierten am Atlantik und Pazifik den ersten Kalten Krieg auf die Tagesordnung gesetzt – mit kleinen "heißen" Stellvertreterkriegen. Diese Auseinandersetzung haben sie 1990 dank ihrer überlegenen Aufrüstung gewonnen; die Sowjetunion hat abgedankt und die Freiheit des Geschäftemachens gilt seither wirklich überall, die USA sind die unbestrittene und alleinige Weltmacht.
Allerdings ist ihnen in der Folgezeit innerhalb ihrer schönen Weltordnung mit China dann dieser unangenehme Konkurrent entstanden, der ihnen ökonomisch den Nutzen aus "ihrem" Weltgeschäft streitig macht und politisch souverän genug ist, um sich nicht unterzuordnen. So hat sich für die USA ein Widerspruch ganz besonderer Art herausgebildet, denn die Volkswirtschaften dieser beiden Kontrahenten sind gewissermaßen symbiotisch miteinander verflochten:
Die USA brauchen China für das Wachstum ihrer Unternehmen – und sie leiden an dieser Abhängigkeit und den Konsequenzen, die das für ihren Standort hat. Sie brauchen Chinas Weltmarkterfolge und den chinesischen Staat, der damit ihre Staatsschulden kauft, mit denen sie die Kriege der letzten Jahre finanziert haben – und finden genau das gleichzeitig unerträglich.
Sie profitieren sogar von den Aufbauleistungen, die China den ärmeren (und vom Westen nach 1990 Ländern in Asien, Afrika und Südamerika zukommen lässt (zurzeit zum Beispiel mit seinen Impfstoffen) - und wollen genau das nicht haben, weil es ihre unangefochtene Stellung als Weltmacht untergräbt.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
