Die Dreifaltigkeit der Tributökonomie
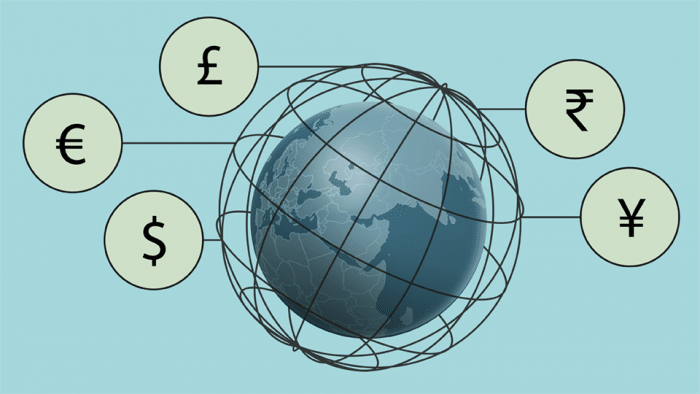
Mit Subventionen, leistungslosen Einkommen aus Eigentumsrechten und Aneignung durch Schulden wird die kapitalistische Maschinerie der endlosen Geldverwertung in Gang gehalten
Es gehörte schon immer zu den schmutzigen Geheimnissen des Kapitalismus, dass er mit freien Märkten sehr wenig zu tun hat und von Anfang an untrennbar mit staatlichen Herrschaftsstrukturen verflochten war. Die frühneuzeitlichen Staaten gewährten Händlern und Bankiers wie den Fuggern Monopolrechte als Gegenleistungen für Kredite, mit denen die Landesherren Söldner und Rüstungsgüter bezahlten. Nur durch diese Kredite konnten die sich neu formierenden Territorialstaaten ihre Macht aufbauen. Und nur durch die Monopole konnten die Händler und Bankiers die enorme Konzentration von Kapital in ihren Händen erreichen, ohne die der Kapitalismus undenkbar wäre.
Die ersten Aktiengesellschaften des 17. Jahrhunderts waren Schöpfungen von Staaten und wurden von ihnen mit Charterbriefen, Monopolrechten und sogar militärischen Mitteln ausgestattet. Bis heute sichern Staaten für private Unternehmen weltweit Handelswege und setzen Eigentumsrechte durch - oft gegen den massiven Widerstand lokaler Bevölkerungen, wenn es etwa darum geht, neue Kupferminen oder Tagebaue zu erschließen, Pipelines zu bauen oder Kleinbauern für Palmölplantagen zu vertreiben.
Im Laufe der Jahrhunderte haben sich darüber hinaus einige weitere Methoden entwickelt, mit denen Staaten die Maschinerie der endlosen Geldverwertung in Gang halten. Drei Strategien sind dabei von besonderer Bedeutung: Subventionen, leistungslose Einkommen aus Eigentumsrechten und Aneignung durch Schulden. Diese Dreifaltigkeit der Tributökonomie wird immer wichtiger, je instabiler die Weltwirtschaft wird. Denn sie beschert dauerhafte Geldflüsse auch dann, wenn sich am Markt kaum noch Profite durch den Verkauf von Gütern und Dienstleistungen erzielen lassen.
Konzerne am Tropf
In fast allen Staaten der Erde existiert ein komplexes Subventionsdickicht, durch das private Konzerne mit Steuergeldern kontinuierlich gefördert werden. In den letzten Jahrzehnten ist dieses Subventionsnetz zu einer Art Herz-Lungen-Maschine für den dahinsiechenden Kapitalismus geworden.
Ein Großteil der 500 größten Konzerne der Erde würde ohne die massive Unterstützung durch Steuergelder längst bankrott sein. Schauen wir uns die mächtigsten Branchen einmal nacheinander an:
- Die Erdöl-, Erdgas- und Kohleindustrie wird nach Schätzungen der ausgesprochen konservativen Internationalen Energieagentur jedes Jahr mit rund 500 Milliarden Dollar subventioniert. Dabei sind die noch viel größeren Schäden, die diese Branche durch den Klimawandel verursacht - und für die sie bisher praktisch nichts bezahlt -, noch nicht mit einberechnet. Auch nicht berücksichtigt sind die Kosten für die Kriege um Erdöl und die militärische Sicherung von Pipelines und Tankerrouten, die ebenfalls aus Steuergeldern bestritten werden.
- Die gigantischen Ölsubventionen stützen auch massiv die krisengeschüttelte Automobilindustrie weltweit. Würden die wahren Kosten des Öls auf die Benzinpreise umgelegt, wäre Autofahren für die meisten Menschen unbezahlbar, die Branche würde zusammenbrechen. Der Bau und Unterhalt von Straßen verschlingt außerdem in allen Ländern der Erde weit mehr Geld, als durch Kfz-Steuern eingenommen wird - eine billionenschwere Subvention, die der Autoindustrie einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Schienenverkehr verschafft. Das Umweltbundesamt hat errechnet, dass der Autoverkehr in Deutschland, wenn man Umweltschäden und Unfälle miteinberechnet, die Allgemeinheit jedes Jahr 59 Milliarden Euro mehr kostet, als der Fiskus über Auto-bezogene Steuern und Gebühren einnimmt. Für die Umwelt- und Gesundheitsschäden infolge krimineller Machenschaften, etwa der Manipulation von Abgaswerten, zahlen Autokonzerne praktisch nichts. Hinzu kommen massive direkte Subventionen. Allein für die sogenannte Abwrackprämie nach der Finanzkrise flossen in Deutschland fünf Milliarden Euro an Steuergeldern, in den USA spendierte die Regierung sogar 80 Milliarden Dollar, um GM und Chrysler zu retten, davon waren zehn Milliarden am Ende für die Steuerzahler auf Dauer verloren.
- Die Flugzeugbranche produziert den am schnellsten wachsenden Anteil an Treibhausgasen und bezahlt für die daraus folgenden Schäden nichts. Für ihre Infrastruktur, insbesondere den Bau von Flughäfen, kommen fast ausschließlich die Steuerzahler auf. Allein der BER-Flughafen bei Berlin hat bereits in der Bauphase fünf Milliarden Euro verschlungen, das Äquivalent von etwa einer Million Kindergartenplätzen. Flugbenzin wird weltweit nicht besteuert, der Flugverkehr ist außerdem aus den UN-Klimaverhandlungen ausgespart. Airlines wie Al Italia oder Air Berlin wurden mit Hunderten Millionen Euro Steuermitteln vor dem Konkurs bewahrt. Die Flugzeugbauer Airbus und Boeing erhalten auf direktem und indirektem Wege staatliche Subventionen in Milliardenhöhe, die regelmäßig Gegenstand von Handelsstreitigkeiten zwischen der EU und den USA sind.
- So gut wie alle Großbanken der USA, Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und vieler anderer Staaten würden heute nicht mehr existieren, wenn sie seit 2008 nicht mit Steuergeldern in Billionenhöhe gerettet worden wären. Das Gleiche gilt für einige der weltweit größten Versicherungskonzerne wie AIG oder Allianz. Allein in Deutschland schlugen die Bankenrettungen für die Steuerzahler unterm Strich mit etwa 60 Milliarden Euro zu Buche, so viel wie alle deutschen Schulen zusammen pro Jahr kosten. Auch die angeblichen "Rettungspakete für Griechenland" dienten, über den Umweg der griechischen Staatskasse, fast ausschließlich der Bankenrettung, bei den griechischen Bürgern ist davon so gut wie nichts angekommen: 206 Milliarden Euro aus den beiden ersten Rettungspaketen gingen an die privaten Banken, bei denen sich die griechische Regierung verschuldet hatte, nur 9,7 Milliarden kamen dem Staatshaushalt zugute.
- Die Zentralbanken der USA, der EU und Japans haben seit 2008 die unglaubliche Summe von neun Billionen Dollar in das Finanzsystem gepumpt, um die Märkte vor dem Kollaps zu bewahren. Ein einziger Monat aus dem EZB-Wertpapier-Programm hätte genügt, um die Schuldenkrise Griechenlands zu lösen. Stattdessen floss das Geld an die privaten Banken. Seit 2016 gehört zu dem Programm neben dem Erwerb von Staatsanleihen auch der Ankauf von Aktien. Allein die EZB hat dafür etwa 80 Milliarden Euro ausgegeben. Damit werden die Aktienwerte für die Shareholder künstlich nach oben getrieben.
- Die IT-Konzerne des Silicon Valley haben ihr Kapital auf Computer-Technologien aufgebaut, die jahrzehntelang von staatlichen, aus Steuergeldern finanzierten Forschungseinrichtungen entwickelt wurden, insbesondere dem Massachusetts Institute of Technology. Diese Technologien wurden Microsoft, Apple, Google, Facebook und Co. umsonst zur Verfügung gestellt. In einem iPhone steckt, wie die Ökonomin Mariana Mazzucato feststellt, nicht eine einzige Technologie, die nicht staatlich finanziert wurde. Der Staat hat also als Forschungsabteilung für diese Unternehmen gewirkt. Die Konzerne wiederum haben die üppigen Staatsgeschenke privatisiert und daraus proprietäre Software entwickelt, die die Grundlage ihres Reichtums und ihrer Macht bildet. Dieses System wird durch staatliches Patentrecht und die Weigerung der meisten Regierungen, wirksam gegen die Monopole dieser Konzerne vorzugehen, gesichert.
- Die Pharmaindustrie erhält milliardenschwere Subventionen, unter anderem über den Umweg von öffentlichen Forschungseinrichtungen. Die EU etwa pumpt mit der "Innovative Medicines Initiative" (IMI) 2,5 Milliarden Euro in die Pharmabranche. Ein trinationales Rechercheteam hat das Programm unter die Lupe genommen und ist zu dem Schluss gekommen, es diene "fast nur dazu, die Industrie über den Umweg der Forschung zu subventionieren." Die IMI ist dabei nur die Spitze vom Eisberg, große Teile der öffentlichen universitären Forschung im Bereich der "Life Science" dienen vor allem der Pharma- und Biotech-Industrie. In den USA werden zwei Drittel der Pharmaforschung aus staatlichen Subventionen bestritten, die sich auf ca. 30 Milliarden Dollar jährlich belaufen; die Gewinne aus den meist überteuerten Medikamenten dagegen sind vollständig privatisiert.
- Die Hightech-Strategie der deutschen Bundesregierung, ein Forschungsprogramm mit einem Umfang von 27 Milliarden Euro, ist überwiegend ein Subventionsprogramm für Großunternehmen. Das ist wenig überraschend, da die "Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft", die für das Programm wesentlich mitverantwortlich war, mit Vertretern von Daimler, BMW, BASF, Siemens, E.ON, Boehringer Ingelheim und Dr. Oetker besetzt war. Die Forschungsförderung für eine sozial-ökologische Transformation beträgt dagegen ein Tausendstel der High-Tech-Strategie, nämlich 30 Millionen Euro.
- Die Chemieindustrie wird in Deutschland allein durch die Ausnahmen von der Erneuerbaren-Energien-Umlage mit 1,6 Milliarden Euro pro Jahr subventioniert.
- Die Atomindustrie wurde und wird in allen Staaten, die Kernenergie produzieren, massiv subventioniert und war zu keinem Zeitpunkt ohne solche Hilfen existenzfähig. Laut einer Greenpeace-Studie flossen allein in Deutschland seit den 1950er-Jahren 200 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern in die Kassen der Energiekonzerne. Noch nicht einberechnet sind dabei die Kosten für Rückbau und Endlagerung, von denen die Steuerzahler vermutlich den größten Teil bezahlen werden.
- Die gesamte Rüstungsbranche wird ausschließlich durch die aufgeblähten staatlichen Verteidigungsetats am Leben gehalten, weltweit ein Geschäft von 1,5 Billionen Dollar pro Jahr. Mit einem Bruchteil dieses Geldes ließe sich sowohl der Hunger auf der Welt, der 800 Millionen Menschen betrifft, beseitigen, als auch die Energieversorgung vollständig auf erneuerbare Alternativen umstellen.
- Die EU gibt jährlich mindestens 50 Milliarden Euro für Agrarsubventionen aus. Der Löwenanteil davon fließt in die industrielle Landwirtschaft, die weltweit für etwa ein Drittel der Treibhausgasemissionen, die Degradierung der Böden, die Entstehung multiresistenter Erreger in der Massentierhaltung und 80 bis 90 Prozent des Süßwasserverbrauchs verantwortlich ist. Durch den Export der hochsubventionierten Überproduktion wird außerdem die Landwirtschaft vor allem in westafrikanischen Ländern zerstört. Agrarsubventionen fließen sogar an branchenferne Konzerne wie BASF, Bayer, RWE und - man kann es kaum glauben - an den Panzerhersteller Rheinmetall.
- Praktisch alle großen Konzerne profitieren von dem Netz aus Steueroasen und Steuerschlupflöchern, das von Staaten geschaffen und - allen gegenteiligen Lippenbekenntnissen zum Trotz - hartnäckig aufrechterhalten wird. Allein in der EU betragen die staatlichen Einnahmeverluste durch Steuerflucht und Schattenwirtschaft schätzungsweise 1000 Milliarden Euro pro Jahr. Damit ließen sich mittelfristig alle Staatsschulden in der EU begleichen. Oft sind es die Regierungen selbst, die Steuervermeidungsdeals einfädeln, wie etwa der Fall der Luxemburg-Leaks gezeigt hat. Die meisten großen Staaten pflegen und protegieren ihre Steueroasen fürsorglich, ob es die britischen Kanalinseln, Bermudas oder Kaimaninseln sind, das US-amerikanische Delaware oder Pseudostaaten wie Monaco in Europa. Dem ganzen Spuk könnte sofort Einhalt geboten werden, wenn die Zentralbanken allen Kreditinstituten, die mit Steueroasen Geschäfte machen, ihre Konten kündigen würden. Doch Regierungen und Zentralbanken weigern sich beharrlich, diesen Schritt zu tun. Die Bundesregierung unterstützt die Steuerflucht außerdem mit einem Trick, indem sie die Aufsicht darüber ausgerechnet an die Wirtschaftsprüfungskonzerne KPMG und PricewaterhouseCoopers outgesourct hat, die selbst Steuervermeidung im großen Stil organisiert haben.
- Investitionsschutzabkommen (manche davon werden irreführend "Freihandelsabkommen" genannt) geben Konzernen die Möglichkeit, Staaten auf Schadensersatzzahlungen zu verklagen, wenn ihnen zum Beispiel durch neue Sozial- oder Umweltgesetze fiktive künftige Profite entgehen könnten. Deutschland hat bereits 130 solcher Abkommen abgeschlossen, um Investitionen deutscher Unternehmen im Ausland abzusichern. Auch das CETA-Abkommen der EU mit Kanada und das "Freihandelsabkommen" mit Japan sehen exklusive Klagemöglichkeiten für Konzerne vor. Der Sinn dieser Verträge besteht darin, Investitionsrisiken auf Steuerzahler abzuwälzen, Gesetzgeber von unliebsamen Regulierungen abzuschrecken und eine neue Art von Geldflüssen aus Staatskassen an Unternehmen zu organisieren.
- Ein beträchtlicher und wachsender Teil der 130 Milliarden US-Dollar, die Staaten für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben, fließen über Organisationen wie USAID oder die Deutsche Entwicklungsgesellschaft DEG in die Kassen großer Konzerne und ihrer Shareholder. Deutsche Entwicklungshilfe wird zum Beispiel benutzt, um Gentechnik-Konzerne wie Monsanto und Bayer zu fördern, den Verkauf von Dr.-Oetker-Pizzen in Ostafrika zu subventionieren, Steuerflucht zu unterstützen und Kleinbauern von ihrem Land zu vertreiben, um dort Palmölplantagen aufzubauen. Immer öfter stehen dabei Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP/PPP) im Zentrum, die dazu dienen, Gewinne zu privatisieren und Verluste auf die Steuerzahler abzuwälzen.
- Auch im Inland enthalten ÖPPs oft versteckte Subventionsmechanismen. Bei der Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe in den 1990er-Jahren etwa schloss der Senat mit den "Investoren" Vivendi/Veolia und RWE einen geheimen Vertrag, der den Konzernen garantierte Profite in Höhe der durchschnittlichen marktüblichen Renditen plus zwei Prozent zusicherte, und zwar unabhängig von den Leistungen des Unternehmens. Damit schufen sie eine von der öffentlichen Hand finanzierte Gelddruckmaschine für Shareholder. Die geplante Bundesfernstraßen-Gesellschaft, für die CDU/ CSU und SPD im Frühjahr 2017 dreizehn Grundgesetzänderungen durch Bundestag und Bundesrat brachten, dient vor allem dazu, die deutschen Autobahnen mit einem Wert von schätzungsweise 200 Milliarden Euro für die private Kapitalverwertung zu öffnen. Mit ÖPPs und "stillen Einlagen" sollen Finanzkonzernen wie Allianz und Deutscher Bank, die verzweifelt nach lukrativen Anlagen suchen, risikolose, staatlich abgesicherte hohe Renditen verschafft werden.
- Die Teilprivatisierung des deutschen Rentensystems ("Riester-Rente") ist ein gigantisches Subventionsprogramm für die großen Versicherungs- und Bankkonzerne. Der ehemalige deutsche Arbeitsminister Norbert Blüm hat errechnet, dass die 13 Milliarden Euro Staatszuschüsse vor allem in die Kassen privater Versicherungskonzerne wie der Allianz flossen. Die Deutschen bezahlen das nicht nur mit ihren Steuergeldern, sondern auch mit einer gewaltigen Rentenkürzung, denn sie haben inzwischen bei gleicher Lebensarbeitszeit und gleichem Einkommen eine um 30 Prozent niedrigere Rente als die Österreicher, die am staatlichen Umlagesystem festgehalten haben.
Diese Liste könnte man noch eine ganze Weile fortsetzen. Sie zeigt, dass die vielbeschworenen "freien Märkte" eine Fata Morgana sind, ein sorgsam gepflegter Mythos, der verschleiern soll, dass die Maschinerie der endlosen Geldvermehrung nur noch funktioniert, weil wir sie täglich mit Unsummen aus Steuergeldern subventionieren. Während Staaten rund um die Erde massiv an Ausgaben, vor allem im Sozialbereich, sparen, werden diese Subventionen kaum angetastet, oft sogar ausgebaut.
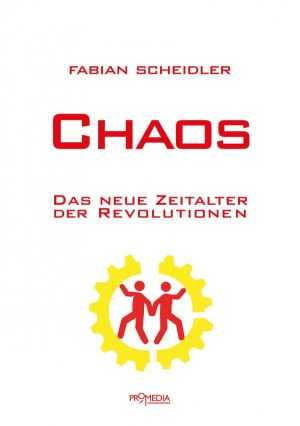
Das hier veröffentlichte Kapitel stammt aus dem jüngst im Promedia Verlag erschienenem Buch von Fabian Scheidler "Chaos.Das neue Zeitalter der Revolutionen" [1].
Nun führen Verteidiger dieses Wohlfahrtstaats für Konzerne ins Feld, es würden dadurch Arbeitsplätze gesichert. Dieses Argument ist offensichtlich unsinnig, weil man mit demselben Geld genauso gut andere, gemeinwohlorientierte Aktivitäten fördern könnte, bei denen pro eingesetztem Euro oft sogar weit mehr Arbeitsplätze entstehen, etwa im Gesundheitsbereich, im öffentlichen Verkehr, in der Bildung oder der bäuerlichen ökologischen Landwirtschaft.
Die Liste zeigt auch, dass die größten Subventionsempfänger zugleich die destruktivsten Branchen der Erde sind. Es scheint die Regel zu gelten: je zerstörerischer, desto mehr Staatshilfe. Fast alle der für das Klimachaos hauptverantwortlichen Unternehmen, einschließlich der sie finanzierenden Banken, wären entweder bankrott oder in erheblichen Schwierigkeiten, wenn sie nicht künstlich von Staaten am Leben gehalten würden. Mit anderen Worten: Die Streichung dieser Subventionen ist ein entscheidender Hebel, um die Spirale der Zerstörung zu stoppen und einen sozial-ökologischen Wandel auf den Weg zu bringen. Der Tropf, an dem diese Unternehmen hängen, ist zugleich ihr verwundbarster Punkt. Denn während transnationale Unternehmen demokratisch schwer angreifbar sind, bestimmen über die Verwendung von Steuergeldern - zumindest theoretisch - die Bürger. Die scheinbar allmächtigen Giganten der Weltwirtschaft würden sehr rasch ins Straucheln kommen, wenn ihnen die künstliche Ernährung durch den Staat abgestellt würde.
Rente statt Profit
Das Subventionswesen für Konzerne, für ihre Shareholder und Manager, ist Teil einer größeren Struktur, die man bisweilen als "Sozialismus für Reiche" oder "Neofeudalismus" bezeichnet hat. Den oberen Schichten ist es gelungen, sich ein "bedingungsloses Maximaleinkommen" zu sichern, das von ihren Leistungen und Verfehlungen weitgehend entkoppelt ist. Nicht Markterfolge erhalten und vermehren die großen Vermögen und Einkommen, sondern Strategien der Privilegiensicherung, insbesondere durch Einflussnahme auf den Staat. Die staatliche Gabenökonomie für Superreiche verbindet sich mit dynastischen Strukturen, in denen Macht und Reichtum wie einst beim Adel durch die Geburt vererbt werden.
Dazu gehört auch, dass ein immer größerer Teil des Kapitals gar nicht durch Produktion und Verkauf von Waren und Dienstleistungen vermehrt wird, sondern durch das, was man in der Ökonomik "Renten" nennt. "Rente" bedeutet hier nicht Altersversorgung, sondern ein Einkommen aus Gebühren für die Nutzung von Land, Wohneigentum oder aus "geistigen Eigentumsrechten", zum Beispiel Patenten. Entscheidend ist, dass Kapitalbesitzer hier gar nichts produzieren und dann verkaufen, sondern allein aus dem Rechtstitel auf ein Eigentum ein Einkommen generieren.
Tributzahlungen von diesem Typ vereinnahmen einen erheblichen Anteil der Volkseinkommen. In deutschen Großstädten wie Hamburg, Berlin oder München müssen die Menschen im Schnitt etwa die Hälfte ihres Einkommens für Miete bezahlen. Nur ein Bruchteil davon kann als Gebühr für Baukosten, Instandhaltungen und Dienstleistungen aufgefasst werden. In Berlin zum Beispiel konnten Wohnungseigentümer bei Altbauten mit einer Nettomiete von sechs Euro pro Quadratmeter bis vor Kurzem gut leben, ausreichend Rücklagen für Reparaturen bilden und sogar Gewinne machen. Dieselben Wohnungen werden nun für einen Quadratmeterpreis von zwölf Euro und mehr vermietet. Die sechs zusätzlichen Euro sind reines Tributgeld. In anderen europäischen Metropolen liegen die Preise oft noch viel höher, in Paris zum Beispiel bei bis zu 50 Euro pro Quadratmeter. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bemerkte zu Recht: "Der Pariser Wohnungsmarkt kennt keine Wirtschaftskrise."
Wenn neu gebaut wird, sind natürlich größere Investitionen notwendig, und es lässt sich die Vermietung als ein gewöhnliches Geschäft begreifen, um diese Kosten plus einen Gewinn herauszuholen. Nun sind Wohngebäude aber keine Verbrauchsgüter, sondern können potenziell Jahrhunderte existieren. Sind die einmal getätigten Investitionen amortisiert, fließt, von Verwaltungskosten und gelegentlichen Instandsetzungen abgesehen, ein endloser Strom leistungslosen Einkommens an die Eigentümer. Da in vielen Ballungsgebieten strukturell Knappheit von Wohnraum herrscht, die nur sehr bedingt oder gar nicht durch Angebotserweiterung gemildert werden kann, sind diese Einkommensströme einem echten Marktgeschehen weitgehend entzogen.
Die Konzentration des Wohneigentums ist ein zentrales Mittel, um einen gewaltigen Geldfluss von der Unter- und Mittelschicht in Richtung der großen Vermögen aufrecht zu erhalten, der so gut wie nichts mit der Produktion und dem Verkauf von Gütern und Dienstleistungen zu tun hat. Ähnlich wie einst die Adelsprivilegien, so verleiht hier der bloße Eigentumstitel umfassende Rechte auf Tributzahlungen. Und der Staat schützt diese Privilegien und setzt sie notfalls mit Gewalt durch: Wer seine Miete, sei sie auch noch so überzogen, nicht bezahlen kann oder will, wird irgendwann von der Polizei geräumt. Das Gespann von Immobilieneigentümern und Staatsgewalt gehorcht letztlich einem ähnlichen Prinzip wie das Schutzgeldsystem der Mafia: Man entrichtet Tribut dafür, dass man nicht mit Gewalt vertrieben wird. Und wie bei der Mafia kann man nicht über einen fairen Preis verhandeln.
In dieser Perspektive ist der Kampf für ein "Recht auf Stadt" und gegen Zwangsräumungen eine wichtige Keimzelle für eine andere ökonomische Ordnung - so wie seit biblischen Zeiten der Kampf um eine gerechte Landverteilung. Wie es in der Epoche der Französischen Revolution um eine Abschaffung der Adelsprivilegien ging, so gilt es heute, das moderne Tributsystem des Geldadels aufzubrechen und die Städte den Menschen zurückzugeben, die sie bewohnen. Die Überführung privater Wohnungsgesellschaften in die Hände von nicht-profitorientierten Genossenschaften und kommunalen Betrieben wäre dazu ein erster Schritt.
Die künstliche Verknappung immaterieller Güter
Das Tributsystem erstreckt sich auch auf immaterielle "geistige Güter" wie etwa wissenschaftliche Entdeckungen, technische Erfindungen, kulturelle Leistungen, Software, Markennamen und sogar die genetischen Codes von Lebewesen. "Geistige Eigentumsrechte", die eine exklusive Verfügung über solche Güter garantieren, sind bei näherer Betrachtung ein sehr seltsames juristisches Konstrukt. Sie verknappen künstlich, was eigentlich im Überfluss da ist und durch intensivere Nutzung nicht weniger wird, sondern mehr. Wenn jemand etwa einen Softwarecode nutzt, wird er einem anderen nicht weggenommen, sondern vervielfältigt sich. Die Kosten dafür gehen gegen Null. Natürlich müssen Programmierer von etwas leben; aber Patentgebühren fließen in den seltensten Fällen in die Hände der tatsächlichen Urheber, so wenig wie Mieten in die Hände der Bauarbeiter fließen, die die Häuser einst erbauten. Stattdessen sind sie vor allem eine Methode von Kapitalbesitzern, um in einem Wirtschaftssystem, in dem es immer schwieriger wird, durch Produktion Profite zu machen, dauerhaft leistungslose Einkommen zu generieren.
Und diese Strategie ist recht erfolgreich. Gebühren aus "geistigen Eigentumsrechten" nehmen einen immer größeren Anteil der Volkswirtschaften und Unternehmensprofite ein. In den USA bestreitet die Copyrightbranche bereits elf Prozent des Bruttoinlandproduktes. In einem Bericht des Europäischen Patentamtes heißt es, dass Industrien, die sehr viele geistige Eigentumsrechte beanspruchen, inzwischen bereits 42 Prozent des EU-Sozialproduktes und 90 Prozent der Exportwirtschaft ausmachen. Die Profite daraus gehen meist am Fiskus vorbei, indem sie zum Beispiel über eine Briefkastenfirma in den Niederlanden kanalisiert werden, wo auf Patentgebühren keine Steuern anfallen.
Nun funktioniert dieser Teil des Tributsystems keineswegs reibungslos, sondern wird immer wieder herausgefordert. Gegen das ACTA-Abkommen, das die Ansprüche aus geistigen Eigentumsrechten gegen die Bürger massiv verschärfen sollte, gingen weltweit Hunderttausende auf die Straße. Es gelang schließlich, den Vertrag im EU-Parlament zu stoppen. Das Internet hat die Monopol- und Gatekeeper-Funktionen der Schallplatten-, Film- und Medienindustrie untergraben und freie Software bringt Microsoft und Co. in Bedrängnis.
Allerdings ist es Microsoft bisher gelungen, seine 50 Milliarden US-Dollar Umsatz aus Lizenzen zu verteidigen, obwohl es weitaus bessere, tributfreie Alternativen gibt und Microsoft-Programme enorme Sicherheitslücken aufweisen, die regelmäßig von Kriminellen und staatlichen Überwachungsorganen genutzt werden. Die Strategie des Monopolisten besteht darin, die Kunden in eine "Lock-in"-Situation zu manövrieren, indem die Kompatibilität mit anderen Systemen gezielt verhindert wird. Dazu fügt Microsoft zum Beispiel in Word-Dokumente große Mengen von verschlüsseltem Code ein, der beim Öffnen in anderen Programmen zu Entstellungen führt - und zugleich Hackern Tür und Tor öffnet.
Öffentliche Verwaltungen haben immer wieder versucht, sich aus dem Microsoft-Tributsystem zu befreien, etwa die Städte Wien und München, sind aber durch Lock-in-Strategien und intensiven Lobbyismus - im Fall der Stadt München auch durch den Filz zwischen Konzern und CSU - dazu gedrängt worden, zu Windows und Office zurückzukehren. Microsoft-Lobbyisten sitzen weltweit in Ministerien und Stadtverwaltungen und nutzen mit staatlicher Förderung Schulen und Universitäten zum Marketing. Der Ökonom Rufus Pollock von der Cambridge University spricht vom "klassischen Drogendealer-Modell": früh abhängig machen und dann ein Leben lang zahlen lassen.
Um die umstrittenen Tributansprüche aus "geistigem Eigentum" durchzusetzen, greifen einige staatliche Behörden zu harschen Einschüchterungsmethoden. Ein Beispiel dafür ist der Fall von Aaron Swartz. Der Programmierer und Netzaktivist hatte Millionen von Copyright-geschützten wissenschaftlichen Artikeln heruntergeladen, um sie öffentlich zugänglich zu machen. Ein schweres Verbrechen? Das kommt auf die Betrachtungsweise an. Wissenschaftsverlage verdienen Milliarden damit, dass öffentliche Bibliotheken ihre Zeitschriften für horrende Gebühren abonnieren, obwohl weder die Autoren noch die Lektoren (peer-reviewer) bezahlt werden, die Produktionskosten also gering sind. Die Forschungsergebnisse, die auf diese Weise privatisiert werden, sind meistens von öffentlichen Universitäten finanziert worden. Swartz' Aktion griff diese Form von Tributsystem an.
Obwohl die betroffene Online-Plattform auf eine Klage verzichtete, forderte die Staatsanwaltschaft 35 Jahre Haft und eine Million Dollar Strafe. Wenige Monate später beging der nur 26-jährige Swartz Selbstmord. Doch der weltweite Aufschrei über seinen Tod hat den Widerstand gegen das Tributsystem weiter angefacht.
Die Gentechnik-Industrie hat es in vielen Ländern geschafft, staatliche Protektion dafür zu erlangen, um die globale Landwirtschaft in ein Tributsystem für Patentinhaber zu verwandeln. Hersteller von patentiertem Saatgut wie Monsanto und Bayer, die inzwischen drei Viertel des Weltmarktes kontrollieren, verbieten es Bauern, einen Teil der Ernte als Saatgut für das nächste Jahr zu nutzen, so wie es die Menschheit seit mehr als 10.000 Jahren getan hat. Patentämter, Ministerien und Gerichte untermauern den Anspruch dieser Unternehmen, jedes Jahr erneut Tribut zu fordern. Der Bauer Vernon Bowman etwa wurde von einem US-Gericht zu einer Strafe von 85.000 Dollar verurteilt, weil er es gewagt hatte, Samen erneut zu benutzen, ein Urteil, das vom Obersten Gerichtshof bestätigt wurde.
Auf der anderen Seite schwillt der Widerstand gegen die Gentechnik- und Patentindustrie weltweit massiv an. Der Kampf um freies Saatgut ist eines der entscheidenden Felder der Auseinandersetzung um eine zukunftsfähige Landwirtschaft und Ernährung geworden.
Schulden als Tributstrategie
Neben der staatlichen Alimentierung der Konzerne und leistungslosen Einkommen aus Eigentumsansprüchen hat sich noch eine dritte Strategie herausgebildet, um Tribut zu extrahieren. Sie funktioniert ungefähr so: Man leihe jemandem, der chronisch knapp bei Kasse ist, viel Geld. Wenn er, wie zu erwarten war, irgendwann vor der Zahlungsunfähigkeit steht, rufe man ein paar Schlägertypen und zwinge ihn, noch mehr Schulden aufzunehmen, um seine ersten Schulden weiter zu bedienen. Für Zins und Tilgung dieser nun höheren Schulden pfände man den größten Teil seines Einkommens und seines Eigentums. Außerdem nötige man ihn, immer härter zu arbeiten, seine Freunde, Verwandten und Nachbarn anzupumpen und bei ihnen schließlich nachts das Mobiliar herauszutragen. Bis am Ende alles Hab und Gut weit und breit und auch das Land dem Gläubiger gehört, während die Schulden weiter wachsen.
Ein großer Teil dessen, was wir "Finanzmärkte" nennen, funktioniert nach diesem Muster. Die klammen Leute aus dem Beispiel sind in der Realität Staaten, die Freunde, Verwandten und Nachbarn seine Bürger. Die Schlägertypen bestehen aus Institutionen wie dem Internationalen Währungsfonds, der Troika oder den Gläubigerclubs in Paris und London. Der Witz an dem Spiel ist, dass eine erfolgreiche Entschuldung, ebenso wie eine geregelte Insolvenz, auf jeden Fall ausgeschlossen werden muss, da sonst der kontinuierliche Geldstrom versiegt.
Dieses Spiel wurde jahrzehntelang von den Gläubigerinstitutionen in Afrika, Lateinamerika und Südostasien gespielt. Und seit einiger Zeit auch in Ländern wie Griechenland. Natürlich stößt ein solches System irgendwann an Grenzen, wenn nämlich der Schuldner sein letztes Hemd hergegeben und auch sein ganzes Umfeld ausgenommen hat. Die Kredite werden dann "faul", also wertlos. In diesem Moment betritt eine weitere Figur die Spielfläche. Nennen wir ihn Staat Nummer zwei. Die Gläubiger rufen verzweifelt: Wir stehen vor der Kernschmelze des Finanzsystems, wenn ihr uns nicht rettet, kommt der Weltuntergang. Was tut Staat Nummer zwei? Er verschuldet sich bei einer weiteren Bank, subventioniert die faulen Kredite und sorgt so dafür, dass die Schuldknechte weiter schwitzen müssen, um untilgbare Schulden zu bedienen.
Dass Ergebnis des ganzen Spiels ist ein leistungsloses Dauereinkommen - ein Tribut - für die Manager und Shareholder der Finanzinstitute, während alle anderen Akteure Schritt für Schritt in den Bankrott getrieben werden. Dieses Spiel trägt erheblich zu der enormen Konzentration von Eigentum in immer weniger Händen bei. Mit dem Finger allein auf die Banker zu zeigen, hilft dabei jedoch relativ wenig, denn es sind ja die Staaten und ihre erweiterten Bürokratien in Form von IWF und Troika, die dieses System in Gang halten.
Jenseits des Tributs: die Trennung von Staat und Großkapital
Tribut ist eine Abgabe, die ein besiegtes Volk dem Sieger zu erbringen hat. Sich nicht zu unterwerfen, bedeutet, den Anspruch auf Tribut zurückzuweisen. So wie es einst der jüdische Widerstand gegen das Römische Weltreich oder die indische Befreiungsbewegung gegen das Britische Empire tat. Dabei steht heute der vermeintlich unbesiegbare Gegner bei näherem Hinsehen auf tönernen Füßen.
Das globale Tributsystem funktioniert nur, weil gewählte Regierungen unsere Steuergelder über unzählige offene und versteckte Wege in die Hände der reichsten 1 Prozent kanalisieren und uns am Ende einreden, das Ganze beruhe auf "Markterfolgen". Der erste Schritt zur Überwindung dieses Systems besteht darin, es ans Licht der Öffentlichkeit zu ziehen, seine Legitimität zu bestreiten und es zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen zu machen.
Die staatliche Alimentierung der Konzerne etwa ist so gut wie nie Thema von Wahlkämpfen oder Talkrunden. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, was mit ihren Steuergeldern wirklich geschieht und welche Alternativen es dazu gibt. In einer größeren Perspektive geht es darum, mit der Trennung von Staat und Kapital endlich ernst zu machen. Liberale fordern seit jeher, der Staat solle sich aus der Wirtschaft heraushalten. Doch hat sich dies bisher als bloße rhetorische Fassade erwiesen, denn über die Nabelschnüre, mit denen der Staat das private Kapital versorgt, wird vornehm geschwiegen. Und das hat gute Gründe: Denn die liberale Rhetorik beim Wort zu nehmen, würde das Ende des kapitalistischen Weltsystems bedeuten, das ohne öffentliche Alimentierung nicht existieren kann.
Auch Kritiker des Neoliberalismus begehen oft den Fehler, dass sie der Rhetorik auf den Leim gehen und die Kritik auf die angeblichen "freien Märkte", die "Marktradikalen" und den "Freihandel" konzentrieren, während sie zugleich eine fatale Schwächung des Staates beklagen. Dabei hat die neoliberale Realität gar nichts mit freien Märkten zu tun. Und auch der neoliberale Staat ist keineswegs ein schwacher "Nachtwächterstaat", der hilflos zuschaut, wie Konzerne und Superreiche ihre Vermögen an ihm vorbei bewegen, sondern eine sehr mächtige Bürokratie, die aktiv die stotternde Maschinerie der endlosen Kapitalverwertung mit Schmieröl versorgt.
Eine wirksame Trennung von Staat und Kapital würde enorme Freiräume für andere, zukunftsfähigere Wirtschaftsformen schaffen. Dabei muss man keineswegs bei null anfangen. Seit der Französischen Revolution ist es sozialen Bewegungen in langen Kämpfen gelungen, dem Staat, der anfangs nichts als eine despotische Militärorganisation war, gemeinwohlorientierte Funktionen abzuringen. Diesen Weg weiterzugehen, bedeutet, die Nabelschnüre des Kapitals und des militärisch-industriellen Komplexes Schritt für Schritt zu kappen und die frei werdenden Ressourcen in den Aufbau einer postkapitalistischen ökologischen Gesellschaft zu kanalisieren. Dazu gehört, wie wir in Teil II sehen werden, eine tiefgreifende Veränderung unserer ökonomischen Institutionen, ihrer Rechts- und Eigentumsformen.
Von Fabian Scheidler ist das Buch "Chaos: Das neue Zeitalter der Revolutionen" [2] im Promedia Verlag, Wien, erschienen, aus dem das in Telepolis veröffentlichte Kapitel stammt. 2015 erschien sein Buch 2015 erschien Fabian Scheidlers Buch "Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation" [3]. Scheidler ist ist Mitbegründer des unabhängigen Fernsehmagazins Kontext TV [4] und betreibt den Blog Revolutionen.org. [5]
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-3927880
Links in diesem Artikel:
[1] http://mediashop.at/buecher/chaos-2/
[2] http://mediashop.at/buecher/chaos-2/
[3] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGyL2j2KXYAhWO_qQKHVPRBm8QFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.megamaschine.org%2F&usg=AOvVaw38HWN6Ccze5Ah2mZ1xkFUY
[4] http://www.kontext-tv.de/
[5] http://www.revolutionen.org/
Copyright © 2017 Heise Medien