Geht die Welt eher unter als der Kapitalismus?
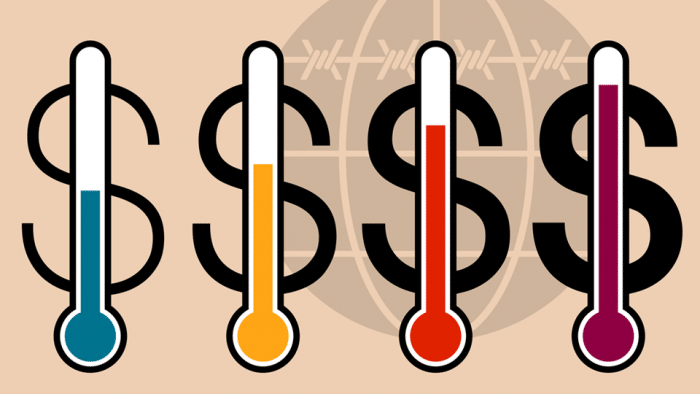
Die Grenzen des Wachstums werden spürbar. Dennoch fordert Olaf Scholz ein "klares Bekenntnis zum Wachstum" ein. Gibt es keinen Einspruch dagegen?
"Klare Bekenntnisse" von möglichen Koalitionspartnern zu fordern, das war 2021 Olaf Scholz’ Wahlkampftaktik, um die Linkspartei auszubooten: ein Bekenntnis zur Nato, aber auch zur Marktwirtschaft und zum Wachstum. Wozu man sich da "klar bekennen" soll, ist nicht weniger, als dass die Wirtschaft Jahr für Jahr um einige Prozent wachsen soll: eine exponentielle Progression.
Wie schnell das ins Unermessliche geht, lernt jeder im Matheunterricht. Wie soll das gut gehen, angesichts der mit der Wirtschaftstätigkeit verbundenen Treibhausgas-Emissionen und sonstigen Zerstörungen von Lebensgrundlagen?
Hat Olaf Scholz in der Schule nicht aufgepasst? So könnte man fragen, aber offenbar steht er damit nicht allein. Sonst hätten auch die Koalitionspartner einschließlich der Grünen in der Schule alle nicht aufgepasst, denn Wirtschaftswachstum ist im Koalitionsvertrag als vorrangiges Ziel festgeschrieben.
Überrascht hat das freilich niemand, denn man kannte es auch bisher nicht anders, als dass Wachstum als das A und O aller wirtschaftspolitischen Ziele gilt. Einerseits hat das Tradition, andererseits war schon immer klar, dass das angesichts endlicher Ressourcen nicht endlos weitergehen kann.
Nur: bisher wurden zwar von der Wissenschaft die Grenzen längst deutlich aufgezeigt, aber man war noch nicht am harten Anschlag angekommen – oder konnte es bisher verdrängen. Das ist inzwischen anders – aber dennoch wird weiter am Wachstum als politischem Ziel festgehalten.
Wirtschaftswachstum, so die verbreitete Auffassung, ist erfreulich, bedeutet es doch, dass mehr nützliche Dinge hergestellt werden. Freilich wird die Erwartung, das Wachstum würde das Leben der Mehrzahl der Leute verbessern, von den Politikern selbst regelmäßig dementiert: "überzogene" Ansprüche, insbesondere Lohnforderungen oder Sozialausgaben würden das Wachstum gefährden und müssen daher abgelehnt werden. Auf Deutsch: die arbeitende Bevölkerung hat für das Wachstum da zu sein, nicht umgekehrt.
Bedürfnisse sind ihrer stofflichen Natur nach endlich. Es gibt zwar eine Vielzahl verschiedener Bedürfnisse, aber jedes ist bestimmter, qualitativer Natur und kennt eine Sättigung. Neue Bedürfnisse zu erfinden und zu wecken, ist zwar der Wunschtraum manches Anlage suchenden Kapitals, stößt aber an Grenzen, nicht nur was den Geldbeutel der großen Mehrheit betrifft, sondern auch dessen, was sich bei gegebenem historischem Stand der Lebensumwelt in der verfügbaren Zeit überhaupt genießen lässt.
All der fragwürdige Schnickschnack, mit dem Gebrauchsgüter ausgestattet werden, um sie von der Konkurrenz abzuheben, legt ein Zeugnis von den Grenzen ab, an die die kapitalistische Güterproduktion stößt.
Man wird vielleicht einwenden, dass die vielfach präsentierten Luxusgüter einen gegenteiligen Eindruck allgemeiner Maßlosigkeit erwecken. Diese Maßlosigkeit ist jedoch keinen stofflichen Bedürfnissen - materieller oder kultureller Art - geschuldet, sondern ist durch die Geldform bedingt, die in unserer Gesellschaft jeglicher Reichtum annimmt.
Die Geldform abstrahiert von jeder qualitativen Bestimmtheit des Reichtums, es bleibt die reine Quantität. Als Kapital eingesetzt, wohnt dem Geld dementsprechend ein grenzenloser Drang zur Selbstvermehrung inne, aber auch den Konsumbedürfnissen verleiht die Geldform eine Tendenz zur Maßlosigkeit: Es geht nicht mehr nur um die Befriedigung stofflich bestimmter Bedürfnisse, sondern um die Demonstration der gesellschaftlichen Stellung: Luxusgüter werden von ihren Besitzern zur Schau gestellt, um zu zeigen, über welch große Geldmengen sie verfügen.
Um das Wohlergehen der Bevölkerung geht es beim Wachstum nicht
Das erinnert an Trophäen in Jagd und Krieg: Die im Kapitalismus vorherrschende Konkurrenz um Geld stellt einen Kampf aller gegen alle dar, und dementsprechend strebt jeder, sofern er sich mit diesem Kampf identifiziert, nach Trophäen, die seine Erfolge sichtbar machen. Es geht darum, damit anzugeben, dass man sich mehr leisten kann als andere; der eigentliche Zweck ist also nicht so sehr der sachliche Nutzen, sondern der Vergleich mit den anderen und ist deshalb mit keiner quantitativen Grenze zu befriedigen.
Wenn der Nachbar nachzieht, muss man selbst auch wieder eins drauflegen, eine endlose Spirale. So kommt es, dass die Größe manches Autos jedes durch praktischen Nutzen begründbare Maß überschreitet. Das ist jedoch, wie zuvor erwähnt, der in der Geldform des Reichtums in unserer Gesellschaft angelegten Maßlosigkeit geschuldet und widerspricht nicht der natürlichen Begrenztheit der Bedürfnisse.
Hierzu noch eine Anmerkung: Wenn als Ursache der ökologischen Misere die mangelnde Bereitschaft zu einem nachhaltigen Lebensstil ausgemacht wird, so wird dem Einwand, dass der Geldbeutel der meisten Leute da gar nicht so viel Spielraum lässt, oft mit dem Hinweis auf SUVs begegnet, die vor Discountern parken, während deren Besitzer sich dort mit Billigfleisch eindecken.
Mir ist bisher nicht aufgefallen, dass vor den Discountern überdurchschnittlich viele SUVs zu sehen wären, aber eines kann ich mir gut vorstellen: nämlich, dass manche Leute so viel Geld dafür ausgeben, mit einem SUV zu protzen, dass sie dann bei den Lebensmitteln sparen müssen.
Um das Wohlergehen der Bevölkerung geht es beim Wachstum nicht. Um was dann? Offenbar um etwas sehr Prinzipielles:
Wachstum ist nicht alles, aber ohne Wachstum ist alles nichts.
Angela Merkel, Rede auf dem Parteitag der CDU 2003
Moment mal: "ohne Wachstum" heißt, dass das Wirtschaftsvolumen auf dem Stand bleibt, auf dem es bereits ist. Wieso soll das nichts sein?
Wir haben eine rhetorische Figur vor uns, die nichts erklären will, sondern nur abrufen, was schon in den Köpfen drin ist. Was Merkel da voraussetzt, ist der Glaube an Segen und Notwendigkeit des Wirtschaftswachstums, der seine Unbedingtheit daraus bezieht, dass es bei ihm um nicht weniger geht als um die materiellen Grundlagen der staatlichen Macht im Kapitalismus. Ausgeführt wurde das in einem früheren Beitrag in Telepolis. Hier möchte ich zur Ergänzung Erhard Eppler zitieren, der als 85-jähriger Politikveteran zurückblickte:
Wo Wachstum zum übergeordneten, allgemein anerkannten Ziel der Politik wird, entstehen Abhängigkeiten. Denn das Wachstum ‚machen‘ ja nicht die Politiker, sondern die Unternehmen. Sie bei Laune zu halten, oder auch anzulocken, etwa durch niedrigere Steuern, wird notwendiger Bestandteil einer ‚Wachstumspolitik‘. So kam es zum ruinösen Wettbewerb der Staaten, auch der europäischen, um die niedrigsten Unternehmenssteuern, der mehr zur Staatsverschuldung beigetragen hat, als die meisten Ökonomen zugeben wollen. Der Staat musste ‚sparen‘, was praktisch hieß, dass er Aufgaben vernachlässigen oder privatisieren musste.
Eppler 2011, S. 178
Man kann die Frage stellen, ob es denn erst durch die Wachstumsideologie zum "ruinösen Wettbewerb der Staaten" gekommen ist, oder ob nicht umgekehrt dieser den Politikern aufdrängt, das Wachstum zum "allgemein anerkannten Ziel der Politik" zu machen. Das vorausgeschickt, liefert uns das Zitat jedoch eine Illustration zu den Zwängen, die im Kapitalismus mit dem Wachstum verbunden sind.
Kapitalismus = Wachstum = Treibhausgas
Es sind zwei Schlüsse, die zusammengenommen die Unausweichlichkeit der Klimakatastrophe im Kapitalismus belegen. Erstens: Kapitalismus geht nicht ohne Wachstum, und zweitens: Wachstum geht nicht ohne Steigerung der Treibhausgas-Emissionen.
Dementsprechend haben sich im Diskurs zwei Positionen herausgebildet, die die Rettung innerhalb des Kapitalismus als möglich behaupten: Erstens die Postwachstums-Ökonomie ("Kapitalismus ohne Wachstum ist möglich") und zweitens "green growth", auch "green deal" genannt ("Klimaneutrales Wachstum im Kapitalismus ist möglich").
Beiden Ansätzen wohnt ein prinzipieller Widerspruch inne: denn einerseits wäre es absurd, zu erwarten, dass der Kapitalismus plötzlich von sich aus anders verläuft als seit seinen Anfängen, nämlich ungebremst hin zur allgemeinen Naturzerstörung, insbesondere zur Klimakatastrophe, so dass andererseits klar ist, dass sich ohne gravierende steuernde Eingriffe in die Wirtschaft nichts daran ändern wird und sich die Frage stellt, was denn dann vom Kapitalismus eigentlich noch übrig bleibt, oder ob man nicht schon auf dem Weg zur Planwirtschaft ist, die diese Theoretiker doch vermeiden wollen wie der Teufel das Weihwasser.
Dem Green-growth-Konzept liegt noch ein weiterer Denkfehler zugrunde: Man geht erst einmal ganz abstrakt davon aus, dass Wachstum sein solle, und dann sucht man danach, was denn wachsen könnte, damit es in klimaverträglicher Weise geschähe.
Damit lässt man den Grund außer Acht, warum Wachstum sein soll, d.h., weshalb es für Wirtschaft und Staatsmacht so wichtig ist. Stattdessen gehen die Green-growth-Theoretiker ohne weiterzufragen davon aus, dass diese beiden wohl doch ganz disparaten Kriterien in Einklang miteinander stünden.
So ist etwa von Dienstleistungen, etwa in der Altenpflege die Rede: da fällt wenig CO₂ an – aber stärkt die Altenpflege die Staatsmacht? Nein, es ist mit ihr wie bei allen Sozialausgaben, nämlich dass sie, wenn es denn politisch gewollt wäre, also den Staatszwecken entspräche, schon immer hätten wachsen können, aber tatsächlich nur nach Maßgabe der bekannten "Sparzwänge" getätigt werden. Man kann also getrost davon ausgehen, dass überall dort, wo sich die Politik Green growth auf die Fahnen schreibt, nur Greenwashing herauskommt.
Es ist das Verdienst von Fridays for Future, die Klimakatastrophe ins allgemeine Bewusstsein gerückt zu haben. Bekannt waren die Fakten allerdings schon spätestens seit dem ersten Bericht des Club of Rome, 1972, und seitdem gab es auch Debatten über mögliche Auswege, die allerdings recht wenig öffentliche Beachtung fanden; nicht einmal die kapitalismusfreundlichen Varianten, die entlang von Green growth oder Postwachstums-Ökonomie argumentierten, fanden Gehör; zu sehr war die Politik allein darauf fixiert, der Logik des Systems zu folgen, also auf den Abgrund zuzurasen.
Als Beispiel für diesen wenig beachteten Diskurs kann auf Erhard Eppler als Vertreter des Green growth (von ihm "selektives Wachstum" genannt) und Niko Paech als Vertreter der Postwachstums-Ökonomie verwiesen werden.
Diese beiden Autoren haben 2016 ein Streitgespräch in Buchform veröffentlicht.1 Es bietet uns die Gelegenheit, ihre Standpunkte näher kennen zu lernen, wobei insbesondere ihre wechselseitige Kritik aufschlussreich ist. Deshalb wollen wir zum Abschluss einen Blick in dieses Buch werfen.
Ist eine Begrenzung des Wachstums realistisch?
Paech wendet gegen Green growth ein, dass die erforderliche CO₂-Reduktion – er nennt als Zahlen elf Tonnen pro Person und Jahr, die auf 2,7 Tonnen reduziert werden müssten (116) – mit einer wachsenden Wirtschaft nicht vereinbar sein könne, und dass zudem bei der Berechnung der Umwelt-Wirksamkeit "klimafreundlicher" Technologien Nebeneffekte, vornehmlich bei Produktion und Entsorgung, sowohl hinsichtlich des Klimas wie auch anderer Umweltschädigungen, regelmäßig ausgeklammert werden.
Eppler wiederum wirft Paechs Postwachstumstheorien mangelnden Realismus vor. Schon auf die Forderung, Werbung abzuschaffen, antwortet er
Ich würde sie vielleicht stärker besteuern. Schon das würde einen Aufstand hervorrufen! Das ist ja keine Kinderei, was Sie da vorhaben, Herr Paech, das wäre eine Revolution!
und führt sodann weiter aus:
Herr Paech: Die Frage, wie sich Ihre Konsum- und Wachstumskritik zu der Tatsache verhält, dass wir ein kapitalistisches System haben, kommt interessanterweise in Ihrem Buch überhaupt nicht vor; ebenso wenig die Tatsache, dass es eine mächtige Gruppe von Menschen und Unternehmen gibt, die dieses System mit Zähnen und Klauen verteidigen. […] Ich frage mich, warum reden Sie, Herr Paech, weder über Macht noch über Interessen?
In der Tat: die genannte "Konsum- und Wachstumskritik" nimmt den überwiegenden Teil von Paechs Theorie ein, ohne dass sie wirklich in Beziehung zum Kapitalverhältnis gesetzt würde. Andererseits tauchen die Wörter "Kapital", "Kapitalismus" oder "kapitalistisch" bei Paech keineswegs selten auf, aber stets so, dass es schwerfällt zu verstehen, was er damit genau meint. Sehen wir uns das an einem Beispiel an:
Ich unterscheide zwischen strukturellen und kulturellen Wachstumstreibern. Die erstgenannten rühren daher, dass die arbeitsteilige industrielle Produktion viel Kapital benötigt. Und Kapital kriege ich nur, wenn ich seinen Eignern ausreichende Renditen versprechen kann oder den Banken, falls ich das Geld von dort nehme, Zinsen zahle. […]
Diese angebotsseitigen Wachstumstreiber zu überwinden, würde meines Erachtens voraussetzen, dann eben auch Abschied von der industriellen, also kapitalabhängigen Produktionsweise zu nehmen. Aber dann schaffen wir keineswegs den Kapitalismus ab, sondern auch die Grundlagen des Wohlstands – was dann eben ertragen werden muss.
Also: die "industrielle Produktion benötigt viel Kapital". Zweifellos gehören große technische Produktionsanlagen zum Begriff der Industrie. Aber ist das dasselbe wie Kapital? Die ökonomische Form von Kapital, also eines zum Zweck der Selbstvermehrung, d.h. der Erzielung von Geldüberschüssen, eingesetzten Werts, nehmen die Produktionsmittel nur im Kapitalismus an.
Es ist weiter von den ökonomischen Begriffen Rendite, Bank, Geld, Zinsen ganz so die Rede, als wären sie ebenso naturgemäß, d.h. durch technologische Notwendigkeiten, mit der industriellen Produktion verbunden, wie dass man zur Stahlproduktion einen Hochofen braucht.
Wenn Paech dann von der "industriellen, also kapitalabhängigen Produktionsweise" spricht, wird vollends klar, dass für ihn der auf die Produktionstechnik bezogene Begriff Industrie und der rein ökonomische Begriff Kapital ineinander verschwimmen.
Der dann folgende Fehler im Satzbau ist ein Versehen, wie es jedem passieren kann; bemerkenswert ist im vorliegenden Fall allerdings, dass gar nicht klar ist, wie es korrekt heißen müsste. Ich habe lange nachgedacht, ob "keineswegs nur, sondern auch" oder "keineswegs …, sondern vielmehr" passend wäre, habe es aber aufgegeben, denn solange Paech nicht sagen kann, was er unter Kapitalismus versteht, macht es keinen Unterschied, ob er meint, dass dieser abgeschafft werden soll oder nicht.
Literatur
Eppler, Erhard 2011: "Selektives Wachstum und neuer Fortschritt" in "Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte" Heft 3, 2011, zitiert nach dem Abdruck in: Eppler / Paech 2016
Eppler, Erhard / Paech, Niko 2016: "Was Sie da vorhaben, wäre ja eine Revolution" München
Paech, Niko 2014: "Befreiung vom Überfluss – Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie" München
Fußnoten
[1] Eppler/Paech 2016, im folgenden nur mit Seitenzahl referenziert.