Humanitär töten
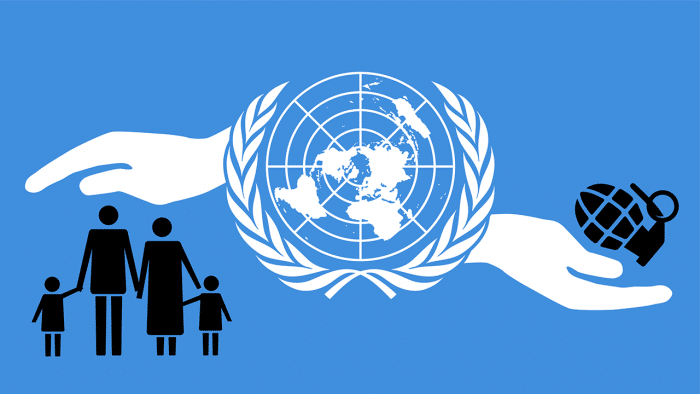
Anmerkungen zum Ukraine-Krieg und Schutzverantwortung: Eine völkerrechtliche Norm zur Eskalation von Krieg?
Russlands "Spezialoperation" in der Ukraine führte unversehens in einen Kriegszustand, der sich auch in Moskau nicht mehr ignorieren lässt. Doch nicht nur dort wird das K-Wort beharrlich vermieden: auch militärische Interventionen des Westens werden regelhaft als "Peacekeeping-Operationen" oder "Stabilisierungsmissionen" bezeichnet.
Die Invasion in die Ukraine legitimierte Putin mit Artikel 51,7 der UN-Charta – die einzige Ausnahme des Tötungsverbots im Völkerrecht und auch die Grundlage der Responsibility to Protect-Norm.
Die Doktrin zur militärischen Intervention folgt einer anderen Logik als ein klassischer bewaffneter Konflikt im Clausewitzschen Sinne, in dem es darum geht, dem Gegner gewaltsam den eigenen Willen aufzwingen: Es sind humanitäre Ziele, die verfolgt werden.
Ob Putin die westliche Werte-Rhetorik nur verhöhnt oder ob in der Ost-Ukraine Nazismus und Verbrechen gegen die Menschlichkeit den Einsatz militärischer Gewalt rechtfertigen – diese Einschätzung wird Aufgabe künftiger Historiker sein. Berichte über Kriegsverbrechen liegen jedenfalls inzwischen für die russische wie auch die ukrainische Seite vor [1].
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bemüht in seinen Forderungen nach einer humanitären, militärischen Intervention dieselbe Argumentationsfigur. Der Krieg hat ihn binnen Wochen vom Staatsmann zum Freiheitskämpfer gemacht: Er tritt im khakifarbenen T-Shirt auf, unrasiert, mit Flagge.
Beinahe täglich bittet er die Welt um militärische Unterstützung, um sein Volk vor der russischen Aggression zu retten. Er klagt an, er appelliert an globale Hilfspflichten und betont, westliche Werte würden in diesem Augenblick in der Ukraine verteidigt.
Selenskyj braucht Waffen, eine Flugverbotszone, Flugzeuge und Luftabwehrsysteme. Außerdem härtere Sanktionen und die Bestrafung aller noch amtierenden russischen Politiker, bis die Aggression aufhöre. Immer wieder bekräftigen die von ihm adressierten Staats- und Regierungschefs, dass sie nicht militärisch eingreifen werden.
Zugleich erklärt der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, dass der Schutz der ukrainischen Zivilbevölkerung oberste Priorität habe. Nun endlich verspricht US-Präsident Joe Biden Waffenlieferungen.
Ist es richtig, Waffen an verzweifelte Ukrainer zu liefern, zum Schutz der Zivilbevölkerung? Da die Erfolgsaussichten der militärischen Selbstverteidigung der Ukraine realiter einem Himmelfahrtskommando gleichen, fragt dieser Artikel aus menschenrechtlicher Perspektive und dem Prinzip der Schutzverantwortung, ob eine Kriegsbeteiligung des Westens gerechtfertigt und notwendig ist.
Die Pflicht, zur Rettung ukrainischer Bürger Krieg zu führen, wird derzeit oft in Analogie zur individuellen Nothilfe begründet, wozu jeder nach seinen Fähigkeiten und unter Abschätzung der Eigengefährdung verpflichtet ist. Doch die "Bully on the Playground"-Phrase bewegt sich auf der Ebene individueller Moral.
Ist es moralisch geboten, in den Krieg zu ziehen?
Humanitäre Militärinterventionen berühren hingegen Fragen politischer Ethik. Ist ein Staat überhaupt berechtigt, seine Soldaten – Bürger in Uniform – dazu zu verpflichten, für den Schutz "anderer" zu töten und dabei den eigenen Tod zu riskieren? Wer eine Interventionspflicht verficht, setzt voraus, es sei moralisch geboten, zu töten, um zu retten – und zwar nicht nur Kriegsverbrecher, sondern auch an Verbrechen unbeteiligte Soldaten und Nichtkombattanten, deren Tod als Kollateralschaden in Kauf genommen wird.
Das völkerrechtliche Responsibility to Protect-Prinzip (R2P) hat den Diskurs über den humanitär motivierten Einsatz militärischer Gewalt verändert: Im Falle schwerster Menschenrechtsverletzungen ist nicht mehr die Intervention begründungspflichtig, sondern der Verzicht darauf. Diese Entwicklung begünstigte einen Moralismus, der die Dilemmata humanitär begründeter Kriegsbeteiligung tendenziell ignoriert.
Notwendig ist indes eine ethische Bewertung, die dem vielschichtigen Problem einer menschenrechtlich begründeten Militärintervention bzw. einer Kriegsbeteiligung des Westens gerecht wird.
Das Thema von Menschenrechten im Krieg ist ein recht junges Phänomen. Als Begleiterscheinung des Staatszerfalls in den 1990er-Jahren brach mit den "Neuen Kriegen" eine Ära innerstaatlicher Bürgerkriege an, in die sich West und Ost zwar einmischten, aber niemals mit einem eigenen hohen Risiko. In diesen Kriegen galten völkerrechtliche Regeln, humanitäre Rücksichten, der Schutz für Zivilisten, Verwundete und Gefangene nichts mehr.
Um die Jahrtausendwende dann wandelten sich Kriege, in die sich der Westen involvierte: Es gab eigentlich keine Feinde auf Augenhöhe mehr. Zur staatenübergreifenden "Achse des Bösen" zählten die Sonderschüler und Sitzenbleiber der Weltgeschichte: Neben der Bekämpfung (oder Unterstützung) von Terroristen und Rebellen wie etwa den Taliban gedachte der Westen ihnen Vernunft, Werte und Zivilisiertheit beizubringen.
Zugleich verflochten sich in der Ära der Menschenrechte Moral, Recht und Politik immer enger. Um der Entwicklung einer zunehmenden Moralisierung des Kriegsrechts und dem Entstehen einer humanitären Ethik Rechnung zu tragen, wurden Veränderungen des humanitären Rechts, das im Krieg Anwendung findet, erforderlich. Mit dem Kosovo-Krieg entbrannte die Diskussion um Legalität und Legitimität humanitärer Interventionen.
Die R2P entstand als Reaktion auf die Ereignisse im Kosovo, in Somalia und die Völkermorde in Ruanda und Srebrenica.
Im Dezember 2001 veröffentlichte eine internationale Kommission (ICISS) einen Bericht über die Möglichkeiten und Grenzen humanitärer Militärinterventionen: The Responsibility to Protect. Schnell fand R2P als normatives Prinzip Eingang in politische, ethische und völkerrechtliche Diskurse. Das Neue daran war, dass das Recht diskutiert wurde, militärische Gewalt einzusetzen, um Menschen zu schützen, deren Leib und Leben in anderen Staaten bedroht ist.
Am Ende leidet die Zivilbevölkerung
Die Schutzverantwortung der Staatengemeinschaft hat vor allem Konsequenzen für die Zivilbevölkerung. Gegen die klassischen Proportionalitätserwägungen des Kriegsvölkerrechts (die den Tod und die Verletzung Unbeteiligter einkalkulieren) wurden nun Menschenrechte zur Legitimation einer militärischen Intervention aufgewogen. Anders als zuvor standen nicht nationale Eigeninteressen im Vordergrund – die wohlmeinend-optimistisch formulierten Ziele der R2P-Norm waren humanitärer Art.
Auf dem UN-Weltgipfel 2005 verkündete der damalige Generalsekretär der UNO, Kofi Annan, dass die Welt "eine kollektive Verantwortung übernommen habe und bereit sei, Gewalt anzuwenden, um Bevölkerungen vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit" zu schützen.
Die internationale Staatengemeinschaft habe zwar nicht rechtlich, jedoch moralisch eine subsidiäre Verantwortung, massenhafte und massive Menschenrechtsverletzungen, notfalls auch mit militärischer Gewalt zu stoppen.
Im Kern von R2P liegt eine Neuinterpretation des Souveränitätsbegriffs – Souveränität wurde nonchalant nicht mehr als Kontrolle über Territorium verstanden, sondern als Verantwortlichkeit. Die menschenrechtlichen Grundnormen, die das Verständnis legitimer staatlicher Gewalt – und damit das Verständnis von Souveränität – veränderten, sind das Recht auf Leben, das Verbot von Folter und Sklaverei und das Verbot der Diskriminierung.
Sie gehören völkerrechtlich zum zwingenden Recht, das keine Abweichungen erlaubt (ius cogens) und das überdies der gesamten Staatengemeinschaft und anderen Völkerrechtssubjekten geschuldet wird (erga omnes). Daraus ergibt sich ein Eingriffsrecht bei Verletzung fundamentaler Menschenrechte.
Zum ius cogens gehört allerdings auch das Gewaltverbot, von dem einzig die individuelle und kollektive Verteidigung nach Artikel 51 der UN-Charta ausgenommen ist. Aufgrund des Gewaltverbots ist eine militärische Intervention nur dann erlaubt, wenn der UN-Sicherheitsrat einhellig Zwangsmaßnahmen nach Kapitel sieben autorisiert.
Und jetzt? Ist die viel gepriesene "Schutzverantwortung" der UN nichts als ein leeres Versprechen? Nun sind die Kriterien für eine legitime Intervention hoch angesetzt: ein gerechtfertigter Grund, rechte Absicht, Ultima Ratio, Proportionalität und vernünftige Erfolgsaussichten müssen erfüllt sein. Die Kriterien haben ihren Ursprung in der Bellum-Iustum-Auffassung, an die während der 1990er-Jahre in der Debatte um "humanitäre Interventionen" angeknüpft wurde.
Die R2P-Norm verhinderte seit ihrer Verabschiedung 2005 noch nie Gräueltaten und sie versagt auch jetzt beim Schutz von Zivilisten in der Ukraine. Schlimmer noch: Die Anrufung von R2P, die die Regierungsvorsitzenden der Ukraine und Russland gleichermaßen betreiben, trägt zur Konflikteskalation und Festigung von Feindbildern bei. Die Kombination aus beidem erhöht bekanntlich die Tötungsbereitschaft.
"Responsibility to Protect" hat auch Friedensgesellschaften verändert
Etwas hat die Norm auch in den westlich-demokratischen Friedensgesellschaften verändert: "Responsibility to Protect" sei eine neue internationale Verhaltensnorm, "für deren Verletzung sich die meisten Staaten schämen, oder sich zumindest schämen, sie zu ignorieren" (Gareth Evans, Global Centre for the Responsibility to Protect, 2020).
Gewollt war ein Bewusstseinswandel, hin zu "einer reflexhaften internationalen Reaktion, dass massenhafte Verbrechen, die stattfinden oder bevorstehen, alle und nicht niemanden etwas angehen" (The New York Times vom 11.3.2012). Die humanitär motivierte Schutzverantwortung der Vereinten Nationen bleibt vor allem ein politisch-moralisches Konzept.
Dass dato in der Bundesrepublik aus dieser moralischen Pflicht zur Betroffenheit und emotionalen Involviertheit sogar die Pflicht zur Parteinahme geworden ist, aus der niemand vom Unterstufenschüler bis zur Opernsängerin entlassen wird, könnte eine verstörende Begleiterscheinung sein.
Das Postulat der Verpflichtung zu menschenrechtlich begründeten militärischen Interventionen ist eine Argumentationsfigur des "liberalen" Paradigmas internationaler Politik.
Responsibility to Protect ist einer liberalen kosmopolitischen Moral verpflichtet, die staatliche Grenzen gering achtet und transnationale Verpflichtungen zwischen Individuen in den Mittelpunkt stellt. Denn R2P postuliert faktisch eine allgemeine Verpflichtung, überall auf der Welt, notfalls mit militärischen Mitteln, schwere Gewalttaten zu unterbinden und im Dienst der Humanität Krieg zu führen, wenn sich dadurch schlimme Übel beenden lassen.
Dagegen besteht aus Sicht der "realistischen Denkschule" Verantwortung zuallererst in der Durchsetzung nationaler Interessen. Eigene Staatsbürger zur Rettung anderer in den Krieg zu schicken, ohne dass grundlegende nationale Interessen auf dem Spiel stehen, ist aus dieser Sicht moralisch verantwortungslos. Eine globale militärische Hilfspflicht steht im Widerspruch zu dem "Vertrag", den Soldaten mit ihrer Gesellschaft schließen: dass sie notfalls ihr Leben für deren Interessen opfern.
Ein weiteres Dilemma ist, dass humanitäre Militärinterventionen mit dem Ziel, Menschenleben zu retten, oft als kurzzeitige Operationen zu geringen eigenen Kosten dargestellt werden. In der Praxis können sie jedoch kaum erfolgreich sein, weil Menschenrechtsverletzungen in einem Kontext geschehen, der eine dauerhafte Befriedung erfordert (unter anderem mit einer Gesetzgebung zum Schutz von Minderheiten in der Ukraine, einer Friedensordnung, und Wiederaufbau). Insbesondere nach einem Regimewechsel ist mit langfristiger gewalthaltiger Instabilität zu rechnen.
Die Moralisierung des Völkerrechts durch R2P hat nicht zu unterschätzende Auswirkungen auf die internationale Debatte zur Kriegsbeteiligung in der Ukraine. Im Sinne einer Bewertung mit dem Prinzip R2P sind Kriegsbeihilfen wie Waffenlieferungen auch in dieser für alle Ukrainer furchtbaren Situation menschenrechtlich nicht zu rechtfertigen.
Die notwendigen Kriterien – Proportionalität und Erfolgsaussichten – werden nicht erfüllt. Die menschlichen Kosten einer solchen Unterstützung sind im Vergleich zum Nutzen unverhältnismäßig groß und es ist unwahrscheinlich, dass die angestrebten humanitären Ziele erreicht werden. Nicht nur Selenskij blendet Probleme der Umsetzung, ungünstige Erfolgsaussichten und vor allem die Folgenverantwortung aus.
Die Situation ist zum Verzweifeln zynisch: Ist die Zivilbevölkerung akut gefährdet, bemisst sich die Zulässigkeit von Kriegshandlungen allein nach dem Humanitätsgebot. Das bedeutet im Regelfall, dass Kriegshandlungen unterlassen werden müssen.
Dem Westen bleibt derzeit nur das pragmatische Kalkül, dass die Sanktionen funktionieren werden und die Regierung in Moskau bröckelt – das wird dauern und es werden mehr Menschen sterben. Um den Aggressor in die Knie zu zwingen, muss der Krieg weitergehen – ergo werden Waffen geliefert.
Es wäre integrer und ehrlicher, den verzweifelten Ukrainern keine falsche Hoffnung mehr zu machen. Daran sollte sich als Erstes auch Selenskij beteiligen, indem er die von ihm verhängte Ausreisesperre für Männer zwischen 18 und 60 aufhebt.
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-6604017
Links in diesem Artikel:
[1] https://www.amnesty.de/2014/9/10/amnesty-international-spricht-erstmals-von-einem-internationalen-bewaffneten-konflikt-der-
Copyright © 2022 Heise Medien