"Impfpflicht wird genauso wie in Österreich scheitern"

Matthias Schrappe über das die Impfpflichtdebatte, effektive Pandemiebekämpfung und die Folgen von zwei Krisenjahren
Herr Schrappe, die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist nun da, Gesundheitsämter winken, geht es um die Kontrollen, aber ab. Was soll das alles bringen?
Matthias Schrappe: Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist die erste Vorbotin einer sich obrigkeitsstaatlich gerierenden Steurung der Epidemie. Sie wird zu einer weiteren Polarisierung und außerdem zu erheblichen Versorgungsstörungen führen.
In Frankreich haben sich zwei Prozent der im Gesundheitswesen Beschäftigten, rund 15.000 Personen, von ihrer Arbeit abgewandt, das wäre in unserer angespannten Personalsituation eine Katastrophe.
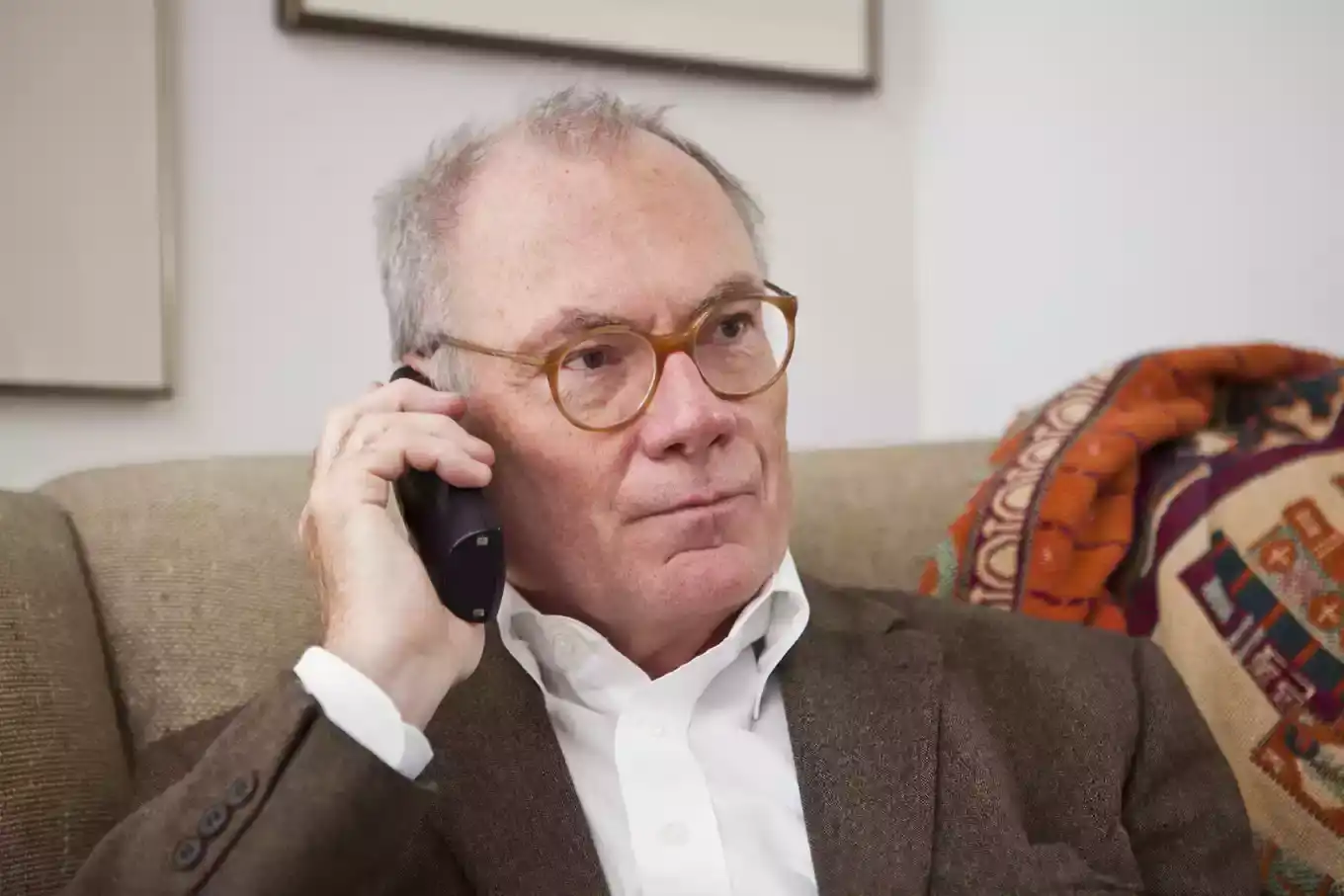
Matthias Schrappe ist emeritierter Professor für Innere Medizin. Von 2007 bis 2011 war er stellvertretender Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung im Gesundheitswesen.
Moralisierende Argumente sind nicht hilfreich, stattdessen wäre ein zugehendes Vorgehen und verlässlichere Erfassung der Nebenwirkungen in einer Form, die Vertrauen schafft, sinnvoll.
Gerade Gesundheitsexperten sehen sehr wohl, dass bei den Impfnebenwirkungen der ursächliche Zusammenhang zwischen Ereignis und Impfung in Zweifel gezogen wird, während es uns zum Beispiel bei der Sterblichkeit an Corona seit zwei Jahren nicht möglich ist, zwischen Tod "an" oder "mit" Corona zu unterscheiden – hier spielt die Ursache augenscheinlich keine Rolle.
Wie ist Ihre Prognose für die allgemeine Impfpflicht in der Bundesrepublik? In Österreich wurde sie ja gerade wieder kassiert.
Matthias Schrappe: Die Impfpflicht wird genauso wie in Österreich scheitern. Das Konzept ist unausgegoren und weder hinsichtlich Eignung, Notwendigkeit noch Verhältnismäßigkeit zu begründen.
Ein Konzept mit solchen Defiziten kann in einer intakten Gesellschaft niemals Wirklichkeit werden, man kann nicht gegen solche fundamentalen gesellschaftlichen Grundsätze regieren.
Dennoch scheinen zahlreiche meisten Abgeordneten im Bundestag an der allgemeinen Impfpflicht festzuhalten. Halten Sie sie für prinzipientreu oder unflexibel?
Matthias Schrappe: Ich denke, viele der Abgeordneten können ohne Gesichtsverlust nicht zurück. Sie haben nicht die Kraft einzugestehen, dass sie sich auf den Holzweg begeben haben. Anders ist es nicht zu erklären – was aber ein Riesenproblem darstellt.
Warum ein starres Pandemiemanagement scheitert
Sie haben schon früh einen Schutz vulnerabler Gruppen vorgeschlagen, statt allgemeine Schutzmaßnahmen einzuführen. Inwieweit hat diese ja nicht nur von Ihnen erhobene Forderung gefruchtet?
Matthias Schrappe: Kaum. Weil etwa die Physikerin und ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Protokoll gegeben hat, es ginge nicht. Experten, die mit der Kontrolle von epidemischen Lagen praktische und wissenschaftliche Erfahrung haben – und nicht nur im Labor beziehungsweise am Computer sitzen –, wurden nicht gefragt.
Die wissen aber, dass ein differenziertes Vorgehen hinsichtlich der Empfänglichkeit den Kern jeder erfolgreichen Kontrolle von Epidemien darstellt. Stattdessen haben wir mit dem undifferenzierten Holzhammer der alleinigen Kontaktbeschränkung gearbeitet, meist einsetzend, wenn die betreffende Welle schon vorbei war.
Inzidenzzahlen, R-Wert, ITS-Auslastung, Testzahlen … Woran sollen wir uns im dritten Corona-Frühjahr und dem schon von Weitem drohenden dritten Corona-Herbst orientieren?
Matthias Schrappe: Vor allem muss man auf zuverlässig zu erhebende Zahlen Bezug nehmen. Wenn wir pro Woche zwei Millionen. Personen testen, wenn wir in 40 Prozent dieser Fälle einen positiven Befund erhalten und den dann auf die Gesamtbevölkerung umrechnen, dann fragt sich doch, welche Zahlen wir erhalten hätten, wenn wir z.B. noch zusätzliche zwei Millionen getestet hätten.
Das heißt?
Matthias Schrappe: Dass die verwendeten Zahlen Makulatur sind. Und zweitens ist es für Experten glasklar, dass man komplexe Prozesse wie Epidemien nur durch Scores, also durch mehrere Kennzahlen gleichzeitig steuern kann. Hierzu haben wir immer wieder Vorschläge gemacht.
Herr Schrappe, was sind Ihre drei Erkenntnisse nach zwei Pandemiejahren?
Matthias Schrappe: Erstens: Der biologische Krankheitsbegriff und die patientenferne Grundlagenforschung triumphieren, soziale Aspekte der Epidemie, der Präventionsmöglichkeiten werden nicht berücksichtigt. Die Epidemie wird zu einem reinen "Virus-Geschehen" gemacht, ohne auf die gesellschaftlichen Aspekte und Folgen zu schauen.
Zweitens verhärtet sich eine lineare Top-down-Sichtweise politischer Steuerung, bedauerlicherweise gerade vonseiten des linken politischen Spektrums. Man vertraut nicht auf die dezentralen gesellschaftlichen Kräfte und übersieht die Komplexität einer epidemischen Situation.
Drittens ist es zu einer erschreckenden Einengung der Diskursfähigkeit der Gesellschaft gekommen, die bis in "die" Wissenschaft reicht und unsere Kompetenz zur Lösung problematischer Krisensituationen enorm gefährdet.
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-6587319
Copyright © 2022 Heise Medien