Pandemie des Wahnsinns
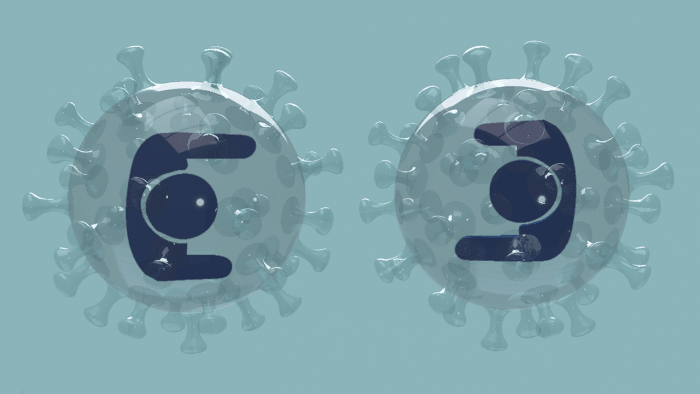
Was ein Virus mit uns macht - Ein Kommentar
Mit der Coronawelle geht auch eine beispiellose Solidaritätswelle einher. Ganze Gemeinden schließen sich zusammen und helfen einander. Für besonders Bedürftige werden Einkaufshilfen und andere Hilfsdienste bereitgestellt. Viele Betriebe stellen auf die Produktion von Schutzausrüstung um. Jeder wird zum Wohltäter. Es scheint, als würde uns die Coronakrise nun endlich zu der viel beschworenen Wertegemeinschaft zusammenschweißen, die das Wohl des Nächsten hochhält und den bisher allseits präsenten kollektiven Egoismus doch noch vertreibt. Doch diese Krise zeichnet auch ein erschreckendes Bild.
Der Blick auf die Straßen erfüllt derzeit mit Trostlosigkeit. Ein Gefühl beklemmender Enge macht sich breit. Und das obwohl der Frühling endlich angekommen scheint: Die Sonne lacht, der Himmel ist blau. Vogelgezwitscher überall. Und dennoch schwindet dieses leise Unbehagen nicht. Etwas stimmt nicht, man fühlt es. Eigentlich wollte man nach draußen gehen, um die blühende Wiederkunft der Natur zu bestaunen. Dann bricht eine monotone Sprachansage auf den Straßen die Behaglichkeit des Gedankenausschweifs. Man wird dazu aufgefordert, zuhause zu bleiben und nur aus schwerwiegenden Gründen nach draußen zu gehen. Und schlagartig besinnt man sich, woher das beklemmende Gefühl stammt.
So dürfte es derzeit nicht Wenigen gehen, die aufgrund der Notlage diese kollektive Zwangspause einlegen müssen. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Im Gegenteil, die Maßnahmen nehmen ein immer drakonischeres Maß an. Man hofft die Infektionsketten damit endlich zu durchbrechen und die vielzitierte "Kurve" flachzuhalten. Die sanitären Strukturen sollen entlastet, eine Simultaninfektion zu vieler Menschen möglichst vermieden werden.
Die Strategie macht Sinn - für die Meisten jedenfalls. Man hält sich weitgehend an die Regeln. Es geht ja schließlich um das Wohl der Allgemeinheit. Die vielen Initiativen zur gegenseitigen Hilfe in dieser schwierigen Zeit sind löblich - keine Frage. Es scheint als förderte die Krise das Edelste im Menschen zutage. Solidarität, Hilfsbereitschaft und unbescholtener Altruismus stehen hoch im Kurs. Wer hätte das gedacht.
Doch der nunmehr rare Gang durch die Straßen offenbart auch ein ganz anderes Bild. Von den wenigen Leuten, denen man noch bei ihren täglichen Besorgungen begegnet, wird man streng inspiziert. Dann wird der Blick gesenkt und in sicherem Bogen vorbeigegangen. Oder man wechselt gleich die Straßenseite, denn jeder ist dieser Tage eine potenzielle Gefahr.
Hat man keinen Mundschutz oder zumindest eine Einkaufstasche bei der Hand, dann hält der Blick des Gegenübers länger. Verlegen sucht man das Weite. Doch auch von den Terrassen und Balkonen der Häuser zieht man derweilen scheele Blicke auf sich, hat man die gebotenen Requisiten gerade nicht zur Hand. Man flüchtet ins eigene Heim. Dort fühlt man sich sicher - sicher vor dem Virus und sicher vor dem Argwohn der Menschen.
Die Mehrheit, so scheint es jedenfalls, findet den politischen Rigorismus gut
Wir befinden uns in einer Krise. Daran zweifeln mittlerweile die Wenigsten. Wodurch die Krise jedoch ausgelöst wurde, darüber kann man derzeit nur spekulieren. Die naheliegendste Antwort ist: durch das Virus. Doch auch Misswirtschaft, organisatorische Mängel, ärztlicher Personalmangel, medizinische Ressourcenknappheit und versäumtes Agieren werden oft erwogen. Vermutlich liegt die Wahrheit - wie gemeinhin üblich - in der Kombination daraus. Doch sicher ist: Schuldzuweisungen sind jetzt fehl am Platz. Für die Debatte um das "Wieso und Warum" wird es im Nachhinein noch reichlich Gelegenheit geben.
Der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk konstatiert, die große Krise erkenne man daran, dass eine Gesellschaft freiwillig monothematisch werde. Wer wollte diesen Befund angesichts der derzeitigen Lage noch leugnen?
Sloterdijk hatte diesen Indikator in Zusammenhang mit der Flüchtlingsdebatte genannt. Nun trifft er auf Corona zu. Das Coronavirus ist allgegenwärtig - es ist in unserem Gegenüber, in der Luft, in der Presse und in unserem Verstand. Es beherrscht den täglichen Diskurs. Doch auch dieser ist inzwischen vergiftet. Die Mehrheit, so scheint es jedenfalls, findet den politischen Rigorismus gut. Auch viele Medien kolportieren den Alarmismus und stärken der politischen Führung den Rücken - auch das war nicht immer so.
Die sozialen Netzwerke strotzen vor Tweets, die die Ausweitung sozialer Restriktionen als nahezu heroisch zelebrieren. Jene, die die Regeln brechen, werden harsch gescholten. Auch das ist typisch für die Krise. Man sucht nach Schuldigen, einen Sündenbock, denn das Virus ist unsichtbar.
Debatten darüber verlaufen emotional. Man wird auch schnell mal persönlich, wenn es nicht gelingt, den Anderen zu überzeugen. Widerspruch duldet man nur ungern und wenn, dann in sehr begrenztem Maße.
Der behördlichen Obrigkeit kann das nur recht sein. Man ist sichtlich bemüht, die öffentliche Meinung gleichzuschalten, zu kontrollieren. Denn so ist es leichter, auch unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen, soviel steht fest.
Wer das nicht gut findet, sagt es meist still. Man flüstert oder sagt es nur im engsten Kreise. Die neutrale sachgerechte Debatte findet nicht mehr statt. Das Motiv der kooperativen Wahrheitssuche wird zurückgestellt, das Prinzip des "zwanglosen Zwangs des besseren Arguments" devalidiert.
All dies geschehe jedoch im Dienste eines honorablen Zwecks - so die gängige Rechtfertigung.
Denunziantentum und Obrigkeitstreue
Doch abseits der zahlreichen Posts und Solidaritätsbekundungen, welche Zusammenhalt und Gemeinschaftsgefühl predigen, manifestiert sich auch eine weitere Kehrseite. Als überwunden gegoltene Mechanismen flammen wieder auf. Denunziantentum und Obrigkeitstreue prosperieren - Verhältnisse, auf deren Überwindung man gerade in Europa, dem Spross aufklärerischer Werte und Ideale, zurecht stolz war.
In Italien nimmt die Beliebtheit des Premierministers trotz immer härterer Maßnahmen zu. Was vor Kurzem noch bei vielen ein Gefühl konsternierter Empörung provoziert hätte, erscheint nun tugendhaft. In regelmäßigen Abständen richtet Conte ergreifende Appelle an das italienische Volk. Er plädiert für Nächstenliebe und Vernunft aber auch Gehorsam und Disziplin werden eingefordert - das beeindruckt.
Die Italiener lieben das Pathos. Dafür sind sie berüchtigt. Das dürfte mitunter ein Grund dafür sein, dass Contes Gala-Rhetorik so gut ankommt. Personen- und Freiheitsrechte werden für ein gemeinsames ehrbares Ziel aufgegeben. Mehr noch, der Freiheitsentzug wird phrenetisch gefeiert, ja regelrecht herbeigesehnt.
Würde man den Hintergrund nicht kennen, vor dem diese Suspension von Grundrechten stattfindet, könnte man glauben, das italienische Volk habe den Verstand verloren. In Unkenntnis der Umstände erinnern solche Szenen beinahe an die "Stunde der Idiotie" im Berliner Sportpalast von 1943. Damals hatte der NS-Propagandaminister unter den Jubelschreien einer hysterischen Masse den totalen Krieg ausgerufen. Doch bis heute gilt dieser Moment für viele Deutsche als gedankliches Mahnmal - wie weit es kommen kann und wie gefährlich die Mixtur aus devoter Hörigkeit, übersteigertem Zusammengehörigkeitsgefühl, einem gemeinsamen Ziel und pathetischer Rhetorik sein kann.
Freilich, der Vergleich mag zynisch, womöglich für Manche sogar anrüchig wirken. Doch lässt sich nicht leugnen, dass manche der angewandten Maßnahmen durchaus den Repressalien totalitärer Systeme gleichen. Man bedient sich altbewährter Methoden, um die Masse in Schach zu halten: Es werden immer strengere Kontrollen durchgeführt, die Ausgangssperren werden verschärft. Wer gegen die Regeln verstößt, dem drohen bis zu 12 Jahre Gefängnis. Man entsendet Drohnen und Hubschrauber, um mögliche Ausreiser auszuforschen. Bewegungsprofile werden erstellt und das Smart Phone überwacht. Militärkonvois patrouillieren an den Grenzen der Länder und Gemeinden. Ein kollektiver Isolationismus hat sich breit gemacht. Zustände, die man sonst aus China oder Nordkorea kennt, und die George Orwell in seinem dystopischen Roman "1984" eindrucksvoll skizziert hat, sind nun bei uns Realität.
Doch wie ist so etwas in einer modernen aufgeklärten Gesellschaft überhaupt möglich?
Der Staat lotet die Grenzen der Demokratie aus
Auch hierüber kann nur gemutmaßt werden. Sicher ist, die derzeitige Lage affiziert basale Urinstinkte des Menschen. Das Gefühl von Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins weckt im Menschen ein starkes Bedürfnis nach Schutz und Obhut. Bei bestehenden Bedrohungen wird dieses Verlangen zumeist noch intensiviert. Und wird die Angst zu groß, schlägt sie in Panik um. Vernunft und Weitsicht schwinden, Kontrollverlust und Desorientierung gewinnen peu à peu an Boden.
Auch derzeit zeichnet sich ein solches Bedrohungsszenario ab. Man fühlt sich bedroht von einem unsichtbaren Feind, einem Feind, der sich rasend schnell ausbreitet und viele Todesopfer fordert.
In dieser Notlage ist man auch bereit Grundrechte über Bord zu werfen und alles zu tun was notwendig ist, um in diesem Kampf zu bestehen. Man überlässt das Denken dann den Anderen. Die Entscheidung, was nun das Beste ist, wird dankbar delegiert.
Eine sachliche mediale Aufklärung ist gerade auch nicht leicht zu haben. Quasi im Minutentakt wird das Netz mit neuen Beiträgen überflutet. Das Filtern so vieler Informationen ist keine leichte Aufgabe. So käme es wohl kaum überraschend, wenn Viele angesichts der enormen Datenflut schon resigniert hätten. Auch das spielt den Regierenden in die Hände und hilft bei der Ausweitung unbequemer Maßnahmen.
Klar, dieser Zustand wird nicht ewig dauern, da ist man sich einig. Keiner glaubt, dass leidlich liberale Demokratien durch die derzeit vorherrschenden Restriktionen ernsthaft in Gefahr sind. Zu stark sind Humanismus und Aufklärung in unserer Gesellschaft konsolidiert. Und doch ist es verblüffend, wie schnell eine Gesellschaft bereit ist, ihre Freiheiten gegen Sicherheit einzutauschen, wenn sie sich bedroht und hilflos fühlt.
Schockrisiko, Datenfiasko und wirtschaftlicher Kollaps
Dennoch birgt das zeitweilige Akzeptieren solcher Zwangsmaßnahmen eine latente Gefahr, die nicht undurchschaut bleiben sollte: Der Staat hat die Grenzen der Demokratie nun ausgelotet. Er weiß nun, wie weit er gehen kann, wenn der Anlass edel und die Gefahr nur groß genug ist. Dies einzuschätzen liegt jedoch in seinem Ermessen. So sollte man sich stets gewahr sein: Wenn die Grenzen der Verantwortung verschwimmen und der Damm Gefahr läuft zu brechen, ist Vorsicht angesagt. Daher wird man in Zukunft gut beraten sein, das Motiv der Außerkraftsetzung der Grundrechte sorgfältig zu begutachten ehe man ihr stattgibt.
Derzeit jedenfalls, könnte das Motiv wohl gediegener kaum sein. Das Leben und die Gesundheit vieler Menschen stehen auf dem Spiel. Wer wollte hier noch auf seine Freiheitsrechte pochen, wenn er mit dem Verzicht darauf Menschenleben retten kann? Wer wollte es derzeit wagen, ökonomisches Kalkül über die höchsten menschlichen Güter überhaupt zu stellen? So jedenfalls sehen es die Meisten.
Dass Solidarität und Mitgefühl trotz großer Entbehrungen so stark präsent sind, ist durchaus löblich und lässt Viele staunen. Damit sei nun doch bewiesen, dass der Mensch im Gegensatz zum Tier nicht rohen Instinkten folgt, sondern dem vernünftigen Gesetz der Moral. Doch ist das wirklich so?
Als Zyniker könnte man die unbequeme Frage stellen, wo dieser kollektive Solidarismus denn vor der derzeitigen Krise blieb? Wo war und bleibt die Solidarität angesichts der humanen Katastrophen in Idlib, Kos und Lesbos? Wo die Empörung angesichts der Zustände an der griechisch-türkischen Grenze? Was tut man gegen die Luftverschmutzung, die jährlich 400.000 Menschen allein in Europa und 4.5 Millionen weltweit das Leben kostet und was gegen die chronische Unterernährung, die im Schnitt alle 10 Sekunden ein Kind und 25.000 Menschen täglich tötet?
Diese Beispiele zeigen, dass der Mensch die Verantwortung gemeinhin dann abwälzt, wenn er sich nicht unmittelbar bedroht fühlt. Die Gefahr wird dann als weit weg und als nicht unmittelbar empfunden.
Der Mensch reagiert auf nahe und unmittelbare Geschehnisse weit drastischer. Die Psychologie spricht von sogenannten "Schockrisiken". Gemeint sind Situationen, in denen viele Menschen in einem kurzen Zeitraum sterben. Das trifft sicherlich auch auf die jetzige Krise zu. Schockrisiken suggerieren deshalb häufig eine größere Gefahr als tatsächlich vorhanden. Ob das auch bei der Corona-Pandemie der Fall ist, weiß derzeit niemand. Es spricht viel dafür, dass die Nähe und Unmittelbarkeit einer Gefahr dabei sehr stark an das subjektive Empfinden gekoppelt sind. Anders ließe sich nicht erklären, weshalb die 25.000 Grippetoten in Italien im Winter 2016/17 keine vergleichbare Panik hervorriefen und nicht Anlass boten, Menschen mit Ausgangssperren zu belegen.
Die Angst vor dem Coronavirus dürfte wohl auch daherkommen, dass aufgrund seiner Neuartigkeit noch zu wenige Zahlen vorliegen, um seine tatsächliche Gefährlichkeit verlässlich einzuschätzen. Es ist auch diesem "Datenfiasko" geschuldet, dass man die Verhältnismäßigkeit der strengen Schutzmaßnahmen nicht recht zu bewerten weiß. Wie gefährlich Sars-coV2 wirklich ist, wird man vermutlich erst hinterher sagen können. Derzeit liegt die Fallsterblichkeit bekanntlich zwischen 3-4%, was hoch ist. Die Dunkelziffer der asymptomatisch Infizierten dürfte jedoch weitaus höher ausfallen, was die tatsächliche Sterblichkeitsrate deutlichen senken würde. Bisher scheint jedoch auch zwischen Experten noch Uneinigkeit zu herrschen.
Doch schon jetzt ist klar, dass sich der ökonomische Kollaps wohl kaum mehr abwenden lassen wird. Der Stillstand des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens wird sich vermutlich als weit verheerender erweisen als die Folgen des Virus selbst. Und da diesmal auch die Produktion von Gütern betroffen ist, wird es zu noch nachhaltigeren Folgen kommen als in den Krisen von 1929 und 2008. Neben dem Nachfrageschock wird es einen Angebotsschock geben und auch Überbrückungskredite können dann nicht helfen. Denn steht die Produktion erstmal still, ist das Angebot am Markt dementsprechend gering. Selbst wenn Geldmittel vorhanden wären, kann damit nichts erworben werden. Was das für die Bevölkerung hieße, bedarf keines weiteren Zusatzes.
Sollte die rigorose Einschränkung des öffentlichen Lebens noch länger anhalten, dann könnte das Virus vermutlich auch länger kursieren, zumal die Durchseuchungsrate niedrig bleiben und eine Immunisierung nur langsam voranschreiten würde. Eine zweite Welle wäre dann ebenso nicht ausgeschlossen. Das gilt selbstverständlich unter dem Vorbehalt, dass kein wirksames Medikament und Impfstoff vor Jahresende gefunden werden.
Laut Modellen werden dank strengster Maßnahmen zwar weniger Menschen sterben, aber die soziale und wirtschaftliche Stagnation könnte sich bis weit ins Jahr 2021 hineinerstrecken. Die Folgen wären fatal - und bei weitem nicht "nur" wirtschaftlicher Natur.
Bereits jetzt ist die Frustrationstoleranz in der Bevölkerung stark strapaziert. Auch Zukunftsängste nehmen zu. Bald könnten Massenarbeitslosigkeit, Konkurs und Existenzverlust bittere Realität werden und die bisher obwaltende Solidarität könnte, zumal sich immer mehr Menschen ihrer eigenen prekären wirtschaftliche Lage bewusst werden, bald zu brechen drohen. Spätestens dann wird es fraglich, ob die bisherige plakative Darstellung "Gesundheit vs. Wirtschaft" die derzeitige Lage richtig widerspiegelt.
Diese Darstellung in Frage zu stellen ist weder unerhört noch anstößig, denn Eines dürfte klar sein: Beim Unterbinden des wirtschlichen Kollapses geht es nicht um die Profitgier und das wirtschaftliche Reüssieren der gesellschaftlichen Elite, sondern um das nackte Überleben vieler Millionen Bürgerinnen und Bürger. Zumal die volle Tragweite der ökonomischen Folgen noch nicht sichtbar und der totale Kollaps noch nicht erfolgt sind, bleiben diese Gefahren jedoch meist im Hintergrund.
Die allseits gefürchtete und oft bescholtene Abwägung von Leben gegen Leben ist wohlgemerkt kein rein hypothetisches Schreckensszenario, sondern schon längst nüchterne Realität. Ohne Zweifel ist niemand zu beneiden, der solche Entscheidungen treffen muss. Moralische Dilemmata sind per definitionem stets mit Nachtteilen für die ein oder andere Partei verbunden. Doch was tun? Wie entscheiden? Wen bevorzugen? Viele oder Wenige?
In vielen überlasteten Krankenhäusern ist es bereits jetzt gängige Praxis aufgrund von Ressourcenknappheit, nur noch jene Patienten zu versorgen, denen gute Überlebenschancen zugebilligt werden. Jüngere werden Älteren und Gesunde werden stark Vorerkrankten vorgezogen.
Philosophische Ethik
Ob das moralisch akzeptabel ist, wird von Ethikern unterschiedlich bewertet, je nachdem welcher ethischen Tradition er anhängt. Der Konsequentialist bewertet die Folgen, während der Kantianer dies ablehnt. Stattdessen hat er die unmittelbare Handlung im Blick.
Kant lehnt die Verrechnung von Leben aufgrund des Instrumentalisierungsverbotes und der unbedingten Achtung der menschlichen Würde bekanntlich ab. Deshalb muss Kant auch moralische Dilemmasituationen ablehnen und zwar eo ipso. Dies provozierte die merkwürdige Konsequenz, dass ein Arzt - wäre er Kantianer - weder den älteren noch den jüngeren Patienten mit lebenserhaltenden Maßnahmen versorgen dürfte. Er fände sich buchstäblich in einer entscheidungstheoretischen Buridan-Situation vor. Das Ergebnis wäre zutiefst kontraintuitiv, denn beide müssten sterben.
Bei der moralischen Bewertung der Ausgangssperre ist Kant in ähnlicher Bredouille. Zumal er stets die Handlung per se und niemals deren Folgen bewerten kann, zieht ein Bruch der Ausgangsregel lediglich die Bewertung des "Aus-dem-Haus-gehens" nach sich. Und es liegt auf der Hand, dass es für Kant moralisch nicht verwerflich sein kann, das eigene Haus zu verlassen und seinen tagtäglichen Aktivitäten nachzugehen. Es handelt sich hier wohlgemerkt nicht um irgendeinen technischen Kniff, sondern ergibt sich ganz klar aus Kants deontologischen Ethik. Dass die Konsequenzen einer Handlung von Kant partout nicht bewertet werden, möge sie auch noch so absehbar sein, wird in seinem Aufsatz "Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen" noch deutlicher.
Dass Utilitaristen in moralisch dilemmatischen Situationen wesentlich agiler sind bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein rationales Nutzenkalkül stets zu moralisch akzeptablen Entscheidungen führt. Im Gegenteil wäre eine Gesellschaft, die ihre soziale Praxis lediglich auf das Ziel der Nutzenmaximierung ausrichtet, weidlich inhuman. Doch wie soll die derzeitige Situation dann moralische eingeschätzt werden?
Letztlich wird es eine politische Ermessenfrage sein, wie lange und inwieweit der ökonomische und soziale Lockdown einer Gesellschaft zugemutet werden kann. Um eine Abwägung "Leben gegen Leben" wird man, je länger die Krise andauert, wohl kaum noch herumkommen. Denn "auch der wirtschaftliche und soziale Kollaps produziert Tote".
Gleich wie Sloterdijk die Erkennungsmerkmale einer großen Krise treffend expliziert hat, so lässt sich bei ihm ein weitere Maxime finden, die gut auf die jetzige Situation zu passen scheint. Sloterdijk konstatiert nämlich, dass es keine moralische Pflicht zur (gesellschaftlichen) Selbstzerstörung geben könne. Welche Maßnahmen einer Gesellschaft am Ende abträglicher sein werden wird sich zeigen.
Man darf jedenfalls gespannt sein, wie die Lage sich entwickeln wird, sollten sich die ökonomischen Drohszenarien bewahrheiten. Denn erst dann wird sich zeigen, ob die derzeit vorherrschende Hypermoral zugunsten echter Solidarität weichen wird. Einer Solidarität, wie sie derzeit Ärzte, Pfleger und freiwillige Helfer erkennen lassen - die wahren Helden dieser Krise. Doch aus dem Munde jener, die gerade aggressiven Moralismus betreiben und in panischen Hortungskäufen um Toilettenpapier feilschen, klingt die Rede von echter Solidarität nur allzu unredlich.
Bleibt nur zu hoffen, dass der Mensch aus dieser Krise lernen wird. Doch leider hat uns die Erfahrung Gegenteiliges gelehrt.
Über den Autor: Valentin Widmann hat Geschichte und Philosophie an der Universität Wien und Innsbruck studiert. Daneben studierte er an der Karl-Franzens-Universität in Graz "Political, Economic and Legal Philosophy (PELP)". Seine Masterarbeit "Die Aktualität des aristotelischen Seelenbegriffes" für die moderne Körper-Geist-Debatte verfasste er im Bereich der analytischen Philosophie des Geistes. Er war drei Jahre lang Lehrer für Geschichte und Philosophie am Humanistischen Gymnasium "Walther von der Vogelweide" in Bozen und arbeitet nun an Forschungsprojekten zur Humanismus-Transhumanismus-Debatte und zur Thematik "KI und Ethik".
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
