Wie die Regionen die Erde retten können
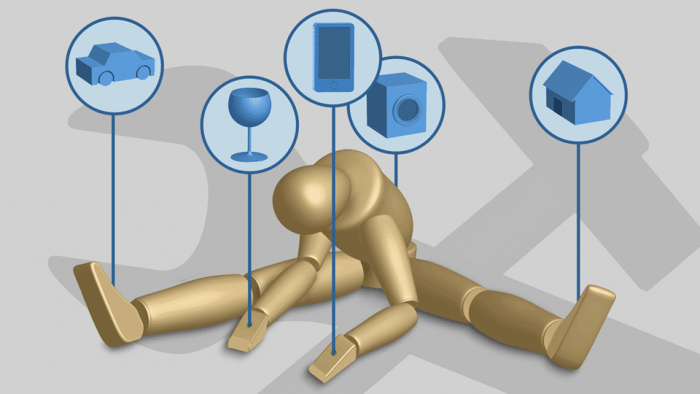
Die Zweifel an der Vereinbarkeit von Nachhaltigkeitszielen und Wirtschaftswachstum nehmen zu. Es ist Zeit, Lösungswege aufzuzeigen
Ist ein Festhalten am stetigen Wirtschaftswachstum eine nachhaltige Option? Die Idee eines "Grünen Kapitalismus" – in der EU im "European Green Deal [1]" beschrieben –, der besonders das Ziel der Klimaneutralität vorgibt, als auch weitere wertvolle Nachhaltigkeitsziele gemäß EU-Taxonomie-Verordnung [2] (u.a. Schutz der Meere, Kreislaufwirtschaft, Verringerung der Umweltverschmutzung, Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme) darf zumindest hinsichtlich der Realisierbarkeit unter den Prämissen von Wirtschaftswachstum, globaler Wettbewerbsfähigkeit und hohen Profitzielen angezweifelt werden.
Was aber geschieht, wenn diese Ziele Wirtschaftswachstum entgegenstehen? Ist dann zu befürchten, dass Nachhaltigkeitsziele nicht erreicht werden und der Ressourcenverbrauch nicht nachhaltig vom Wirtschaftswachstum entkoppelt werden kann?
Könnte es also sein, dass der "Grüne Kapitalismus" trotz einiger wichtiger Transformationen ein neuer Weg zum Machterhalt des Kapitals ist und die Zeche, wie bislang, Steuerzahler und Arbeitnehmer zahlen? Steckt dahinter etwa im Bereich der Mobilität die Idee, satte Gewinne anstelle von Autos mit Verbrennermotor, künftig mit E-Autos zu erzielen und die Probleme des immer noch drastischen Ressourcenverbrauchs – Woher kommen die Mengen an zusätzlich benötigten Metallen [3]? – unter den Tisch fallen zu lassen, weil sich Gewinne mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs und einer Reduktion an Individualverkehr nicht erzielen lassen? All das kann befürchtet werden.
Kann es dennoch möglich sein, Gesellschaft und Wirtschaft so umzubauen, dass Steuerzahler und Arbeitnehmer nicht auf der Strecke bleiben und alle "ein schönes Leben" haben? Dass Nachhaltigkeitsziele dennoch erreicht werden? Mit der Befreiung vom Zwang zum Wirtschaftswachstum und ungebremsten Profitstreben sollte eine Chance darauf bestehen.
Weniger produzieren, weniger konkurrieren, weniger konsumieren, weniger Ressourcen verbrauchen – und trotzdem besser leben?
Die 1970er-Jahre in der DDR, an die ich mich noch ganz gut erinnern kann, mit ihrem damals sehr geringen Produktivitätsniveau zeigen, dass trotz aller Mängel, Beschränkungen, ökologischen Problemen und fehlenden Freiheiten ein gut grundgesichertes Leben garantiert war.
Ein warmes Dach über dem Kopf, anständige Krankenversorgung, gute Schulbildung, kulturelle Angebote und ausreichend Einkommen wenigstens für ein nicht luxuriöses Leben – all das gab es. Ohne die damaligen Einschränkungen der Freiheit oder die damaligen ökologischen Probleme schönzureden, muss bilanziert werden: Ein ansonsten gar nicht so schlechtes Leben mit weniger Produktion, Konsum und Konkurrenz ist zumindest möglich.
Daraus ergibt sich die Frage, welche Möglichkeiten eines besseren Lebens bei gleichzeitiger Reduktion des Ressourcenverbrauchs angesichts deutlicher Produktivitätssteigerungen möglich sein können, wenn Zwänge für Wirtschaftswachstum und Profitmaximierung beseitigt werden?
Ungerechtigkeit mit Umverteilung bekämpfen
Ansätze, wie der Zwang zu Wirtschaftswachstum und Profitmaximierung beseitigt werden kann.
Zuerst ist sicher die Umverteilung anzugehen. In Deutschland etwa besitzt das vermögendste eine Prozent der Bevölkerung mehr Vermögen als 87,1 Prozent der erwachsenen Bevölkerung [4] am unteren Ende der Skala.
Vermögen sind nicht nur ungerecht, sie sind auch unnötig und schädlich, denn sie suchen nach Wachstums- und Anlagemöglichkeiten, um sich zu mehren. Hierzu dient u.a. die Finanzindustrie, sie bedroht Steuerzahler und Kreditnehmer mit Spekulation und toxischen Finanzprodukten.
Mit riesigen Geldmengen, deren Gegenwert in der Realwirtschaft längst nicht mehr existiert [5], drängt die Finanzindustrie in reale Anlagemöglichkeiten. Dabei hat sie eine Privatisierung in Bereichen der Daseinsvorsorge angestoßen, die bekannte Folgen wie den profitorientierten Umbau unseres Gesundheitswesens zur Folge hatte.
Der Journalist Werner Rügemer hat diesen Umbau in einem Telepolis-Interview [6] anschaulich beschrieben.
Um das Thema Verteilungsgerechtigkeit anzugehen, müssten drastische und länderübergreifend gleiche Besteuerungen von Vermögen, Gewinnen und sehr hohen Einkommen her. Hier kann etwa an die Spitzensteuersätze in den USA vor den 1980er-Jahren angeknüpft werden, der in den 1960er-Jahren sogar über 90 Prozent lag [7].
Die damaligen Reichen haben es überlebt. Es ist gut nachvollziehbar, dass solche Maßnahme hierzulande enormen Widerstand erzeugen würden. Denn die Armut der einen besteht im Zwang, sich für geringe Entlohnung verdingen zu müssen, um Reichtum und Luxus der anderen zu erzeugen.
Weitere sinnvolle Maßnahmen wären die Begrenzung von Jahreseinkommen auf eine Dimension von 500.000 Euro und die Kopplung des Maximaleinkommens an ein überschaubares Vielfaches des Mindestlohns.
Gesetzt den Fall, dass der Wachstumszwang beseitigt wäre, welche Möglichkeiten würden sich auftun, den Ressourcenverbrauch zu verringern? Die Regionalisierung von Wirtschaftskreisläufen und Stoffströmen wäre eine bedeutende Maßnahme.
Gigantische Transporte von Rohstoffen, Halbfertigprodukten und Waren quer über unseren Planeten sind an der Tagesordnung und offenbaren ökologische Probleme als auch verletzliche Lieferketten. Hinzu kommen enorme regionale Unterschiede hinsichtlich Wirtschaftskraft, Arbeitsplatzangeboten und Wohlstand.
Starke Wohlstandsgefälle führen zur Migration und einem Ausbluten von ärmeren Regionen durch den Weggang von Fachkräften und Jungen. Es muss als schäbig bezeichnet werden, wenn sich einige in Deutschland Pflegekräfte aus Osteuropa leisten können, die hier mit nahezu 24-stündiger Verfügbarkeit sieben Tage die Woche Bedürftige pflegen und zu Hause schwer pflegebedürftige eigene Eltern zurücklassen.
Solche Zustände sind inakzeptabel, daher müssen alle Regionen eine Chance erhalten, ohne einen nicht zu bewältigenden Konkurrenzdruck eigene resiliente regionale Wirtschaftsstrukturen und eine eigene funktionierende Daseinsvorsorge aufzubauen. Das geht nur mit begrenztem Wettbewerb.
Weniger Wettbewerb ist nötig
An die Stelle der globalen Konkurrenz muss ein solidarisches System der Zusammenarbeit treten, das auf die negativen Folgen von Konkurrenzdruck Rücksicht nimmt. Die Forderungen der EU nach mehr Wettbewerbsfähigkeit gehen dabei in die falsche Richtung, sie zielen auf Überlegenheit und nicht auf ausgewogenen Handel, sondern gewinnbringenden Export und günstigen Import von Rohstoffen.
Hier ist ein massiver Systemfehler in unserer EU. Wir brauchen keine EU, die eine immer mehr durchsetzungsfähige Macht beim Zugang zu Ressourcen und Märkten wird. Themen der EU sollte eher die Stärkung der Regionen, ein verstärkter Technologieaustausch und besonders die Vermeidung eines ruinösen Steuerdumpingwettbewerbs sein.
Überregionaler Handel ist nicht verzichtbar, aber er verbleibt dort, wo eine sinnvolle Eigenproduktion nicht möglich ist. Interessante Ansätze für eine Regionalisierung finden sich in einem Strategiepapier des Wuppertal Instituts (Global kooperative Regionalwirtschaften für Wohlstand und Resilienz) vom Oktober 2020 [8].
Ein wichtiger Vorteil einer gelungenen Regionalisierung weltweit wäre auch die Abnahme des Migrationsdrucks. In Regionen geringen Wohlstands würde dem weiteren Ausbluten an Jungen und Fachkräften entgegengewirkt, in Regionen, die Ziel von Migration sind, würde die Zufuhr von auch lohndrückenden Billiglohnkräften verringert werden.
Der österreichische Autor Hannes Hofbauer beschreibt in seinem Buch Kritik der Migration anschaulich diese Hintergründe.
Aktuell ist über vielfältige Mechanismen wie Handelsabkommen ein Schutz nationaler und regionaler Wirtschaftsgebiete nicht möglich. So wird sichergestellt, dass viele Staaten und Regionen keine nachhaltigen Wirtschaftsstrukturen aufbauen. Sie sind gezwungen, ihre Bodenschätze, meist kaum veredelt, den in puncto Effizienz überlegenen und zum Teil mit Subventionen gestützten Exportnationen als Handelsware im Tausch gegen die Waren anzubieten, die nicht selbst produziert können.
Diese Abkommen müssen beseitigt werden. Eine gelungene Regionalisierung würde auch den Wettbewerb um Zugang zu Märkten und Rohstoffen, der sich zwischen den großen Machtblöcken aktuell verschärft und militärische Auseinandersetzungen wahrscheinlicher macht, deutlich verringern.
Es gibt Ansätze, die wir zur Stärkung von Regionalstrukturen jetzt schon angehen können. Der einfachste Weg ist der bewusste Konsum von regional hergestellten Produkten. In Supermärkten wird erfreulicherweise mehr und mehr regionale Ware gekennzeichnet und beworben.
Darüber hinaus könnte der Bezug von Waren über lange Transportwege, die problemlos regional bezogen werden können, mit lenkungswirkenden Abgaben belegt werden, um regionale Produktion anzukurbeln.
Kampf dem Überfluss und dem Ramsch
Es ist unübersehbar, in welchem Umfang unnötig konsumiert wird. Ramsch, der gezielt für das Ankurbeln des Umsatzes produziert wird, ist allgegenwärtig. Besonders ausgeprägt ist das im Bereich der Modeindustrie. Greenpeace beschreibt das abgesichert mit verschiedenen Belegen in dem Artikel "Konsumkollaps durch Fast Fashion [9]".
Demnach hat sich die Bekleidungsproduktion zwischen den Jahren 2000 und 2014 verdoppelt. Deutsche Verbraucher kaufen im Schnitt 60 Kleidungsstücke pro Jahr – tragen diese allerdings nur noch halb so lang wie vor 15 Jahren.
Aber nicht nur im Bereich der Bekleidungsindustrie werden so wertvolle Ressourcen vergeudet und unsere Umwelt belastet sowie vermüllt. Ein Black Friday macht das besonders sichtbar und ist für unsere Umwelt, unter anderem durch Retouren und Vernichtung von Retourenwaren, ein wirklich rabenschwarzer Tag. Hier können Regelungen geschaffen werden, die dieser Ressourcenverschwendung entgegenwirken.
Neben dem Verzicht auf kurzlebige und unnötige Produkte ist eine Verringerung von unnötigem Besitz an ressourcenintensiven Produkten wichtig. So können z.B. ein gut ausgebauter ÖPNV, attraktive Fahrradwege sowie Miet- und Share-Angebote unnötige Mengen an Kfz verringern und genau das vermeiden, was von der Autoindustrie angestrebt wird: die Verbrenner-Kfz eins zu eins durch E-Autos zu ersetzen.
Auch wenn E-Autos, verglichen mit Verbrennern, hinsichtlich des Energie- und Ressourcenverbrauchs besser abschneiden, können die Umweltprobleme der Auto- und Batterieproduktion nicht vernachlässigt werden.
Überfällig sind Regelungen zu Produktvorgaben, die die Möglichkeiten zum Reparieren, Wiederverwenden und Recycling verbessern. Hier hätten längst weitergehende Vorgaben umgesetzt werden können, statt beim Status quo zu verbleiben.
Aber sollten all diese Maßnahmen erfolgreich sein: Wie können wir mit der vermiedenen Produktion und damit verlorenen Erwerbsmöglichkeiten umgehen?
Eine Reduktion der Produktion zieht Verlust an Einkommen nach sich. Die Bevölkerung wird sich zu Recht fragen, wovon sie künftig ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen. Der Übergang in eine "Neue Welt" kann nur in einem geplanten und zeitlich ausreichenden Übergangsprozess realisiert werden. Ansonsten drohen Chaos und Scheitern.
Wie kann der Verlust an Erwerbsmöglichkeiten ausgeglichen werden? In verschiedenen Bereichen können Beschäftigungsmöglichkeiten massiv ausgebaut werden, z.B. in Pflege, Forschung, Bildung, Kultur, nachhaltiger Energieerzeugung, ÖPNV, ökologischer Landwirtschaft, nachhaltiges Bauen, Ausbau der Kreislaufwirtschaft,
Möglich wäre die Instandhaltung und Verbesserung unserer Infrastruktur – etwa des Katastrophenschutzes – und generell der Daseinsvorsorge. Zusätzlich kann Arbeitszeit reduziert werden, auch vor dem Hintergrund weiterer Möglichkeiten der Automatisierung und Digitalisierung, wenn wir sie nicht nur zum einseitigen Vorteil der Arbeitgeber einsetzen. Die Verringerung unnötiger Arbeit und stattdessen mehr sinnvolles Handeln: Wäre das nicht ein schönes Ziel?
Wie wird das alles finanziert?
- Deutlich höhere Besteuerung von Spitzengehältern, Vermögen und Gewinnen. Unterhalb einer Jahresgehaltsgrenze von rund 250.000 Euro muss die Besteuerung angemessen bleiben, um Anreize zu schaffen, Verantwortung zu übernehmen, etwa durch Ärzte sowie Fachkräfte mit besonderen Qualifikationen und Fertigkeiten.
- Schließen von Steueroasen und Steuerschlupflöchern (z.B. Cum-Ex-Geschäfte).
- Rückfahren von Rüstungsausgaben.
- Streichung von Subventionen für nicht nachhaltige Produktion.
- Umstrukturierung der Banken, ihr Zweck muss dem nachhaltigen (regionalen) Wirtschaften und der Sicherung der Daseinsvorsorge dienen.
- Börsen sind so zu regulieren und einzuhegen, damit keine wirtschaftlichen Verwerfungen durch Spekulation und toxische Finanzprodukte mehr möglich sind.
Zusammenfassung
Jeglicher Ansatz am Ziel des Wirtschaftswachstums etwas zu ändern, wird von den Herrschenden derzeit verhindert und verächtlich gemacht. Armeen von Thinktanks wissen ganz genau, warum es keine Alternative gibt.
Aber es kann möglich sein, eine nachhaltige Welt mit starken und kooperierenden Regionen zu schaffen, wenn Globalisierung und Kapitalismus stark genug reguliert und eingehegt werden.
Eine Graswurzelbewegung, die dieses Ziel verfolgt, ist nötig.
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-6359170
Links in diesem Artikel:
[1] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852
[3] https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Resource-demand-drive-systems.pdf
[4] https://www.dgb.de/themen/++co++37dffeb0-5bc3-11eb-ac48-001a4a160123,S.71
[5] https://www.finanzwende-recherche.de/unsere-themen/der-finanzsektor-ist-zu-gross/
[6] https://www.heise.de/tp/features/Die-Corona-Krise-und-die-Privatisierung-des-Gesundheitssystems-6000417.html?seite=all
[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Einkommensteuer_(Vereinigte_Staaten
[8] https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/7635/file/ZI11_Lieferketten.pdf
[9] https://greenwire.greenpeace.de/system/files/2019-04/s01951_greenpeace_report_konsumkollaps_fast_fashion.pdf
Copyright © 2022 Heise Medien