Wie unsere Städte für Katastrophen anfällig wurden
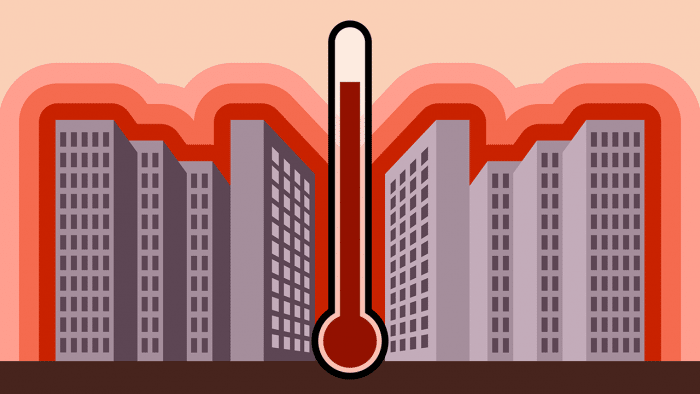
Moderne Städte überhitzen und werden Opfer verheerender Fluten. Dabei war man in Siedlungen einst auf klimatische Extreme eingestellt. Betrachtungen über die Stadt, die Hitze und die Architektur.
In den Seminaren von Niklas Luhmann in Bielefeld in den 1980er-Jahren spielten Zwergkängurus eine bedeutende Rolle. Sie waren das Paradigma, an dem sich schulen musste, wer von der modernen Gesellschaft etwas verstehen wollte.
Denn diese Tiere wiesen ein eigentümliches Sozialverhalten auf. Ließ sich doch beobachten, dass es unter den still vor sich hin grasenden Tieren gelegentlich und ohne erkennbaren Anlass zu großen Aufregungen und Prügeleien kommt, die sich gefährlich steigern, bis sich plötzlich wie auf Kommando alle Tiere in eine Reihe setzten und für eine Weile in dieselbe Richtung schauen.
Daraufhin beruhigen sich die Tiere und grasen wieder still vor sich hin. Luhmann erklärte, offensichtlich würden sich die Tiere durch eine Synchronisation ihrer Umweltwahrnehmung unter Ausschluss von Sozialwahrnehmung beruhigen. Alle sehen dasselbe, ein Stück Wiese, ein paar Büsche. Und da alle nebeneinandersitzen, sehen sie nicht sich selbst. Sie schauen sich nicht an und haben deswegen auch keinen Grund mehr, sich aufzuregen.
Der Klimawandel konfrontiert die moderne Gesellschaft mit einem strukturell ähnlichen Problem. Solange alle Mitglieder der Gesellschaft in dieselbe Richtung schauen, gibt es keinen Grund, daran zu zweifeln, dass dringend etwas getan werden muss, um den Ausstoß an Treibhausgasen drastisch zu reduzieren.
Aber die Präferenz für bloß schnelle Effekte, die Existenz vielerlei Interessengegensätze und die unheilige Allianz von Industriegesellschaft und Ausbeutung fossiler, nicht erneuerbarer Energien spricht dann eher für helle Aufregung und nutzlose Reibereien.
Dabei liegt es doch eigentlich auf der Hand, welche Sprengkraft das Thema mittlerweile in sich birgt. War das Wetter die längste Zeit nur für Leute interessant, die im Freien arbeiten und ihren Lebensunterhalt mit Ackerbau und Viehzucht bestreiten, so hat sich das fundamental geändert. Seit 20 Jahren sind weder Himmel noch Erde, was sie zuvor gewesen waren.
Heute ist jedes Satellitenbild eine öffentliche Angelegenheit, eine Nachricht: die neueste Momentaufnahme in der Lebensgeschichte unseres Planeten. Holzschnittartig gesagt: Die Durchschnittstemperaturen steigen weiter; die so genannten Starkregenereignisse werden zunehmen und es wird, verstärkt noch durch die Bautätigkeit des Menschen, öfter zu Hochwasser kommen. Es wäre naiv, anzunehmen, dies bliebe ohne Konsequenzen für Architektur, Städtebau, Freiraumplanung.
Dass sich Dörfer und Landschaften durch Solarzellendächer verändert haben, dass feingliedrige Altbaufenster den robusten und luftdichten und wärmeschützenden Glasentwicklungen der einschlägigen Industrie weichen mussten, dass Stück um Stück Häuser dick und dicht verpackt werden: All dies sind dabei lediglich Teilaspekte.
Denn die klimatische Perspektive wirkt als Elementarisierung, sie ist die Sichtbarmachung einer kreatürlichen Situation. Das Klima erweist sich als eine Art "Ort", an dem die künstlichen, von Naturwissenschaft und Technik generierten Bilder unmittelbar auf das Lebensgefühl der Zeitgenossen durchgreifen.
Städte kühlen nicht mehr ab
Exemplarisch sei hier ein Aspekt adressiert, der namentlich in den Städten zu Buche schlägt – die Hitzeperioden: In vielen Quartieren kühlt die Luft nachts nicht mehr ab. Während im Umland an einem sehr heißen Sommertag gegen Mitternacht die Temperatur auf, sagen wir, 18 Grad sinkt, verharrt sie in den dicht bebauten Innenstädten bei 28 Grad.
Und dieses Problem verschärft sich, weil die Hitzewellen nicht mehr bloß zwei bis drei Tage dauern, sondern Wochen. Wenn es nachts während der Ruhephase heiß bleibt, fehlt die Erholung – und das kann vor allem für alte und kranke Menschen tödliche Folgen haben.
Lösungsansätze dafür sind bekannt: mehr Grün, mehr Wasserflächen, Erhalt und Ausbau der Frischluftkorridore, um dem Aufheizen der Metropolen entgegenzuwirken und die kühle Luft aus dem Umland ins Urbane zu leiten. Doch das Freihalten von sogenannten Kaltluftschneisen, das heißt, größeren zusammenhängenden Grünräumen, die sich weit in die Stadt hinein verzweigen, steht unter enormen Konkurrenzdruck durch andere Nutzungen (aktuell etwa für den Wohnungsbau).
Seit unsere Vorfahren die Höhlen verlassen haben, um Ackerbau und Viehzucht zu betreiben, lernten sie durch Versuch und Irrtum, wie sich ihre Wohnstätten verbessern lassen. Bereits im Neolithikum sicherten sich die Jäger und Bauern gegen Überschwemmungen und Schneemassen mit Pfahlbausiedlungen.
In heißen Gebieten entwickelten die Baumeister Verfahren, kühlende Luftzirkulation im Haus zu befördern, wie 1799 bei dem berühmten "Palast der Winde" im indischen Jaipur, wo der Luftaustausch durch 1.000 kleine Fenster in der Fassade den Haremsdamen des Maharadschas den Fächer ersparte.

Und die Eskimos mit ihren Iglus wussten bereits vor Tausenden von Jahren, dass die Kugel die Form mit der geringsten Oberfläche bei größtem Volumen ist und damit am besten geeignet, Wärmeverluste zu minimieren.
Griechische Inseln sind beliebte Reiseziele, und ihre Städte bieten beeindruckende Postkartenmotive. Das strahlende Weiß der Häuser hat einen besonderen Grund: Die Farbe reflektiert Sonnenenergie, sodass Oberflächen nicht aufheizen und es auch in Innenräumen kühl bleibt.
Heute werden Dächer und Straßen in Athen und sogar in Los Angeles, New York und Ahmedabad weiß gestrichen, um die Auswirkungen zukünftiger Hitzewellen abzumildern und den CO₂-Ausstoß zu senken, der durch die Nutzung von Klimaanlagen erzeugt wird.
Auch grüne Dächer können Temperaturen reduzieren, doch ist ihr Potenzial abhängig von einigen Faktoren, die nicht immer gewährleistet sind. Sie benötigen ausreichend Bewässerung, eine geringe Luftfeuchtigkeit und stetigen Luftwechsel. Zudem ist ein begrüntes Dach wesentlich teurer als ein reflektierendes.
In der Mittelmeerregion gibt es traditionell einfache Methoden der Kühlung durch natürliche Luftzirkulation. Es handelt sich um die Tradition der Innenhöfe, die noch heute in den südspanischen Regionen, vornehmlich in alten Patrizierpalästen, lebendig ist.
Kluge Erfindungen des Bauerbes wurden vergessen
Dass sich in diesen Regionen die Bauweise so gut erhalten hat, ist den 500 Jahren maurischer Kolonialherrschaft geschuldet, die auch die Architektur bis hin zu den Stadtgrundrissen tief geprägt hat. Die engen, verwinkelten Gassen erzeugen Schatten und lassen die Luft zirkulieren, vermindern damit auch die Sonneneinwirkung auf die Häuser.
Es musste erst die moderne Baurevolution mit ihrem Hang zur Standardlösung kommen, damit all die klugen lokalen Erfindungen des menschlichen Bauerbes vergessen wurden. Weil es ökonomisch effizienter ist, die gleichen spartanischen Formen, mit den gleichen Materialien und gleichen Bautechniken überall in Serie zu produzieren, sehen Städte in der Sahara heute genauso aus wie Städte in Sibirien: große Betoncontainer mit energiesaugender Haustechnik als Universallösung für alle Klimazonen.
Insbesondere das Glas wurde zu einem entscheidenden Problem der Architektur. Zwar wäre es technologisch mittlerweile durchaus in der Lage, Häuser vor zu viel Sonneneinstrahlung zu schützen.
Im Augenblick ist das aber auch eine kostspielige, an Gerätemedizin erinnernde Technologie – und so rächt es sich nun, dass Häuser und Städte seit vielen Jahrzehnten die einfache Kunst des Schattenspendens eingebüßt haben: auskragende Dächer, eng stehende, einander verschattende Stadthäuser, dicke, daher speichertaugliche Mauern, schattenspendende Begrünung, Wasser, Läden zum Schließen der Fassade, der Wind, der zur Kühlung eingefangen und gelenkt wird: Nichts davon ist neu zu erfinden. Der Süden ist schon lange findig im Umgang mit dem sengenden Glutmonster dort oben.
Obgleich wir in den letzten Jahren viele Negativerfahrungen haben sammeln müssen, tun wir uns schwer, mit dem Klimawandel operativ umzugehen. Es scheint, als widerspräche es dem modernen Selbstgefühl zutiefst, etwa Naturkatastrophen als dauernde Erfahrung der Gesellschaft und der Geschichte anzunehmen: "Es isoliert Katastrophen in der Gegenwart und eliminiert sie aus der Vergangenheit, weil sie die Zukunft nicht definieren sollen", meinte dazu der Historiker Arno Borst.
Ein katastrophales Ereignis mag nur wenige Sekunden, Stunden oder Tage andauern, der Umgang mit der Gefahr ist aber ein dauerhaftes Phänomen. Kennzeichnend für den gesellschaftlichen Umgang mit Naturkatastrophen ist aber gerade die Diskrepanz zwischen den kurzen, plötzlich einsetzenden und nicht prognostizierbaren Auswirkungen einerseits sowie der Dauerhaftigkeit der Gefährdung andererseits.
Letztere manifestiert sich zum Beispiel in technischen Aspekten der Gefahrenabwehr (wie zum Beispiel Deiche oder erdbebensichere Gebäude), in der Finanzierung des Präventions- und Bewältigungsapparates, aber auch in der kulturellen Tradierung und permanenten Bewusstmachung.
Menschen waren einst an Überschwemmungen gewöhnt
Überschwemmungen zum Beispiel waren – in stärkerem Maße als andere natürliche Extremereignisse – für Städte und Dörfer am Fluss eher Alltag als Ausnahmezustand. Gerade für die Vormoderne, als Flüsse eine viel größere Rolle spielten als heute, kann man auch in Europa von einer regelrechten "Überschwemmungskultur" sprechen. In vielen Teilen der Welt ist das auch heute noch der Fall; ebenso wie Stürme oder Dürren außerhalb Europas fürwahr keine Seltenheit bedeuten.

Wir brauchen eine Art konzeptionelle Intelligenz – und müssen dabei stärker mit Low-Tech-Lösungen operieren. So hat es etwa der Berliner Architekt Arno Brandlhuber mit seiner "Anti-Villa" in Krampnitz (bei Potsdam) vorgemacht. Hier wird Energieeinsparung dadurch möglich, dass nicht alle Räume des Hauses ganzjährig in gleicher Weise zu nutzen sind.
Im Zentrum des Grundrisses befindet sich eine Sauna, die hinreichend Wärme für etwa 50 Quadratmeter abgibt. Um diese Wärmezone werden nach dem Zwiebelprinzip Vorhänge gelegt; die weiter vom Wärmekern entfernten Räume werden mithin im Winter immer kühler.
Wenn man sie in der kälteren Jahreszeit trotzdem nutzen will, muss man entsprechende Kleidung wählen. Dieses "zonierte" Wohnen führt zu einer saisonal abwechslungsreichen Nutzung der Wohnfläche, erfordert aber keinerlei Aufwand für Heizungsanlagen, Entlüftung und Dämmschichten, ist klimaschutzmäßig höchst effektiv und zudem extrem preiswert.
All das berührt die Frage nach der Rationalität planenden Handelns. Leitbilder ohne Fehler-Toleranzen, dies zeigen die Erfahrungen der Vergangenheit, sind stets problematisch. Konzepte sind nur in dem Maße rational, wie sie Irrtümer erlaubt, ihre Ergebnisse also auch wieder zurückgenommen werden können.
Prekäre Umweltsituationen wie Extremwetterereignisse spiegeln sich in den räumlichen und sozialen Dimensionen des Alltagslebens der Betroffenen. Weil es keine exakten Wirkungsanalysen zum Klimawandel gibt, weil wir nicht alle Risiken und Verwundbarkeiten in unseren siedlungsräumlichen Konstellationen kennen, brauchen wir strategische Ansätze, die im Zweifel revidierbar, also fehlerfreundlich sind. Genau das sollten wir aus der vorherigen Debatte über die Atomtechnik eigentlich gelernt haben.
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-7193906
Links in diesem Artikel:
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
[2] http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
Copyright © 2022 Heise Medien