Wird die Polizei kaputtgespart?
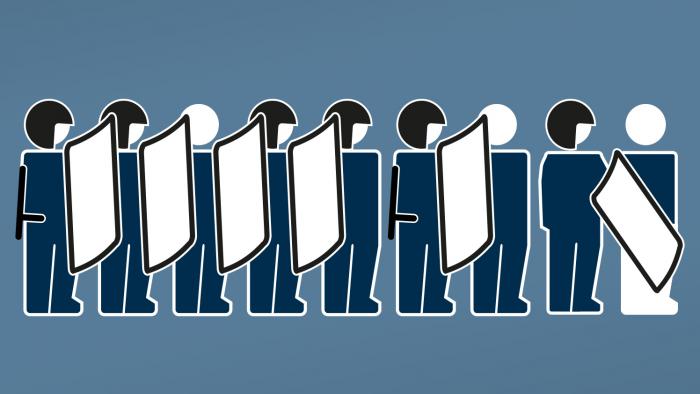
Die Ausgaben für Innere Sicherheiten wachsen mit zunehmenden Alarmismus, die Überlastung ist durch Benchmarking, ausufernde Datenerhebung und überbordende Großeinsätze hausgemacht
Dies ist bedauerlicherweise keine erbauliche Kindergeschichte. Im Verlauf der hier gewählten Beispiele wird die Polizei auch ganz sicher nie ein Schmetterling, sie bleibt eine gefräßige Raupe. Zum Einstieg ein paar Zahlen, denn für das Ausschmücken einer vermeintlich prekären Ressourcenlage nutzen ja vor allem Polizeigewerkschafter gern das Angstkonstrukt vom "Kaputtsparen der Polizei". Tatsächlich ergibt ein Blick auf die Ausgaben für Innere Sicherheit ein vollkommen anderes Bild.
In den Jahren 2005 bis 2016 sind allein die Ausgaben der Länder für die Innere Sicherheit von 15,4 Milliarden auf 20,1 Milliarden Euro gestiegen. Rechnet man die Ausgaben des Bundes hinzu, reicht die Steigerung von 21,694 zu 29,920 Milliarden Euro. Mit den Ausgaben für die justizielle Abwicklung des Aufgabenvollzugs der Polizei von Bund und Ländern (Staatsanwaltschaften/Gerichte/Justizvollzugsanstalten) betrugen 2016 die Gesamtausgaben für die Innere Sicherheit 46,345 Milliarden Euro. Ressourcen, die wegen entsprechender Ausrichtung in der polizeilichen Schwerpunktsetzung oder aufgrund kriminalpolitisch diktierter Umstände auch angesichts vieler neuer Bedrohungen der Inneren Sicherheit noch immer gern für eine kleinliche Verfolgungspraxis gegenüber Cannabiskonsumenten oder Schwarzfahrern eingesetzt werden.
In Zeiten einer so genannten "abstrakt hohen Gefahr von Anschlägen" verzeichnen die Ausgabenverläufe einen noch deutlich schnelleren Anstieg. Allein für dieses Jahr werden Mehrausgaben für die Innere Sicherheit von 4,1 % prognostiziert (Quelle der hier genannten Zahlen: Behörden Spiegel / Januar 2017). Zygmunt Baumann hat die hier gegebenen Umstände sehr treffend als "ein Geschenk für Regierungen auf ihrer Suche nach Legitimität" bezeichnet.
Die enormen Zuwächse in den staatlichen Überwachungsressourcen fallen zusammen mit einem wachsenden Markt der Privaten Sicherheitsdienstleister. Deren Handeln erlangt zunehmend eine öffentlich-rechtliche Dimension, weil es Freiheitsrechte berührt und nicht selten vor allem auf Menschen zielt, die als randständig wahrgenommen werden. Herausragende Beispiele sind hier die auf Ausgrenzung angelegten Gated-Communities oder uniformierte private Sicherheitskräfte, die im Wege des Hausrechts bewaffnet mit Schlagstock, Reizgas und Hunden auf tatsächlich öffentlichen Verkehrsflächen patrouillieren, weil diese zugleich privatrechtlich betriebene Einkaufsmeilen sind (Beispiel der Sicherheitsdienstleister Protec in der hannoverschen Nicki-de-Saint-Phalle-Promenade). Auch die ausufernde Videoüberwachung Privat-/Öffentlicher Unternehmen im Nah- und Fernverkehr fallen in diesen Zusammenhang (Beispiel die Überwachungspraxis des hannoverschen Verkehrsbetriebs Üstra).
Wie passen steigende Ressourcen und Überlastung zusammen
An den kontinuierlich weit über dem Preisindex steigenden Ausgaben für Innere Sicherheit liegt es sicher nicht, dass eine vermeintliche Überforderung der Polizei die öffentliche Debatte auch dieser Tage so weitgehend widerspruchsfrei bestimmt. Hier ist ganz offensichtlich ein gut eingespielter Teamgeist von Innenpolitik, Polizeigewerkschaften und zur Dramatisierung neigender Medien am Werk.
Dringend notwendig wäre hingegen eine kritische Debatte zu den heutigen Bedingungen von Polizeiarbeit. Vor allem die neuen sozialen Medien haben in wenigen Jahren die Mechanismen der Detektion von Gewalt und die Konstruktion von Bedrohungen der Inneren Sicherheit grundlegend neu justiert. Die Folge ist ein ausufernder Alarmismus, der zu immer bedrohlicheren Lageeinschätzungen der Polizei und in der Folge zu immer größeren Kräfteansätzen für deren Bewältigung führt. Es ist also vor allem selbstgemachtes Leid, das hier mit großem öffentlichem Nachdruck verhandelt wird und uns die immer gleichen Forderungen nach mehr Polizei mit mehr Befugnissen und schärferen Gesetzen mit höheren Strafandrohungen beschert.
Dabei schrecken Polizei und Politik auch vor Irreführung und Täuschung nicht zurück, wie die aktuelle Initiative der Bundesregierung zur Einführung einer Sonderstrafrechtsnorm zum vermeintlichen Schutz von Polizisten (sowie Feuerwehrleuten und Sanitätern, damit es sich etwas besser vermittelbar darstellt) einmal mehr belegt. Als zentrale Begründung wird angeführt, dass wieder einmal mehr als 60.000 Polizisten im vergangenen Jahr Opfer von Gewalt geworden sind. Bei näherer Nachschau ist unschwer festzustellen, dass diese enormen Opferzahlen aus einer zweckgerichteten Änderung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) resultieren, nach der auch Tatbestände, die von ihrem Schutzzweck her gar nicht auf die körperliche Unversehrtheit von Polizisten gerichtet sind, in der PKS als "Opferdelikte" registriert werden.
Offenbar gerät ein zeitgemäßes Emanzipationsverständnis aufgeklärter Bürger und eine Selbstermächtigung zum legitimen Widerstand (ziviler Ungehorsam) heute besonders leicht in Konflikt zum Aufgabenverständnis einer allenthalben "Respekt vor der Uniform" reklamierenden Polizei. Das korrespondiert mit einer mittlerweile sehr weiten Auslegung der Widerstandsnormen auf Seiten der Polizei und einer entsprechend hohen Anzeigebereitschaft und führt so zwangsläufig zu derart hohen Fallzahlen. Was die Kriminalstatistik hier aufzeigt, ist fraglos ein Problem und Grund zur Sorge, aber sicher nicht in Hinblick auf mangelnden Strafrechtsschutz für Polizisten.
Die Problematik ist strukturell und dennoch hausgemacht
Eine durchgreifende Veränderung im Aufgabenverständnis der Polizei resultiert bereits aus dem Ende der neunziger Jahre. Mit der Einführung so genannter "Neuer Steuerungsmodelle" in den öffentlichen Verwaltungen hat sich in der Rückschau auch in der Polizei ein Gefühl wachsender Überforderung etabliert.
Im "New-Public-Management" waren die Administrationen der Polizei plötzlich akribisch am Erfüllen selbst gesetzter Kennzahlen orientiert, um fortgesetzt eine vermeintlich gute Performance der Organisation unter Beweis stellen zu können. Im Benchmarking der Polizeibehörden und -dienststellen waren nun krude Kennzahlenkonstrukte in einer ständig aktuellen Fortschreibung auf Scoreboards für das Wohl und Wehe der Polizei (auch im Karrierekontext) relevant, wohingegen problematische Veränderungen im Selbstverständnis der Organisation und in den Selbstkonzepten von Polizisten immer mehr aus dem Blick gerieten.
Informell wurden Bauchschmerzen mit den schönen neuen Steuerungselementen auch im Management der Polizei immer gern geäußert, was früh die innere Distanzierung selbst unter den Protagonisten zeigte. Ein Impuls zur Veränderung war damit allerdings lange Zeit nicht verbunden. So bleibt es bis heute leicht zu entlarvendes Stilmittel einer vermeintlich verständigen Führungsleistung, sich in seiner kritischen Position zum neuen Steuern der Übereinstimmung mit "der Mannschaft" zu versichern, aber gleichwohl im Spiel mit Kennzahlen nach Kräften mitzumischen. Die durchgreifende und breit manifestierte Fehlentwicklung dieser "Neuen Steuerung" liegt in dem Umstand begründet, dass Polizisten im Ergebnis dieser anhaltend regressiven Orientierung auf Kennzahlen heute Bürger vielfach nicht mehr zuerst als Träger von Ansprüchen, sondern vor allem als Gegenstand polizeilicher Aktionen wahrnehmen.
Alarmismus prägt das Handeln
Zugleich produzierten die zunehmend computerisierten Lagebilder der Polizei methodisch eine unausgesetzte Alarmstimmung, die sich nicht erst in Zeiten eines religiös konnotierten Terrorismus auch in strukturell diskriminierenden Zusammenhängen artikuliert (Racial Profiling). Wohin die Polizei ihren Fokus heute auch richtet, überall sieht sie Extreme und kann eine mögliche Eskalation im Verlauf von Ereignissen kaum noch ausschließen. Die Polizei befindet sich gewissermaßen im Gefahrenrausch, sieht sich an immer mehr Fronten immer weitreichenderen Anforderungen ausgesetzt und erschöpft auf diesem Weg fortgesetzt ihre durchaus üppig bemessenen Ressourcen. Ex post changieren ihre Bewertungen von Hilflosigkeit, in der Formel "man habe ja rechtzeitig gewarnt", bis hin zum Garanten Innerer Sicherheit, wenn mal wieder nur dank massiver Polizeipräsenz nichts passiert ist.
Während sich komplexere Anforderungen im Kontext einer Werte relativierenden und Werte differenzierenden Gesellschaft auch im Berufsalltag der Polizei bemerkbar machen, sucht sie die Konsensfiktion ihrer Organisation weiterhin im Althergebrachten: Sie hält die Straße frei. Und derartiger Aktionismus richtet sich keinesfalls gleichmäßig auf die Bevölkerung und die in ihr auszumachenden sozialen Gefüge oder Quartiere. Das Handeln der uniformierten Polizei "auf der Straße" ist vor allem auf Brennpunkte gerichtet. Und diese Brennpunkte werden zu guten Teilen von ihr selbst bestimmt. Polizisten agieren im Ergebnis viel häufiger und viel extensiver in der Anwendung ihrer Befugnisse in sozial oder ethnisch segregierten Milieus oder gegen Gruppen (etwa Fußballfans), die ihnen im Ergebnis solcher Zuschreibungen schon von vornherein als Störer gelten. Wenn hier immer wieder verstärkt kontrolliert, eingeschritten und beanzeigt wird, hat das naturgemäß selbstreferentielle Effekte.
Es wäre daher beispielsweise in der Neugestaltung des niedersächsischen Polizeirechts (wie in der Koalitionsvereinbarung der rot-grünen Landesregierung auch zunächst beabsichtigt) sehr wohl notwendig, die Mechanismen polizeilicher Verdachtsschöpfung auf den Prüfstand zu stellen und die dafür ausschlaggebenden Befugnisse neu zu regeln, denn ein "Racial Profiling" ist vor allem ein strukturelles Problem des Handlungsrahmens der Polizei (Eingriffsbefugnisse/innere Organisation der Aufgabenerfüllung/Selbstverständnis) und gerade nicht zuerst eine Frage individuell fremdenfeindlicher Reflexe von Polizisten.
Aber im aktuell aufgeregten Diskurs um Fragen der Inneren Sicherheit wollen nun nicht einmal mehr die Grünen in Niedersachsen davon etwas wissen und haben ihr konkretes Gesetzesvorhaben zur Neugestaltung des niedersächsischen Polizeirechts derart weitreichend geschliffen, dass von den ursprünglichen Vorhaben der Stärkung von Bürgerrechten kaum noch etwas übrig ist. Damit befinden sich die Grünen dann auch schon klar auf CDU-Linie, die Bernd Althusmann, der niedersächsische Landesvorsitzende und Spitzenkandidat zur kommenden Landtagswahl jüngst in Erläuterung seiner Sicherheitspolitischen Vorstellungen und unter Beifallsbekundungen von Polizeigewerkschaftern mit der Aussage skizziert hat, dass mit der falsch verstandenen Toleranz von Initiativen zur Stärkung von Bürgerrechten nun endlich mal Schluss sein müsse.
Die Probleme der Polizei sind durchaus praktischer Natur
Wie sich in dem heutigen Setting von Polizeiarbeit ein Gefühl der ständigen Überforderung etabliert, zeigt sich exemplarisch in ihrer Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten. Grundlage für die polizeiliche Arbeit in Niedersachsen ist seit 2004 ihr Vorgangsbearbeitungssystem "NIVADIS" - ein Akronym für Niedersächsisches Vorgangsbearbeitungs-, Analyse-, Dokumentations- und Informations-System. Von Beginn an war die Architektur des Systems darauf angelegt, zu den vielfältigsten polizeilichen Aufgabenfeldern aus dem Blickwinkel des jeweiligen Spezialisten möglichst viele auswertbare Informationen zu erheben, zusammenzutragen und recherchefähig zu verknüpfen.
Abgesehen von den Problemen, die den Freiheitsrechten in diesem Ansatz schon von vornherein drohten und sich in der Folge dann auch immer mal wieder als problematisch oder auch rechtswidrig darstellten, resultiert hier mittlerweile ein herausragender Faktor im Erleben von Überforderung. Im Alltag der niedersächsischen Polizei ist diese enorme Datenflut vor allem von den Beamten in den Streifen- und Kriminaldiensten zu erheben und ins System einzupflegen. Das bewirkt eine mittlerweile als vollkommen absurd empfundene Verschiebung im Aufgabenvollzug.
Etwas plakativ ausgedrückt geht es nicht mehr zuerst darum, auf der Straße und in der Bewältigung einer Einsatzlage den Frieden wieder herzustellen. Wichtig ist vor allem die vom System geforderte Datenerhebung sicherzustellen, die Daten zunächst händisch vor Ort zu notieren, um sie dann mit immer größeren zeitlichen Aufwänden in Form der Büroarbeit im System zu erfassen. Im Ergebnis bleibt immer weniger Zeit für die Arbeit vor Ort, denn Beamte, die in den Wachen vor ihren Computern sitzen, um Daten einzugeben, können natürlich nicht zugleich auf der Straße sein.
Mittlerweile ist der Druck im Kessel der Organisation so groß, dass das Management nicht mehr nicht reagieren kann. Anstatt aber das Problem inhaltlich anzugehen, geht der Griff erneut zur Beschaffung. Mobile Geräte sollen künftig das händische Erfassen von Daten entbehrlich machen. Ausgeblendet wird wieder einmal eine kritische Auseinandersetzung mit der Systematik der polizeilichen Datenerhebung und einer von Sammelwut geprägten Organisationskultur.
Das Management streut mit Tablet-Computern Gimmicks in die Mannschaft - zeichnet aber von Beginn an verantwortlich für eine Systemarchitektur von NIVADIS, die in ihren Auswirkungen und Effekten auf den polizeilichen Aufgabenvollzug von vornherein absehbar war. So sieht es aus, wenn sich das Management der Polizei weit überwiegend aus sich selbst heraus rekrutiert und eine selbstkritische Orientierung im Aufgabenvollzug sich erst gar nicht entwickeln darf.
Die Kräfteansätze der Polizei laufen aus dem Ruder
Der gleiche Kontext von "Überforderung" aus dem Alltag der Polizei findet sich im so genannten "Geschlossenen Einsatz", also bei ihrem Auftreten in Verbänden aus Anlass von Versammlungen oder Veranstaltungen. Ihr Alarmismus bedingt gerade auch hier immer öfter ein Erreichen von Belastungsgrenzen.
Ein schönes Beispiel dafür sind die Fußballeinsätze der Polizei - und da bilden in Niedersachsen die Derby-Begegnungen zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig naturgemäß eine Spitze des Eisbergs. Schon immer lag in den Derbys Brisanz, was stets höhere Kräfteansätze der Polizei zur Folge hatte. Während die aber vor wenigen Jahren noch deutlich unter der Tausendermarke blieben, werden aktuell für eine Derby-Begegnung der laufenden Spielzeit in der 2. Bundesliga deutlich mehr als 3.000 Beamte nur am Spieltag und am jeweiligen Spielort in den Einsatz gebracht - Kräfteansätze im Umfeld eines Spieltags oder am Abfahrtort der jeweiligen Gästefans noch gar nicht eingerechnet.
Dabei hat sich die Problemlage in den Derbys gar nicht grundlegend verändert. Im Gegenteil hat die Polizei in Niedersachsen für ihr Vorgehen gegen Fußballrowdys zwischenzeitlich ein so genanntes "Rädelsführerkonzept" entwickelt und dieses so nachhaltig als Erfolgsmodell beworben, dass es jüngst bundesweit von den Polizeien des Bundes und der Länder im Sinne eines einheitlich restriktiven Vorgehens gegen eine vermeintlich überbordende Gewalt im Fußball übernommen wurde. Wenn als Ausfluss dieses vorgeblich erfolgreichen Konzepts alle Rädelsführer der Gewalt im Fußball in Niedersachsen doch bereits überaus wirksam in ihren Aktionsmöglichkeiten beschränkt werden, müssten die Gefahren beim Derby wohl eher gesunken sein. Offenbar wirkt auch in diesem Beispiel keine wie auch immer geartete Änderung der Gefahr auf die enorme Steigerung der Kräfteansätze, sondern vielmehr ein immer weiter um sich greifender Alarmismus.
Für den Umstand, dass die Polizei sich dabei in der öffentlichen Wahrnehmung offenbar gar nicht auf Abwegen befindet, gibt es eine vergleichsweise einfache Erklärung: Profifußball ist hierzulande die weitaus größte und einflussreichste, auf Vereinsebene organisierte sportindustrielle Unternehmung und hohe Ansprüche an die Sicherheit sind eben auch ein bedeutsamer Faktor in der Vermarktung, womit das Handeln der Protagonisten (einschließlich der Politik und der immer gern reißerisch zum Thema berichtenden Medien) doch recht eindeutig als interessengeleitet zu erkennen ist.
Obgleich die enorme Kommerzialisierung des Fußballsports mittlerweile in besonders heftigem Kontrast zu seinen historischen Wurzeln steht, passt die immer wieder an Einzelfällen orientierte, breite mediale Entrüstung über vorgeblich immer neue Entgleisungen von Fußballfans im Ganzen so gar nicht zur tatsächlichen Dimension des Problems. Der Profifußball bewegt nämlich von Woche zu Woche und mittlerweile über einen Großteil der Wochentage eine enorme Zahl von Menschen, die im Wesentlichen gewaltfrei und friedlich in den Stadien wie auf den Hin- und Rückwegen dem Event beiwohnen.
Das ganz große neue Ding ist ohnehin der Terror
Die Aufzählung flagranter Beispiele für überbordende Kräfteansätze der Polizei ließe sich von Versammlungen bis hin zum offenbar vollkommen neuen Gefahrenstatus der "Zusammenkünfte von Menschen zum Jahreswechsel" (vor den Ereignissen auf der Kölner Domplatte üblicherweise noch als Silvesterfeierlichkeiten bekannt) fortsetzen, würde die Dimension der weitgehend disparaten Entwicklung von tatsächlich konkreten Gefahren und überbordenden Aufwänden nicht beim polizeilichen Staatsschutz alles bisher Dagewesene toppen.
In der Terrorbekämpfung bestimmt die Polizei (in enger Zusammenarbeit mit Geheimdiensten - Trennungsgebot hin oder her) nun höchstselbst, wen sie zu welchem Grad als Gefährder einschätzt und fürderhin mit polizeilichen Maßnahmen zu überziehen gedenkt. Die Schlagzahl der Nadelstiche und Zugriffe gegen so genannte Islamistische Gefährder nimmt auffällig zu. Der Apparat hat offenbar Fahrt aufgenommen.
Gern inszeniert dabei der wehrhafte Rechtsstaat seine Aktionen mit großem Brimborium und lässt seine schwer bewaffneten Spezialkommandos möglichst medienwirksam bei der Erstürmung von Wohnungen oder Gotteshäusern agieren. Dabei leistet ein derart eindimensionales Vorgehen einer weiteren Radikalisierung womöglich sogar eher noch Vorschub. Andererseits werden die Begründungen für diesen Aktionismus gern der Geheimhaltung anheimgestellt, was vor allem die öffentliche Nachprüfbarkeit eines sinnvollen und rechtlich einwandfreien (vor allem verhältnismäßigen) Ressourceneinsatzes naturgemäß weitestgehend behindert. Die vermeintliche Überforderung der Polizei tritt so vollends in ein Dunkelfeld, aus dem heraus die hohe Schlagzahl innenpolitischer Forderungen noch ungenierter betrieben werden kann.
Der an der Berliner Humboldt-Universität lehrende Kulturwissenschaftler Joseph Vogl sieht schon jetzt in den Präventionsregimes ein Selbstverständnis, das sie ständig im Grenzbereich und als letztes Aufgebot zur Verteidigung des Inneren Friedens agieren lässt. Im Ergebnis seiner Forschungen sieht er die Frühwarnsysteme im Zustand der dauernden Erregung, weil die Befriedigung von Sicherheitsbedürfnissen immer weitere Sicherheitsbedürfnisse erzeugt, was zur wechselseitigen Steigerung von Gefahrenwahrnehmung und Schutzverlangen führt.
Verlässliche und nachvollziehbare Koordinaten der Bedrohung sind hingegen kaum auszumachen. Die Konzepte zur Begegnung rühren demgemäß im Ungewissen, zeichnen sich aber zugleich durch eine innere Maßlosigkeit aus. Der Fokus möglicher Sanktionen verschiebt sich immer mehr von wirklichen Vorfällen auf pure Möglichkeiten. Wenn der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, hier schon die Notwendigkeit sieht, Deutschland für den "Terror 4.0" zu wappnen, müssen wir uns um ein "Kaputtsparen" der Polizei auch in Zukunft sicher nicht sorgen - ernsthaft sorgen sollten wir uns allerdings um den Erhalt unserer Freiheit.
Der Autor des Beitrags ist Polizeibeamter in Niedersachsen.
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-3630426
Copyright © 2017 Heise Medien