Das große Wuseln: Hektische Betriebsamkeit als Politikersatz
Eine Demokratie haben wir schon lange nicht mehr - Teil 9
Die 9. Folge unserer demokratiekritischen Artikelreihe schaut einmal genauer hin, womit Abgeordnete in den Parlamenten ihre Zeit verbringen: Mit dem Parlamentarismus war ja stets die Vorstellung verknüpft, dass eine Regierung durch kultivierte Debatte möglich sei, dass also die Vernunft von Entscheidungen wie einst Phoenix aus der Asche aus Diskussionen emporsteigen könne. Doch selbst in der Frühzeit des Parlamentarismus war das eine reine Utopie. In den hoch ritualisierten Debatten moderner Parlamente ist von vornherein jede Hoffnung darauf begraben, dass aus dem primitiven und dennoch zahnlosen Parteiengebrüll auch nur Rudimente von Vernunft hervorgehen könnten.
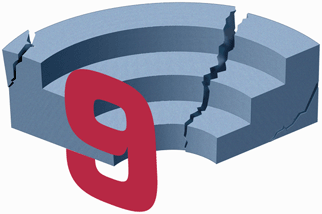
Bleibt die Frage: Was tut so ein Parlamentarier den ganzen Tag? Eins ist sicher: Alle Abgeordneten haben dicht gedrängte Terminkalender und lange Arbeitstage. Doch womit verbringen sie ihre Zeit und wie sinnvoll verbringen sie die? Ist das blinde Betriebsamkeit oder leisten sie produktive Arbeit?
Da viele Abgeordnete Wert darauf legen, es den Bürgern zu vermitteln, dass sie ungeheuer viel arbeiten müssen, geben sie gern Einblicke in ihre Tagesabläufe. Und das erleichtert es ungemein, sich ein Bild davon zu machen, was sie leisten oder auch nicht leisten.
Zunächst einmal besteht kein Zweifel daran: Abgeordnete sind pausenlos im Einsatz. Im Schnitt ist jeder Abgeordnete wohl über 70 Stunden in der Woche amtlich beschäftigt. In Sitzungswochen verbringen sie die meiste Zeit in Sitzungen, mit administrativen Aufgaben und mit Routinetätigkeiten. In der sitzungsfreien Zeit informieren sie sich, pflegen Kontakte, arbeiten sich in neue Themen ein und verfassen Manuskripte.1 [2]
Sie arbeiten sehr viel - auch an den Abenden und an den Wochenenden. Sie eilen von Termin zu Termin und von Gremium zu Gremium. Ständig in der Hatz. Wenig oder gar kein Stillstand. Bei den Terminen und in den Gremien treffen sie auf Leute wie sie selbst, die ihrerseits von Termin zu Termin und von Gremium zu Gremium hetzen.
Aus Unternehmen, in denen eine Sitzung die nächste jagt, weiß man, dass bei den meisten dieser Veranstaltungen wenig oder nichts herauskommt. Unternehmen, in denen zu viel getagt wird, sind erfolglos. Wirksames Handeln braucht Entscheidungen, nicht endlose Palaver.
Natürlich hat jeder Abgeordnete seinen eigenen Tagesablauf, und der lässt sich nicht verallgemeinern. Aber es gibt naturgemäß eine ganze Reihe von Tätigkeiten, denen jeder Abgeordnete nachgehen muss. In der Regel ist ein Bundestagsabgeordneter acht bis fünfzehn Stunden pro Tag mit diversen Tätigkeiten beschäftigt. Das fängt mit der Sichtung von Post und Zeitungen an und endet mit meist mehrstündigen Fraktions-, Arbeitsgruppen-, Ausschuss-, Kommissions-, Plenar- und sonstigen Gremiensitzungen. Hinzu kommen Interviews, der Empfang von Besuchergruppen aus dem Wahlkreis und die Vorbereitung von Reden.
Außerhalb der Sitzungswochen stehen neben der Vorbereitung auf die Sitzungswochen Termine im Wahlkreis an: Viele Bundestagsabgeordnete bieten Bürgersprechstunden an, nehmen an örtlichen Veranstaltungen teil und pflegen Kontakte auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene. Zudem üben einige wenige Abgeordnete auch noch zeitweise einen eigenen Beruf aus, den sie allenfalls in den sitzungsfreien Wochen betreiben können.
Die wilde Hatz von einem überflüssigen Termin zum nächsten
Fasst man die Vielfalt der Aktivitäten kategorisierend zusammen, so ergibt sich: Parlamentarier sitzen entweder mit anderen Parlamentariern in irgendwelchen Gremien und diskutieren, in Plenarsälen und hören zu oder sprechen selbst, oder sie besuchen Veranstaltungen, auf denen sie entweder selbst reden oder aus anderen Gründen anwesend sind.
Viele dieser Termine sind völlig überflüssig und kommen überhaupt nur dadurch zu Stande, dass es viele Amts-, Mandats- und Funktionsträger gibt, die sich gern auf Versammlungen, bei Empfängen oder sonstigen Gelegenheiten mit ihresgleichen treffen, weil sie sonst richtig arbeiten müssten und mit ihrer vielen Zeit sonst kaum etwas anzufangen wüssten.
Es ist die Eigendynamik der Existenz vieler Amts-, Mandats- und Funktionsträger. Allein weil es sie gibt, wird es für sie notwendig, sich mit anderen Amts-, Mandats- und Würdenträgern zum Palaver zu treffen. Man kommt nicht umhin, ihnen zu bescheinigen, dass sie umtriebig sind. Aber Umtriebigkeit hat mit Effizienz nichts zu tun.
Dazwischen telefonieren sie häufig, treffen andere Leute wie zum Beispiel Lobbyisten, besuchen Firmen, Institutionen, Vereine oder Ähnliches und manchmal verreisen sie auch, um sich beispielsweise ein Bild vom Fortschritt des Städtebaus in Kuala Lumpur, auf Hawaii oder auch in anderen warmen Ländern zu machen.
Zu den bevorzugten Zielen ihrer hochamtlichen Dienstreisen zählen auf jeden Fall Länder mit hohem Freizeitwert. Und wie es auf solchen Reisen mitunter zugeht, darüber empörte sich sogar der deutsche Generalkonsul in San Francisco in einem Bericht [3] an das Auswärtige Amt. Danach zeigten sich die Delegationsmitglieder des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag auf einer Kalifornienreise vorwiegend an Freizeitangeboten wie der Golden Gate Bridge, Fisherman's Wharf oder einer Tour mit der Cable Car interessiert. Und als eine Abgeordnete mit ihrem Rollstuhl, den sie wegen eines gebrochenen Fußes beanspruchte, nicht zurechtkam, verlangte ein anderer Parlamentarier barsch: "Wir brauchen einen Neger, der den Rollstuhl schiebt." Der Spiegel-Artikel ist besonders aufschlussreich, weil normalerweise von solchen "Dienstreisen" nichts nach außen dringt. Und anscheinend gehört es auch zum Stil der Abgeordneten, die Zeit im Wesentlichen mit Shopping zuzubringen und sich auf mannigfache Weise lächerlich zu machen, wie die Berichte über eine Reise des Ministers für Entwicklungshilfe und die Vorsitzende des Entwicklungsausschusses im Bundestag nach Burma und Laos zeigen.2 [4]
Reisen gehen am liebsten in warme Länder mit hohem Freizeitwert
Die Reisetätigkeit nimmt von Jahr zu Jahr gewaltig zu. Bevorzugt sind während der kalten Jahreszeit Fernreisen in wärmere Gegenden. 2010 reisten die Abgeordneten des Bundestags so oft wie nie zuvor ins Ausland. Der Höchststand aus dem Jahr 2008 wurde um 125 Reisen übertroffen. 2010 standen insgesamt 3,7 Millionen Euro für Reisen zur Verfügung. 2007 umfasste der Reiseetat noch gut eine Million weniger, 2009 lag er schon bei 2,3 Millionen Euro.
725 Mal zog es die Volksvertreter 2010 ins Ausland. Zusätzlich zu diesen Einzelreisen registrierte die Verwaltung 78 Delegationsreisen ins Ausland. Einen vorläufigen Höchststand erreichten die Parlamentarier 2008 mit knapp 600 Auslandsreisen. 2009 reisten Bundestagsabgeordnete einzeln nur 378 Mal ins Ausland. Damals war in Deutschland gerade Wahlkampf. Da konnte man unmöglich weg. Der Kampf um das eigene "Pöschtle" ist denn doch noch ein gehöriges Stück wichtiger als eine schöne Reise in die Südsee.
Damals ermahnte Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) die Abgeordneten schriftlich, sich wegen der bis dahin schon hohen Zahl der Reisen "auf unabdingbar notwendige Reisevorhaben zu beschränken".
Er hätte sich zu dieser Aufsehen erregenden Ermahnung gewiss nicht veranlasst gesehen, wenn er davon überzeugt gewesen wäre, dass die viele Reiserei einen höheren Sinn hat und nicht vielfach einfach nur dazu diente, den ach so hart arbeitenden Abgeordneten schöne Fernreisen auf Kosten der Steuerzahler zu verschaffen.
Vor allem die größeren Delegationsreisen mit meist sechs bis acht Abgeordneten verschlingen Riesenbeträge. Der Bundestagsausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung etwa reiste 2010 nach Mexiko und in die Vereinigten Staaten. Überhaupt sind die USA eines der beliebtesten Reiseländer der Abgeordneten: Fünf größere Delegationen weilten dort 2010, die Aufenthalte dauerten in der Regel eine Woche. Auch im Juni, kurz vor der parlamentarischen Sommerpause, packten einige Abgeordnete gern in größeren Gruppen die Koffer: zweimal Russland, zweimal Frankreich und zweimal Belgien, hinzu kamen Delegationstrips nach Norwegen und Litauen.
Doch nur, wer die ausgeprägte Neigung der Damen und Herren Abgeordneten zur Selbstbedienung nicht kennt, kann nicht ahnen, was geschah, nachdem der Bundestagspräsident sie sanft ermahnt hatte, nicht so viel in der Gegend umherzureisen. Genau, sie sagten sich: jetzt erst recht und legten noch einmal eine dicke Schippe drauf - eine richtig dicke Schippe.
Allein von Oktober 2011 bis zum Ende der 17. Legislaturperiode unternahmen sie 1169 Reisen in aller Herren Länder. Gesamtkosten: 6,88 Millionen Euro - gut 2 Millionen mehr als in den ersten beiden Jahren der Legislaturperiode. Eine Zunahme von 41 Prozent.
Am häufigsten gab es Einzeldienstreisen von Abgeordneten (745), Reisen zu Konferenzen von Internationalen Parlamentarierversammlungen (189) und Ausschuss-Reisen (148). Die weitesten Dienstreisen unternahmen einzelne Abgeordnete: Einer musste nach Neuseeland und ins Südsee-Paradies Tonga. Ein anderer Abgeordneter bereiste Fidschi und einer musste nach Australien und Samoa. Insgesamt dreimal reisten Delegationen oder einzelne Abgeordnete nach Kuba.
Kurios sind meist die Begründungen für die Fernreisen. So musste Bundestagsvizepräsident Eduard Oswald (CSU) samt Delegation gleich zweimal dringend nach Südamerika zu "einem Meinungsaustausch über bilaterale Fragen". Ja, worüber denn sonst?
Der Petitionsausschuss des Bundestages, der sich um Beschwerden der Bundesbürger über Behördenwillkür kümmern soll, musste dringend in der Mongolei und in Südkorea nach dem Rechten sehen. Bestimmt auch wieder was enorm Bilaterales. Eine andere Delegation des Ausschusses musste an der Weltkonferenz des Internationalen Ombudsmann Instituts in Neuseelands Hauptstadt Wellington teilnehmen - natürlich im November, dann ist dort gerade Sommer. Bei uns ist Winter.
Reisefleißig waren auch die Mitglieder des Sportausschusses. Sie reisten im November 2011 nach Brasilien, um nachzusehen, wie weit die Vorbereitungen für die Fußballweltmeisterschaft 2014 und die Olympischen Spiele 2016 gediehen sind. Im August 2012 musste eine Delegation des Ausschusses nach London zur Olympiade. Dort habe man mit Athleten und Funktionären "eine offene und kritische Diskussion über die zukünftige Gestaltung und Optimierung der Sportförderung" geführt. Tatsächlich haben die sich meistens nur die olympischen Wettkämpfe angesehen.
Besonders eifrig reiste auch der Verkehrsausschuss, der übrigens vom heutigen Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter geleitet wurde. Delegationen flogen nach Brasilien und Singapur, um sich über Verkehrs- und Logistikfragen auszutauschen. Außerdem musste der Ausschuss nach Slowenien, Kroatien und Griechenland, um sich über die griechischen Autobahnen zu informieren. Auch Litauen, Lettland und Estland standen auf dem Besuchsprogramm. Vier Mitglieder des Haushaltsausschusses informierten sich auf Kuba "über den Stand der Reformbemühungen nach dem Rückzug von Fidel Castro aus dem aktiven Regierungshandeln".
Die Abgeordneten: Viel zu tun, wenig zu sagen
Wie immer man das sieht: Ernst zu nehmende Entscheidungsprozesse sind bei den vielen Abgeordnetentätigkeiten kaum dabei. Das hat einen leicht zu erklärenden Grund: Der immens wuselige Aufwand steht in keinem Verhältnis zur Entscheidungsverantwortung eines einzelnen Abgeordneten; denn er hat zwar viel zu tun, aber wenig zu sagen.
Falls Parlamentarier jemals etwas zu sagen gehabt haben sollten, so hat inzwischen eine Verlagerung stattgefunden: Die Masse der Parlamentarier nimmt an Entscheidungen des Parlaments nur noch dadurch teil, dass sie ihrer Fraktionsspitze folgen und deren Wünschen entsprechend abstimmen.
Daran ändern auch die paar Entscheidungen nicht, in denen die Fraktionsspitzen die Abgeordneten vom Fraktionszwang "freistellen". Das tun sie ohnehin nur in Fällen, in denen es nicht darauf ankommt.
Und die wenigen Fälle, in denen es für die Fraktionsspitzen nicht darauf ankommt, geraten unversehens zu Sternstunden des Parlamentarismus. So geschehen im Juli 2011, als der Bundestag über die Zulässigkeit der Prä-Implantations-Diagnostik (PID) entschied und eine der niveauvollsten Debatten geführt wurde, die das Parlament je erlebte.
Während "normale" Bundestagsdebatten vielfach dadurch charakterisiert sind, dass die Abgeordneten verbal jeweils gegen die Kollegen der Gegenfraktion(en) auskeilen, bestand dafür in dieser Debatte keinerlei Notwendigkeit. Es wurde einfach nur auf höchstem Niveau und mit dem größten Respekt vor den Vertretern der Gegenmeinung ein komplexes Thema ausdiskutiert. Kein Geschrei, kein Gebrüll, kein Parteiengezänk, kein aufgeblasenes Getöse. Aber das ist und bleibt die Ausnahme.
Und die Ausnahme zeigt umgekehrt eben auch: Die Abgeordneten sind durchaus intelligente, nachdenkliche Menschen mit Niveau. Der Zwang zu primitiv polarisierender Keilerei liegt im System der parlamentarischen Debatte zwischen Regierung und Opposition, bei der es auf Betonung der Gegensätze und dessen, was beide trennt, ankommt und eben nicht darauf, Sachverhalte klärend zu erörtern.
Dazu fragte der ehemalige Bundestagsvizepräsident Burkhart Hirsch (FDP) im November 1999: "
Warum aber fordern Abgeordnete gelegentlich, etwa bei einer Abstimmung zu § 218 StGB oder beim Waffenexport, eine Abstimmung solle "freigegeben" werden, wenn sie ohnehin frei ist? Es muss schon erstaunen, dass auch große Fraktionen, selbst bei sehr komplizierten Gesetzgebungsvorhaben, fast stets einmütig abstimmen. Bei den namentlichen Abstimmungen, bei denen Namenskarten abgegeben werden und das Stimmverhalten des einzelnen Abgeordneten im Protokoll festgehalten wird, gilt das erst recht.
Die Debattenkultur in den Parlamenten ist tot
In der Frühzeit des Parlamentarismus entstand das Ideal und die Realität der klassischen parlamentarischen Debatte: Hochgebildete und hochintelligente Könner der gehobenen Rhetorik tauschten in brillanter Rede geistreich Gedanken miteinander aus.
Es war ein intellektuelles Vergnügen und eine Bereicherung, ihnen zuzuhören. Oft gelang es den Debattenrednern, ihre Zuhörer so eindringlich von ihren Argumenten zu überzeugen, dass diese ihnen am Ende gar zustimmen konnten, ihnen aber auf jeden Fall ihren Respekt entgegenbrachten.
Diese Form der geistvollen parlamentarischen Debatte gibt es nicht mehr. Sie ist tot. Sie ist unwiederbringlich auf dem Altar der Parteiendemokratie geschlachtet worden.
Als Instrument der Streitkultur ist die klassische Überzeugungsdebatte unter dem Einfluss des politischen Parteiensystems, der Fraktionsdisziplin und der Verbreitung von Parlamentsdebatten in Funk und Fernsehen für alle Zeiten ausgerottet worden, weil es im Parlament niemanden mehr gibt, den man überzeugen müsste. Da sind ja alle schon willige Parteigänger der eigenen Fraktion.
Die parlamentarische Diskussion und das Aushandeln von Gesetzen und Verordnungen sind de facto nicht mehr als ein Schattenboxen. Ein Schaukampf. Denn die Entscheidungen, um die es geht, sind längst gefallen, bevor die Debatte überhaupt begonnen hat.
Der demokratische Diskurs ist in den heutigen Parlamenten zur bloßen Eristik verkommen, zur Kunst, um jeden Preis Recht zu behalten, zur blöden Rechthaberei. "Eristische Dialektik" nannte der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer (1788-1860) ein posthum veröffentlichtes Werk, in dem er 38, nicht immer ganz ernst gemeinte rhetorische Kunstgriffe beschrieb, die es ermöglichen sollen, aus Streitgesprächen als Sieger hervorzugehen und zwar auch dann, wenn Tatsachen gegen die eingenommene Position sprechen. Er verstand die Kunstgriffe als Beispiele für rabulistische Argumentation.
Es geht nicht mehr darum, andere Parlamentarier zu überzeugen. Die Fronten bestehen so oder so und können durch noch so überzeugende Rhetorik nicht mehr erschüttert werden. Es geht auch nicht mehr darum, parlamentarische Mehrheiten zu gewinnen oder zu verändern. Auch die stehen längst fest. Die Entscheidungen sind getroffen und sind vor Beginn der Debatte unverrückbar.
Eigentlich bräuchte man überhaupt nicht mehr darüber zu reden; denn das Reden wird so oder so an den getroffenen Entscheidungen nichts mehr ändern. Es geht ausschließlich darum, in den Parteien, den Fraktionen oder sonstwo im Vorfeld der Debatte getroffene Entscheidungen vor der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Das Stichwort lautet nicht mehr "parlamentarische Debatte mit Niveau" sondern "Schlagabtausch".
Parlamente sind Austragungsstätten für leeres Geschwätz
Kritiker werfen den Parlamentariern manchmal vor, dass sie ihre Reden "zum Fenster hinaus" halten. Was für ein Aberwitz! Alle parlamentarischen Reden werden "zum Fenster hinaus" gehalten. Parlamentarische Reden werden nur noch "zum Fenster hinaus" gehalten. Sie brauchen niemanden mehr zu überzeugen. Alle haben schon ihre unerschütterlichen Standpunkte, Überzeugungen kann man das ja kaum nennen. Sie brauchen auch niemanden mehr mit Gedanken und Überlegungen zu beeindrucken, auf die er vorher noch nicht gekommen ist.
Selbst wenn jemand auf neue Gedanken oder Überlegungen käme, würde das nichts ändern. Und sie brauchen auch nicht einen Gedankenaustausch anzuregen. Wozu braucht man noch einen Austausch von Gedanken, wenn die neuen Gedanken am eigenen Handeln doch nichts ändern?
Die Antwort ist eindeutig: Man braucht ihn überhaupt nicht. Als Foren der parlamentarischen Debatte sind Bundestag und Länderparlamente leere Gefäße, Austragungsstätten für aufgeblasenes hohles Geschwätz.
Mit dem Parlamentarismus eng verknüpft war ja stets die naive Vorstellung, dass so etwas wie eine Regierung durch kultivierte Debatte möglich sei, dass also die Vernunft von Entscheidungen wie einst Phoenix aus der Asche aus Diskussionen emporsteigen könne - so wie das aus den geistreichen Debatten im antiken Athen und Rom möglich gewesen zu sein schien. Doch selbst in der Frühzeit des Parlamentarismus war das eine reine Utopie. Auch als die Parlamentarier noch auf weitreichend homogener, sozial privilegierter Basis diskutierten, ging es um handfeste Eigeninteressen.
In den hoch ritualisierten Debatten moderner Parlamente ist von vornherein jede Hoffnung darauf begraben, dass aus dem primitiv-rechthaberischen und dennoch zahnlosen Parteiengebrüll auch nur Rudimente von Vernunft hervorgehen könnten.
Um überhaupt möglich zu sein, müsste eine konstruktive Streitkultur in irgendeiner Weise institutionalisiert sein, also etwa dadurch, dass eine seriöse Debatte wenigstens dazu führen kann, dass einzelne Abgeordnete anders abstimmen und sich womöglich gar die Mehrheitsverhältnisse ändern.
Doch wenn das möglich wäre, bräche unweigerlich das bestehende Gleichgewicht der Kräfte in jedem Parlament zusammen. Das wiederum ist aber durch die Rolle der politischen Parteien und der Fraktionen völlig ausgeschlossen. Jede Änderung der Mehrheitsverhältnisse gefährdet die Regierung. Und weil das so ist, erscheint es ausgeschlossen, und zwar total. Folglich gibt es keinerlei Anreiz zur kultivierten oder auch nur halbwegs zivilisierten Debatte.
Verbaler Schlagabtausch und dröhnende Rhetorik
Deshalb geht es bei parlamentarischen Debatten nur darum, ein bisschen gegen die jeweiligen Gegner zu pöbeln. Und da primitive Pöbelei beim Publikum nicht so gut ankommt, findet im Plenum stets nur ein verbaler "Schlagabtausch" statt. Aber selbst den will das Publikum inzwischen auch nicht mehr hören. Er ist ja auch geistlos und langweilig und führt vor allem zu gar nichts.
Die Debattenredner geben so durch ihr eigenes Verhalten überdeutlich zu erkennen, wie tief sie selbst davon inzwischen davon überzeugt sind, dass sie als Parlamentarier nichts mehr zu sagen und nichts mehr zu entscheiden haben. Sie nehmen sich selbst nicht mehr ernst und überkompensieren diese unbewusste Einsicht durch besonders dröhnende Rhetorik.
Wäre es anders, würden sie in den parlamentarischen Debatten seriöser auftreten. Die primären Adressaten ihrer Reden im Plenum sind nicht mehr die anderen Debattenteilnehmer, sondern gegenwärtige oder künftige Zuschauer, die überhaupt nicht im Plenum anwesend sind: vor allem das Fernsehpublikum. Das Ritual der parlamentarischen Debatte ist zur billigen Show verkommen.
Und da es überhaupt nicht mehr darum geht, die Debattenteilnehmer der anderen Fraktionen zu überzeugen, zu beeinflussen und sie mit Argumenten zu konfrontieren, die sie beeindrucken könnten, können die Redner der Gegenseite getrost aggressiv attackiert werden - geht es doch vor allem darum, sie möglichst effektvoll zu demontieren.
Das Resultat dieses Verfalls der Debattenkultur ist ein niveauloses Schmierentheater, in dem die Beteiligten rabaukenhaft gegeneinander auskeilen - einer der Gründe für die in vielen Jahren gewachsene Politikverdrossenheit großer Teile der Bevölkerung: Das einfältig-rechthaberische und selbstgefällige Gewäsch parlamentarischer Debattenredner ist dem Publikum längst zuwider. Verbale Prügeleien und wechselseitige Schuldzuschreibungen sind das genaue Gegenteil dessen, was ein Volk mit Fug und Recht von einem Parlament erwarten kann.
Geradezu rührend wirkt es da, wenn der Bundestagspräsident Norbert Lammert seine Politikerkollegen ermahnt, ihr Umgang untereinander sei oft ein "wechselseitiger rhetorischer Wettbewerb", der nicht gerade zu einem positiven Bild in der Öffentlichkeit beitrage. Deshalb seien sie zum Teil selbst schuld an ihrem schlechten Image und landeten zu Recht in Umfragen auf dem vorletzten Platz unter 17 Berufen.
Die Kritik ist zwar gerechtfertigt, aber nutzlos; denn in einer parlamentarischen Entscheidungssituation, in der es notwendig nur um Polarisierung und Betonung von Gegensätzen gehen kann, besteht ein objektiver Zwang zur rabulistischen Keilerei, dem sich die Abgeordneten auch dann kaum entziehen können, wenn sie das möchten.
Täten sie nicht wenigstens das und könnten sie nicht wenigstens die Gegenseite mit Unrat überhäufen, müssten sie womöglich erkennen: Diese Debatte hat überhaupt keinen Sinn und auch keinen höheren Zweck. So wollen wir uns doch wenigstens daran erfreuen, dass wir’s der Gegenseite mal wieder so richtig gezeigt haben.
Der Niedergang der Debattenkultur in den Parlamenten steht allerdings in eklatantem Gegensatz zu den Notwendigkeiten unserer Zeit. Auch dies ein Indiz dafür, dass die Welt der entwickelten repräsentativen Demokratien aus den Fugen geraten ist.
Die parlamentarische Debatten(un)kultur passt nicht mehr
Das Informations- und Kommunikationszeitalter erfordert eine neue Diskurskultur. Der banale Streit darum, wer jetzt gerade Recht hat und schon immer Recht hatte oder die besseren Konzepte verficht, ist nicht mehr zeitgemäß und verantwortungslos. Gebraucht wird eine Lösungskultur und ein gemeinsamer Lösungsdialog, der Parteigrenzen überwindet, nicht aber sie in Stein meißelt.
Es festigt sich im Lande die Überzeugung, dass unser Parteiensystem, in welcher Farbkombination auch immer, den heutigen Herausforderungen in keiner Weise gewachsen ist und daher von der Krise verschlungen werden wird, wenn es nicht die Kraft zur durchgreifenden Erneuerung findet. Wenn unsere Parteien weder programmatisch noch personell in der Lage sind, die Bevölkerung mit klaren Alternativen zu konfrontieren und damit Richtungsentscheidungen zu erzwingen, ist diese Republik am Ende.
Arnulf Baring
Aber eine Diskurskultur, die Lösungen für Probleme zu erarbeiten versucht, kann aus einer parlamentarischen Parteiendemokratie aus strukturellen Gründen nicht hervorgehen. Man kann sich das von Herzen wünschen - so wie den Weltfrieden. Aber der wird deshalb auch nicht kommen. Die Struktur der Parlamente in Parteienstaaten mit ihren Regierungsmehrheiten und Oppositionsminderheiten steht einer lösungsorientierten Diskurskultur entgegen und macht sie unmöglich.
Es hilft nicht, wenn man bloß über die Politiker und ihre nichtssagenden Reden in den Parlamenten schimpft; denn dahinter stehen institutionelle Zwänge, und erst wenn die beseitigt sind, wird eine parlamentarische Redekultur möglich sein, bei der am Ende sinnvolle Ergebnisse herauskommen.
Wer unbefangen darüber nachdenkt, wie politische Entscheidungen zu Stande kommen, könnte sich sagen: Eigentlich kann da nur etwas Sinnvolles herauskommen, wenn in Parteigremien, Fraktionen, Parlamenten und Ausschüssen lauter qualifizierte und gut ausgebildete, womöglich noch einigermaßen lebenserfahrene Männer und Frauen sich zusammensetzen und über politisches Handeln beraten. Doch dann betrachtet derselbe unbefangene Beobachter die Resultate dieser Politik in Regierungen, Parlamenten, Fraktionen und Parteitagen, und schon bricht wieder das nackte Entsetzen ob des politischen Alltags über ihn herein.
Trotzdem bleibt die Frage, der wir in der nächsten Folge nachgehen werden: Wie kann es kommen, dass aus den Beratungen vieler vernünftig erscheinender Individuen über Jahre, ja Jahrzehnte hinweg, solch kollektiver Blödsinn hervorgeht, den kaum eines der beteiligten Individuen im Alleingang unterstützen oder auch nur befürworten würde?
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-3363438
Links in diesem Artikel:
[1] https://www.heise.de/tp/features/Scheindemokratie-voller-leerer-Huelsen-3363323.html
[2] https://www.heise.de/tp/features/Das-grosse-Wuseln-Hektische-Betriebsamkeit-als-Politikersatz-3363438.html?view=fussnoten#f_1
[3] http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,572742,00.html
[4] https://www.heise.de/tp/features/Das-grosse-Wuseln-Hektische-Betriebsamkeit-als-Politikersatz-3363438.html?view=fussnoten#f_2
[5] https://www.heise.de/tp/features/Wenn-Gremien-entscheiden-3363601.html
Copyright © 2014 Heise Medien