Meinungsfreiheit und das "Hausrecht" im Zeitalter des Internets
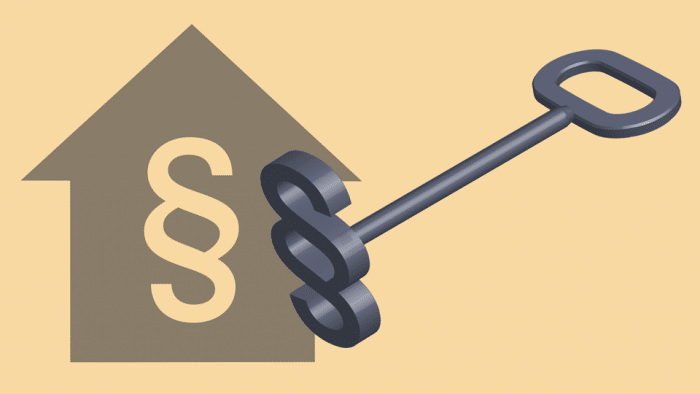
Was ein Stadionverbot und gelöschte Kommentare mit den Grundrechten zu tun haben
In der Geschichte der Demokratie war die griechische Agora - die uns heute noch im Fachbegriff für Platzangst begegnet: Agoraphobie -, das römische Forum oder schlicht der Marktplatz von besonderer Bedeutung. Hier trafen sich Bürger unter freiem Himmel zum Austausch über kulturelle und politische Ideen. Dabei vergessen wir nicht, dass "Bürger" mitunter Arme, Frauen, Fremde oder Sklaven ausschloss.
In Grundrechten [1] wie der Freiheit der Meinungsäußerung (Artikel 5, Absatz 1) oder der Versammlungsfreiheit (Artikel 8, Absatz 1 GG) ist dem Gedanken Rechnung getragen, dass das Sich-Treffen und der Austausch von Ideen für eine Demokratie von entscheidender Bedeutung sind. Mit der Entwicklung der Medien verlagerte sich der Meinungsaustausch aber auch ins Private: Die Tageszeitung liest man wahrscheinlich zuhause oder beim Pendeln im Zug. Ihre Pendants im Internet-Zeitalter und die sogenannten sozialen Netzwerke holt man sich in der Regel auf den eigenen Computer.
Privatisierung von Kommunikationskanälen
Die Bürger können sich zwar immer noch auf öffentlichen Plätzen treffen - und bei Kulturveranstaltungen oder Demonstrationen geschieht das ja auch. Doch ein großer Teil unserer Kommunikation findet inzwischen online statt und damit in einem privaten Kontext: Man muss sich erst bei einem allgemeinen Anbieter anmelden und dann auf dem Server von irgendjemandem "surfen". Man kann nicht einfach so ins Internet gehen, wie man auf den Marktplatz geht.
Damit ist aber auch der rechtliche Rahmen ein anderer. Auf dem öffentlichen Platz regeln beispielsweise die genannten Grundrechte den Schutz vor staatlichen Eingriffen. Im privaten Zusammenhang gelten zwar auch Gesetze - gleichzeitig aber auch die ebenfalls aus den Grundrechten (Artikel 2, Absatz 1 GG) abgeleitete Vertragsfreiheit. Das heißt, dass die Bürger untereinander einen großen Spielraum dafür haben, wie sie ihr Miteinander regeln.
Solche Vereinbarungen können stillschweigend sein: Dass man etwa beim Bäcker für seine Brötchen bezahlen muss, weiß jeder. Dass dabei ein Kaufvertrag im juristischen Sinne geschlossen wird, daran denkt im Alltag wohl nur eine Minderheit der Nichtjuristen.
Die Vereinbarungen sind oft aber auch ausformuliert, beispielsweise in Form Allgemeiner Geschäftsbedingungen oder von Nutzungsbedingungen. Dass der Durchschnittsbürger und selbst Rechtsexperten diese seitenlangen Erklärungen in einem Sekundenbruchteil abnicken, ändert nichts an deren Geltung.
Öffentlicher Meinungsaustausch im Privaten
Wenn man nun eins und eins zusammenzählt, dann fällt einem auf, dass der öffentliche Meinungsaustausch heute zunehmend in einem privaten Kontext stattfindet: Gemerkt haben wir das vor nicht allzu langer Zeit, als führende Medien die Kommentarmöglichkeiten ihrer Besucher einschränkten oder gleich ganz abschafften.
Aber auch ein Über-Netzwerk wie Facebook, auf dem wiederum Organisationen oder einzelne Personen Diskussionen ermöglichen, fällt in den privaten Bereich - eben des Unternehmens Facebook und seiner Partner. Man könnte sich vielleicht eine Utopie vorstellen, in der die sozialen Netzwerke in öffentlicher Hand sind, wie heute (noch) viele Straßen und Plätze, und in denen keine Profitinteressen herrschen. Fakt ist aber, dass ein Großteil der "Internetplätze" heute nordamerikanischen Aktienunternehmen gehört.
Beispiel Frankfurter Flughafen
Das wirft die Frage auf, wie es in diesen privaten Kontexten um die für die Demokratie so wichtigen Freiheiten bestellt ist: Muss sich der Staat irgendwann einmischen, wenn Kommunikation zunehmend über private Anbieter bereitgestellt wird? Ein Beispiel war der Versuch des Frankfurter Flughafens beziehungsweise der Fraport AG, unter Berufung auf sein Hausrecht Demonstrationen gegen die Abschiebung von Flüchtlingen zu verbieten.
Dem schob das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 22. Februar 2011 [2] einen prinzipiellen Riegel vor, nachdem das Amtsgericht Frankfurt, bestätigt vom dortigen Landgericht und dem Bundesgerichtshof, den Verweis auf das Hausrecht für rechtmäßig befunden hatte. Die Verfassungsrichter argumentierten im Gegensatz dazu, dass der Flughafen als von der öffentlichen Hand (mit-)betriebenes Unternehmen direkt durch die Grundrechte gebunden sei. Allerdings würde die Aufrechterhaltung des Flugbetriebs größere Einschränkungen etwa des Demonstrationsrechts als auf anderen öffentlichen Plätzen rechtfertigen.
Nun gilt diese Voraussetzung bei Internet-Giganten wie Facebook und Google oder auch hiesigen Verlagshäusern, auf deren Seiten wir unsere Zeit verbringen und vielleicht auch diskutieren, nicht: Es sind schlicht Privatunternehmen. Und damit gilt erst einmal der privatrechtliche Zusammenhang. Einmal salopp gesagt: Sie können auch Ihren Nachbarn nicht vors Bundesverfassungsgericht bringen, falls Sie nicht zufällig neben dem Bundespräsidenten oder einer anderen Behörde wohnen.
"Mein Haus, mein Hausrecht"
Als Blogger seit über zehn Jahren auf dem Portal eines deutschen Verlags - der einem amerikanischen Verlag gehört, der wiederum zu einem deutschen Medienkonzern gehört - hatte ich schon so manche Diskussion über Zensurvorwürfe und Meinungsfreiheit im Internet. Ein beliebter Standpunkt war, dass ein Blogger in seinem Blog das Hausrecht habe, wie in seinem Wohnzimmer, und dort mehr oder weniger machen könne, was er wolle: Wenn Gäste die Diskussion stören oder sich nicht so verhalten, wie man sich das vorstellt, dann könne man eben ihre Beiträge löschen oder sie gleich ganz herausschmeißen.
Der Wohnzimmervergleich leuchtete mir nie so ganz ein, denn in mein Wohnzimmer lade ich ja nicht die ganze Welt ein. Ich schicke auch keine gutbezahlten Suchmaschinenoptimierer auf den Weg, damit meine Sofagarnitur möglichst gut gefunden wird. Damit der Vergleich stimmt, müsste es eher ein Wohnzimmer sein, zu dem die Tür permanent offen ist und draußen auch noch jemand steht und ununterbrochen ruft: "Kommen Sie herein!" Und, falls es ein Diskussionsforum gibt: "Diskutieren Sie mit!"
Wenn man sich so viel Mühe gibt, gesehen, besucht und gelesen zu werden, dann muss man auch damit umgehen können, wenn die Leute wirklich kommen und mitmachen. Leute, die mitunter andere Ansichten haben, als man selbst. Und diese auch äußern; vielleicht in einer anderen Form, als man es selbst täte. So ist der Mensch.
Deutliche Regeln
Der Wohnzimmervergleich hinkt also gehörig. Trotzdem ist die Sache mit dem Hausrecht aber nicht gänzlich aus dem Nichts gegriffen. Die Hausregeln sollten aber auch verständlich formuliert und einsehbar sein, wenn sie nicht so selbstverständlich sind, wie dass man beim Bäcker für seine Brötchen bezahlt. Ansonsten kann man es seinen Gästen auch nicht wirklich vorwerfen, wenn sie sich nicht daran halten.
Sprich: Auch mit den Besuchern eines Blogs kommt ein Vertrag zustande, insbesondere dann, wenn man ihnen die Gelegenheit gibt, die Beiträge zu kommentieren. Nun haben Verlagshäuser und in noch größerem Maße Konzerne wie Facebook ganze Rechtsabteilungen, die Nutzungsbedingungen formulieren. Das sind dann eben die berühmt-berüchtigten Dokumente, die wir in sekundenschnelle wegklicken.
"Marktplatz" im Internet
Dennoch kam mir in den alten Diskussionen schon der Gedanke, dass der Verweis aufs Privatrecht nicht die ganze Geschichte sein kann: Was wäre denn, wenn so gut wie alle Kommunikation eines Tages über private Kanäle stattfände, wenn also der traditionelle Marktplatz nur noch im virtuellen Raum existierte, auf den Servern von Privatunternehmen? Wer würde denn dann noch die für die Demokratie so wichtigen Grundrechte wie die Meinungs- oder Versammlungsfreiheit gewährleisten?
Dass die Grundrechte nicht unmittelbar zwischen Privatparteien gelten, ist ebenso eine Binsenweisheit, wie die Tatsache, dass man nicht über alles Verträge schließen kann: Man kann sich zum Beispiel nicht für jemanden versklaven. Nun gibt es zwar vielleicht Internetseiten, auf der sich "Sklaven" und "Herren" anbieten.
Der springende Punkt ist aber, dass niemand die Polizei einschalten könnte, um die Erfüllung so eines Sklavenvertrags zu erzwingen. Es handelt sich eher um Spiele oder Hobbys, denen manche Erwachsene nachgehen. Der Staat mischt sich also durchaus in die Vereinbarungen von Privatpersonen ein. Spätestens dann, wenn es zu Missverständnissen kommt, und jemand den Staat um Hilfe bittet.
Auch das (kommerzielle) Anbieten von Peepshows [3] beschäftigte schon in den 1980ern das Bundesverfassungsgericht und wurde damals für sittenwidrig und mit der Menschenwürde unvereinbar befunden. Ähnlich entschieden bereits französische und deutsche Gerichte über das Zwergenwerfen als Jahrmarktsattraktion, das zeitweise in Australien und den USA populär war.
Nun ist Sittenwidrigkeit im Privatrecht, nämlich im § 138 des Bürgerlichen Gesetzbuchs [4], ausdrücklich genannt. Im ersten Absatz heißt es dort: "Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig." Dafür braucht man also nicht erst das Grundgesetz zu bemühen.
Die "mittelbare Drittwirkung" von Grundrechten
Allerdings gibt es auch einen indirekten Weg, auf dem Grundrechte in private Zusammenhänge eingreifen können. Juristen nennen dies die "mittelbare Drittwirkung" der Grundrechte, die ich am Beispiel von zwei Fällen diskutieren möchte: Der erste betrifft ein Stadionverbot, der zweite das Löschen eines Kommentars auf Facebook.
Im ersten Fall bekam ein damals Sechzehnjähriger Stadionverbot für Fußballspiele, weil er beim Mitlaufen in einer Ultra-Gruppe, aus der heraus Körperverletzungen und Sachbeschädigungen begangen worden waren, von der Polizei aufgegriffen wurde. Daraufhin wurde gegen den Mann ein Verfahren wegen Landfriedensbruchs eingeleitet. Das ereignete sich im Zusammenhang mit dem Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem FC Bayern München vom 25. März 2006.
Die Polizei teilte dem Duisburger Verein am 11. April 2006 den Vorgang mit und regte ein bundesweites Stadionverbot für den Mann an. Dies sprach der MSV Duisburg dann auch für den Zeitraum vom 18. April 2006 bis zum 30. Juni 2008 aus. Obwohl das Strafverfahren gegen den Betroffenen am 27. Oktober 2006 wegen Geringfügigkeit eingestellt wurde, hielt der Fußballverein das Verbot aufrecht. Es kam sogar noch schlimmer: Der FC Bayern München schloss den Mann gänzlich dem Verein aus und kündigte auch dessen Jahreskartenabonnement.
Weg durch die Instanzen
Der junge Fußballfan wandte sich daraufhin an das Amtsbericht Duisburg (Urteil vom 13. März 2008), das dortige Landgericht (20. November 2008) und schließlich sogar den Bundesgerichtshof (30. Oktober 2009). In allen Instanzen scheiterte er: Die Gerichte bestätigten, dass die Stadionbetreiber hier rechtmäßig ihr Hausrecht ausgeübt hätten. Dabei komme es nicht darauf an, dass dem Mann tatsächlich eine Straftat nachgewiesen wurde. Der Verdacht, ein Störer zu sein, reiche bereits aus.
Daraufhin schaltete er mit seinem Anwalt das Bundesverfassungsgericht ein: Es gehe hier nicht bloß um einen normalen Vertrag, sondern wegen der überragenden sozialen Bedeutung und des öffentlichen Stellenwerts des Fußballs seien auch die Grundrechte betroffen, nämlich vor allem das aus Artikel 2, Absatz 1 im Zusammenhang mit Artikel 1, Absatz 1 GG abgeleitete allgemeine Persönlichkeitsrecht. Ein besonderer Kritikpunkt war auch, dass man ihm wenigstens eine Anhörung hätte anbieten müssen, damit er das Missverständnis habe aufklären können.
Fall fürs Bundesverfassungsgericht
Das Bundesverfassungsgericht entschied [5] den Fall nun am 11. April 2018, also genau zwölf Jahre(!) nach der Mitteilung durch die Polizei an den Fußballverein. Dafür hatte auch der Deutsche Fußball-Bund eine Stellungnahme eingereicht, dass es sich um eine private Ausübung des Hausrechts und um keinen Fall für das Verfassungsgericht handle. Diesen Punkt verneinten die Richter aber, weil die Möglichkeit der Grundrechtsverletzung des Mannes hinreichend dargelegt worden sei und die Umstände auch noch lange nach Auslaufen des Stadionverbots das Ansehen des Mannes schädigen könnten.
In der Sache gaben Sie dem Fußballfan aber unrecht. Dabei folgten die Verfassungsrichter jedoch nicht dem Argument, das auf das Ausüben des Persönlichkeitsrechts abzielte, sondern verglichen die ebenfalls grundgesetzlich gesicherte Eigentumsgarantie der Stadionbetreiber mit dem Schutz vor willkürlicher Ungleichbehandlung nach Artikel 3, Absatz 1 GG: "Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich." Daraus ergebe sich ein Schutz vor willkürlicher Ungleichbehandlung.
Die "Ausstrahlung" des Grundrechts ins Privatrecht, wie es in Rechtssprache so schön heißt, begründeten die Richter dabei wie folgt:
Maßgeblich für die mittelbare Drittwirkung des Gleichbehandlungsgebots ist dessen Charakter als einseitiger, auf das Hausrecht gestützter Ausschluss von Veranstaltungen, die aufgrund eigener Entscheidung der Veranstalter einem großen Publikum ohne Ansehen der Person geöffnet werden und der für die Betroffenen in erheblichem Umfang über die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben entscheidet. Indem ein Privater eine solche Veranstaltung ins Werk setzt, erwächst ihm von Verfassung wegen auch eine besondere rechtliche Verantwortung. Er darf seine hier aus dem Hausrecht - so wie in anderen Fällen möglicherweise aus einem Monopol oder aus struktureller Überlegenheit - resultierende Entscheidungsmacht nicht dazu nutzen, bestimmte Personen ohne sachlichen Grund von einem solchen Ereignis auszuschließen.
1 BvR 3080/09, Rn. 41
Keine willkürliche Ungleichbehandlung
Mit anderen Worten: Die Stadionbetreiber können nicht erst alle zum Fußballgucken einladen und dann willkürlich Personen den Zugang verbieten, insbesondere weil dem Fußball eine gesellschaftliche Bedeutung zukommt. Dafür bedarf es schon eines besonderen Grunds und nicht etwa: "Weil mir dein Gesicht nicht gefällt!"
Soweit kamen die Richter dem Mann also entgegen. In letzter Konsequenz scheiterte er jedoch mit seiner Verfassungsbeschwerde: Die Verfassungsrichter fanden den Verdacht, dass von ihm eine Gefahr ausgehe, nämlich schlicht schon aufgrund der Tatsache als geben, dass er mit den Ultras mitgelaufen war.
Das stelle "einen auf Tatsachen beruhenden Anfangsverdacht" dar, der für das Stadionverbot reiche, zumal den Fußballvereinen bei laufenden Verfahren regelmäßig keine endgültigen Ermittlungserkenntnisse vorliegen würden. Das gelte selbst dann noch, wenn das Verfahren später wegen Geringfügigkeit eingestellt werde.
Den Punkt mit dem Anhörungsrecht behandeln die Richter noch kurz am Rande: Zwar hätte man den Mann wohl vorsprechen lassen müssen, als er um die Überprüfung des Verbots bat. Die Regeln der Stadionbetreiber seien inzwischen aber bereits in diesem Sinne angepasst und der Fußballfan habe immerhin in den zivilrechtlichen Verfahren die Möglichkeit gehabt, sich zu dem Stadionverbot zu äußern. Kurzum: Das zwölfjährige Klagen, nachdem er als Jugendlicher einmal in einer gewalttätigen Gruppe erwischt worden war, hat ihm gar nichts gebracht.
Logik der Instanzen
Das Urteil erweckt in mir den Eindruck, dass man die Sache so zwar sehen kann, dass man dem Mann aufgrund des vagen Verdachts und seines jungen Alters aber auch etwas hätte entgegenkommen können. Er konnte sich im Weg durch die Instanzen noch nicht einmal damit durchsetzen, das Verbot wenigstens nur auf Duisburg einzuschränken und nicht für das ganze Land gelten zu lassen. Und das, obwohl er als 16-Jähriger die Folgen seines Mitlaufens bei den Gewalttätern wohl noch nicht so gut abschätzen konnte.
Manchmal ist es aber auch schlicht so, dass die Instanzen - hier: die Fußballvereine, Stadionbetreiber, Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte - zusammenhalten, wenn erst einmal eine Entscheidung getroffen wurde. Dann liegt die Hürde besonders hoch und würde eine Änderung der Entscheidung implizieren, dass jemand einen Fehler gemacht hat: dass die Einschätzung der Polizei falsch war, dass die Staatsanwaltschaft vorschnell gehandelt hat, dass der Verein den Fall nicht gut geprüft hat.
Einladung verpflichtet
Wie dem auch sei: Für unsere Ausgangsfrage ist relevant, dass man auch im Privatrecht nicht erst alle zur Teilnahme einladen und dann willkürlich Menschen ausschließen kann. Das gilt insbesondere dann, wenn es um eine gesellschaftlich relevante Aktivität geht.
Ob das gleich bei jedem Blog gilt, darf man wohl bezweifeln. Besser wäre es aber auch dort, klare Hausregeln aufzustellen und sich im Konfliktfall darauf zu berufen. Wenn man an eine Plattform wie Facebook denkt, dann liegt die soziale Relevanz meiner Meinung nach aber auf der Hand.
Gegen Facebook vor Gericht
Tatsächlich berief sich das Oberlandesgericht München (OLG) erst kürzlich in seiner Entscheidung [6] vom 24. August 2018 auf die Grundrechte und deren "mittelbare Drittwirkung" im Privatrecht: In diesem Fall hatte eine Frau gegen das Löschen eines Kommentars und die Sperrung ihres Accounts auf Facebook geklagt. Ihr Kommentar stand im Zusammenhang mit einem Spiegel-Online-Artikel über Grenzkontrollen in Österreich und richtete sich an eine andere Nutzerin:
[Name der anderen Nutzerin] Gar sehr verzwickt ist diese Welt, mich wundert's daß sie wem gefällt. Wilhelm Busch (1832-1908)
Wusste bereits Wilhelm Busch 1832 zu sagen:-D Ich kann mich argumentativ leider nicht mehr mit Ihnen messen, Sie sind unbewaffnet und das wäre nicht besonders fair von mir.
18 W 1294/18
Die Richter diskutieren erst einige Fachfragen. So war die Klägerin am 14. August 2018 mit ihrem Antrag in erster Instanz beim Landgericht München gescheitert. Und auch die Frage, ob man für Facebook mit seinem Sitz in Irland zuständig sei, wird diskutiert - und mit Verweis aufs Europarecht bejaht.
Einseitige Richtlinien
Bei der Diskussion der Frage, ob Facebook den Kommentar löschen durfte, bringen die Richter nun tatsächlich das Grundrecht auf Meinungsfreiheit aus Artikel 5, Absatz 1 GG ins Spiel, obwohl der Vertrag zwischen dem Internetkonzern und der Nutzerin privatrechtlicher Natur ist. In diesem Zusammenhang diskutieren sie Punkt 5.2. aus Facebooks "Erklärung der Rechte und Pflichten", in dem es heißt: "Wir können sämtliche Inhalte und Informationen, die du auf Facebook postest, entfernen, wenn wir der Ansicht sind, dass diese gegen die Erklärung oder unsere Richtlinien verstoßen."
Diese Klausel halten die Richter für unwirksam, weil sie nur die Interessen des Internetkonzerns gelten lasse. Aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch ergebe sich aber die Pflicht, auch die Interessen der Gegenpartei zu berücksichtigen (§ 241, Absatz 2 [7]). Anschließend fahren sie - mit Verweis auf das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt vom 10. August 2017 [8] - fort, dass es sich bei Facebook tatsächlich um eine Art "öffentlichen Marktplatz" handle, auf dem die Grundrechte mittelbar gelten würden (siehe auch diesen ähnlichen Fall: Facebooks Quasi-Monopol schränkt Definitionsmöglichkeiten von "Hassrede" ein [9]).
In der näheren Begründung wird auch das gerade besprochene Stadionverbotsurteil des Bundesverfassungsgerichts zitiert. Konkret führen die Richter aus:
Im vorliegenden Fall bildet die Vorschrift des § 241 Abs. 2 BGB die konkretisierungsbedürftige Generalklausel, bei deren Auslegung dem von der Antragstellerin geltend gemachten Grundrecht auf freie Meinungsäußerung (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG) Rechnung zu tragen ist. Mit dem gebotenen Ausgleich der kollidierenden Grundrechtspositionen nach dem Grundsatz der praktischen Konkordanz wäre es unvereinbar, wenn die Antragsgegnerin [also Facebook, d. A.] gestützt auf ein "virtuelles Hausrecht" (vgl. LG Bonn, Urteil vom 16.11.1999 - 10 O 457/99, NJW 2000, 961) auf der von ihr bereitgestellten Social-Media-Plattform den Beitrag eines Nutzers, in dem sie einen Verstoß gegen ihre Richtlinien erblickt, auch dann löschen dürfte, wenn der Beitrag die Grenzen zulässiger Meinungsäußerung nicht überschreitet.
18 W 1294/18, Rn. 28'
Mit anderen Worten: Wenn Facebook den Beitrag unter Berufung auf sein Hausrecht löscht, dann darf dieser nicht von dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit gedeckt sein. Die Richter überprüfen dann, ob es sich bei dem Kommentar von der Nutzerin um eine "Hassbotschaft" handelt. Dazu interpretieren sie ihn im Kontext der Online-Diskussion.
Richterliche Interpretationsarbeit
Diese Interpretationsarbeit aus der Hand der Richter ist sicher nicht unintelligent, liest sich aus Laiensicht aber äußerst unterhaltsam, einschließlich der Erklärung der Bedeutung des Smileys ":-D". Deswegen möchte ich die drei Absätze aus dem Urteil hier vollständig zitieren:
Die Antwort der Antragstellerin an [die andere Frau] wird mit der Wiedergabe eines kurzen - als solches kenntlich gemachten - Zitats von Wilhelm Busch in Versform eingeleitet, in dem dieser seine Verwunderung darüber zum Ausdruck bringt, dass diese "gar sehr verzwickt(e)" Welt jemandem gefallen könne. Dem Zitat liegt offensichtlich ein pessimistisches Weltbild zugrunde. Der maßgebliche Leser erkennt, dass Wilhelm Busch mit der geäußerten Verwunderung darüber, dass es Menschen gibt, denen die Welt trotz ihrer "Verzwicktheit" gefällt, den Vertretern einer positiveren Weltsicht letztlich ein ausreichendes Urteilsvermögen abspricht, weil diese nicht in der Lage seien, die Komplexität und Unvollkommenheit der tatsächlich existierenden Welt zu erkennen.
Aufgrund dieser Interpretation des Zitats erschließt sich dem verständigen und unvoreingenommenen Leser auch, dass die Antragstellerin mit der Verwendung des Zitats ihrer Kritikerin mangelndes Urteilsvermögen vorwirft. In dieser Interpretation sieht er sich durch den weiteren Inhalt der streitgegenständlichen Äußerung bestätigt: Die Aussage "Wusste bereits Wilhelm Busch 1832 zu sagen" und die anschließende Zeichenkombination ":-D", welche, nach den Gepflogenheiten der Internet-Kommunikation ein laut - aber nicht unbedingt freundlich - lachendes Gesicht symbolisiert, erkennt der Leser als Übertragung der allgemeinen Aussage des Zitats auf die Person der Kritikerin.
Letzte Zweifel werden durch den abschließenden Satz der streitgegenständlichen Äußerung "ich kann mich argumentativ leider nicht mehr mit ihnen messen, Sie sind unbewaffnet und das wäre nicht besonders fair von mir." ausgeräumt. Damit bringt die Antragstellerin aus Sicht des maßgeblichen Lesers zum Ausdruck, dass sie auf die Eröffnung einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit [der anderen Frau] verzichtet, weil sie ihre Kritikerin nicht für "intellektuell satisfaktionsfähig" hält. Diese sei "unbewaffnet", was der Leser im Kontext dahin versteht, dass die Kritikerin ihre gegenteilige Auffassung nicht auf tragfähige Argumente stützen könne. Die abschließende Bemerkung, dass die Fortsetzung der Diskussion "nicht besonders fair" wäre, erkennt der Leser als Betonung ihrer eigenen intellektuellen Überlegenheit durch die Antragstellerin.
18 W 1294/18, Rn. 35-37
Keine Hassbotschaft
Die Richter stellen anschließend fest, dass es sich bei dem fraglichen Kommentar daher nicht um eine "Hassbotschaft" im Sinne der Definition von Facebook handelt, da kein "direkter Angriff auf Personen wegen ihrer Rasse, Ethnizität" und so weiter vorliege. Auch das neue Netzwerkdurchsetzungsgesetz böte keine Rechtsgrundlage dafür, den Beitrag der Nutzerin zu löschen.
So wird Facebook unter Androhung von einem Ordnungsgeld in Höhe von bis zu € 250.000 oder einer Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten dazu verurteilt, den fraglichen Kommentar wieder einzustellen und auch die Sperre der Nutzerin aufzuheben. Es handelt sich jedoch nur um eine einstweilige Verfügung und die Sache muss noch im Hauptverfahren behandelt werden. Für die Antragstellerin ist das aber sicher schon ein großer Erfolg gegen den Internet-Goliath.
Am Rande sei noch erwähnt, dass der Streitwert des Verfahrens auf sage und schreibe € 10.000 festgesetzt wurde und das Landgericht München den Antrag der Frau in erster Instanz auch aus dem Grund abgelehnt hatte, weil sie sich erst nach vier Tagen ans Gericht gewandt hätte. Letzteres hielten die Richter des Oberlandesgerichts aber für übertrieben.
Grundrechte im Privatbereich
Meine am Anfang aufgestellten allgemeinen Überlegungen und die hier diskutierten Gerichtsurteile zeigen auf, dass Grundrechte in den privatrechtlichen Bereich wirken können. Insbesondere muss ein willkürlicher Ausschluss vermieden werden, nachdem man erst alle Menschen zur Teilnahme eingeladen hat. Wichtig war auch, dass die angebotenen Dienste von gesellschaftlicher Bedeutung sind.
Ab wann das auf einen Blog oder die Nachrichtenseite eines Verlags übertragbar ist, bleibt eine offene Frage. Hier könnte man vielleicht argumentieren, dass man leicht auf eine andere Plattform ausweichen und dort seine Meinungsfreiheit ausüben könne. Das ist bei den (Quasi-)Monopolisten der Fußballspiele oder sozialen Netzwerke nicht möglich. Wenn eines Tages aber alle Nachrichtenmedien Kommentare verbieten würden, dann wäre das aber womöglich eine zu weitgehende Einschränkung der Meinungsfreiheit.
In jedem Fall scheint es aber angemessen, deutliche Hausregeln aufzustellen, um Willkür zu vermeiden. Einen Beitrag zu löschen, bloß weil er einem nicht gefällt, dürfte unzureichend sein. Wenn Beiträge aber themenfremd sind oder endlose Wiederholungen die Funktion eines Diskussionsforums torpedieren, dann wird man sie wohl löschen beziehungsweise die Autoren ausschließen dürfen. "In meinem Wohnzimmer mache ich, was ich will", scheint jedoch als Begründung unzureichend sein, wenn man die Wohnzimmertür sperrangelweit offen lässt.
Dieser Artikel erscheint ebenfalls im Blog "Menschen-Bilder" [10] des Autors.
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-4205709
Links in diesem Artikel:
[1] https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01/245122
[2] https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2011/02/rs20110222_1bvr069906.html
[3] http://www.servat.unibe.ch/dfr/vw064274.html
[4] https://dejure.org/gesetze/BGB/138.html
[5] https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2018/04/rs20180411_1bvr308009.html
[6] http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2018-N-20659?hl=true
[7] https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__241.html
[8] http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7922257
[9] https://www.heise.de/tp/features/Facebooks-Quasi-Monopol-schraenkt-Definitionsmoeglichkeiten-von-Hassrede-ein-4202596.html
[10] http://scilogs.spektrum.de/menschen-bilder/
Copyright © 2018 Heise Medien