Neue Fed-Zinsanhebung: Es wird ernst für die Eurozone
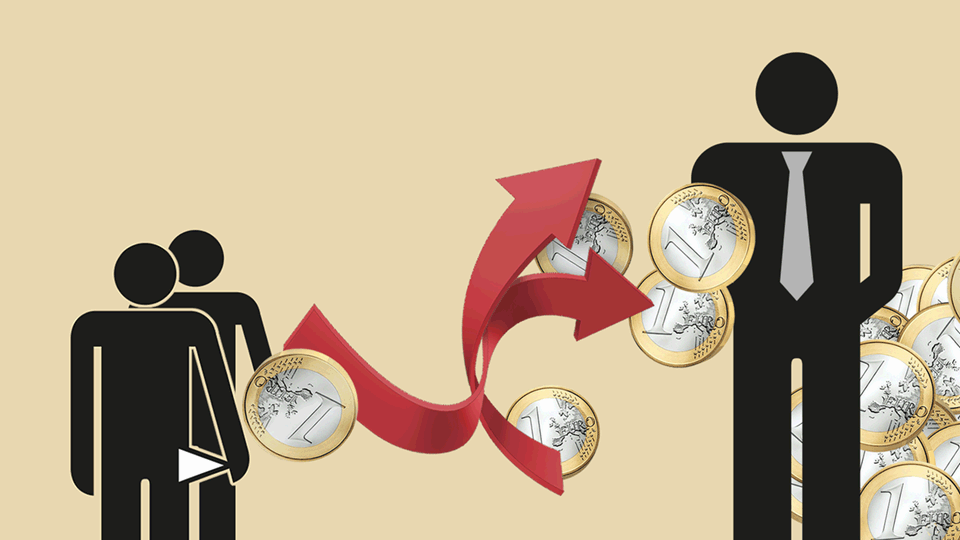
- Neue Fed-Zinsanhebung: Es wird ernst für die Eurozone
- Reallohnverluste und Wirtschaftseinbruch
- Auf einer Seite lesen
US-Notenbank will Zinsen wegen der hohen Inflation schneller und stärker anheben. In Europa zeigt sich deutlich, dass die Wirtschaft bremst, besonders im Immobiliensektor.
Im Februar hatte die US-Notenbank (Fed) das Tempo bei den Zinserhöhungen deutlich gedrosselt, nachdem sie zur Bekämpfung der hohen Inflation zunächst große Zinsschritte von 50 und sogar mehrfach 75 Basispunkten gegangen war. Das Durchgreifen hatte in den USA schon im Herbst Wirkung gezeigt.
Die Teuerung ging zurück. Zuletzt wurde im Januar eine offizielle Inflation von 6,4 Prozent verzeichnet. Angesichts der sich abschwächenden Teuerung hatte die Fed, wie auch erwartet worden war, die Leitzinsen dann Anfang Februar nur um weitere 25 Basispunkte erhöht. Auch damit hat der Leitzinskorridor einen schon relativ hohen Wert von bei 4,50 Prozent bis 4,75 Prozent erreicht.
Angesichts der Tatsache, dass sich für einige Wirtschaftsräume längst klare Rezessionstendenzen zeigen, wurde darauf gehofft, dass in den USA ein gemächlicherer Zinskurs beibehalten wird.
Doch für die US-Notenbank ist der "Job", der ein höheres Tempo verlangt, noch nicht erledigt, da sich die Inflationsrate noch immer weit entfernt von der Zielmarke von zwei Prozent befindet. In der Eurozone, wo die Europäische Zentralbank (EZB) die Inflationsentwicklung verschlafen hat, ist sie nach der ersten Schnellschätzung im Februar sehr leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 8,4 Prozent gesunken.
Da die Statistiker in der letzten Zeit gerne daneben liegen, könnte es sein, dass auch diese Schätzung bald nach oben korrigiert werden muss. In einigen Ländern ist die Inflation mit dem Auslaufen von Hilfsmaßnahmen ohnehin wieder gestiegen, wie zum Beispiel in Deutschland auf 9,3 Prozent.
Fed: Aussicht auf weitere Zinserhöhungen
In der vergangenen Woche sorgte Fed-Chef Jerome Powell mit seinen Erklärungen vor einem Senatsausschuss für Aufruhr an den Geldmärkten. War zunächst der Leitindex an der Börse in Frankfurt mit 15.706 Zählern auf ein neues Jahreshoch geklettert, gab der Dax nach den Erklärungen von Powell alle Gewinne wieder ab und schloss sogar mit 0,6 Prozent im Minus. Was war geschehen?
Der Präsident der Federal Reserve sieht mehr Spielraum für eine stärkere Inflationsbekämpfung, da die jüngsten Wirtschaftsdaten besser als erwartet ausgefallen seien, wie er – auch mit Blick auf positive Zahlen vom Arbeitsmarkt – erklärte.
Sollte die Gesamtheit der Daten darauf hindeuten, dass eine schnellere Straffung gerechtfertigt ist, wären wir bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu erhöhen.
Jerome Powell
Powell unterstrich, "dass die hohe Inflation zu erheblichen Belastungen führt" und dass die man bei der Fed fest entschlossen sei, "die Inflation auf unser Ziel von zwei Prozent zurückzuführen". Er verwies auch darauf, dass der Inflationsdruck höher sei, als es noch bei der vergangenen Fed-Sitzung im Februar erwartet worden war.
Obwohl sich die Inflation in den vergangenen Monaten abgeschwächt hat, ist es noch ein weiter Weg bis zur Rückkehr zu einer Inflationsrate von zwei Prozent, der wahrscheinlich holprig sein wird.
Jerome Powell
Damit machte Powell klar, dass es kein leichter Weg werden wird, da auch die Fed das Kind zunächst in den Brunnen fallen ließ. Allerdings reagierte die US-Notenbank dann schneller und energischer als die EZB, die letztlich nur auf die Fed-Entscheidungen reagierte.
Bei den Frankfurter Notenbankern reagierte man nämlich vor allem darauf, dass es wegen der Zinserhöhungen in anderen Währungsräumen zur massiven Kapitalflucht aus dem Euroraum kam. Damit wurde der Euro erheblich geschwächt, worüber sich in der Konsequenz auch Energie weiter deutlich verteuert hatte.
Der Euro fiel zwischenzeitlich sogar unter die Parität zum Dollar. Da Gas und Öl in Dollar gehandelt werden, wurde die Inflation durch eine verfehlte EZB-Politik also nicht nur über die Geldschwemme angeheizt.
Powell hält an seiner "Until the job is done"-Doktrin fest. "Wir haben viel erreicht", erklärte er. Aber ihm ist auch bewusst, dass man die Auswirkungen der Straffung "noch nicht im vollen Umfang sehen würde: "Wir haben noch viel zu tun."
Er verwies auf das doppelte Mandat der Fed: für eine maximale Beschäftigung und für stabile Preise zu sorgen. "Ohne Preisstabilität funktioniert die Wirtschaft nicht für alle", sagte er.
"Insbesondere werden wir ohne Preisstabilität keine anhaltenden Arbeitsmarktbedingungen erreichen, die allen zugutekommen."
Powell stellte für die Zinssitzung der Zentralbank am 22. März deshalb eine deutlichere Erhöhung der Leitzinsen in Aussicht, weshalb mit einer weiteren Erhöhung um 50 Basispunkte gerechnet werden kann. Der Fed-Chef machte auch deutlich, dass auch das endgültige Zinsniveau höher ausfallen werde, als bisher angenommen worden war und damit erhöht sich die Bremswirkung für die Wirtschaft.
Im Mandat der Fed findet sich ein zentraler Unterschied zum Mandat der EZB: Die Aufgabe der Europäischen Zentralbank ist es allein, für Geldwertstabilität zu sorgen.
Kritik aus Deutschland
Es fällt auf, wie das Handelsblatt damit umgeht, dass Powell gegen bisherige Erwartungen nun doch eine deutlichere Straffung der Geldpolitik ankündigt. "Schon wieder kassiert Jerome Powell seine bisherigen Ziele ein", wird schon im Untertitel zu einem Artikel harsch geurteilt. Das habe "Konsequenzen, auch für seine Reputation"
Man reibt sich erstaunt die Augen darüber, wie harsch das Blatt über eine kleine Kurskorrektur der Fed urteilt, die bisher noch nicht einmal umgesetzt ist. Kassiert wurde gar nichts. Ohnehin hatte Powell immer wieder sehr deutlich gemacht, dass es die Fed, anders als die EZB, ernst mit der Inflationsbekämpfung meint.
Solche Töne sind im Handelsblatt üblicherweise nicht gegenüber der EZB-Chefin Christine Lagarde zu hören. Würde die Zeitung diese Logik auf Lagarde anwenden, hätte sie längst deren Abschied fordern müssen. Von "Reputation" kann man im Fall Lagarde ohnehin nicht mehr sprechen. Denn die von ihr geführte EZB glänzte lange Zeit mit absurden Prognosen zur Inflationsentwicklung, die jeder Realität entbehrten.
Darauf hatte die EZB ihre absurde Geldpolitik aufgebaut, wie auch der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank kritisierte.
Erst als es gar nicht mehr anders ging, die offizielle Inflationsmarke zweistellig wurde und der Druck der Fed zu groß wurde, kassierte Lagarde ihre absurden Prognosen und legte einen Schwenk um 180 Grad hin. Dafür hätte man sie in die Wüste schicken müssen. Denn ihre Politik hat die Verarmung breiter Bevölkerungsschichten beschleunigt.