Privatversicherte Beamte bürden Steuerzahlern bis 2030 60 Milliarden Mehrkosten auf
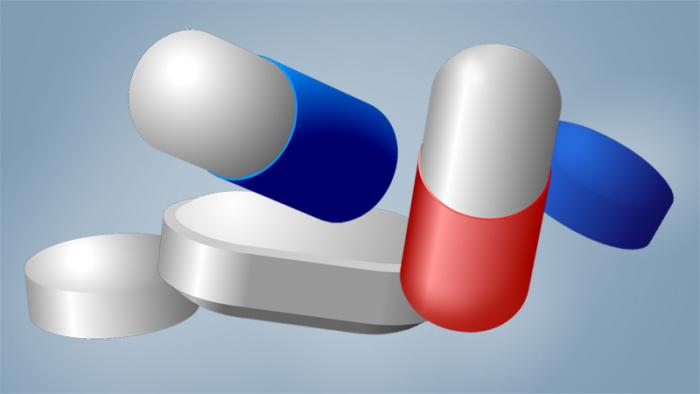
Grafik: TP
Studie empfiehlt Übernahme in gesetzliche Krankenversicherungen
Einer neuen Studie der Bertelsmann-Stiftung und des Berliner IGES-Instituts nach werden die von den Steuerzahlern getragenen Beihilfeausgaben für Beamte bis 2030 von etwa 12 auf rund 20 Milliarden Euro im Jahr steigen. Die Experten empfehlen deshalb, nicht nur Angestellte im öffentlichen Dienst, sondern auch Beamte über die gesetzlichen Krankenkassen zu versichern. Dadurch würden ihrer Rechnung nach die Steuerzahler bis 2030 um insgesamt 60 Milliarden Euro weniger belastet.
Aktuell sind fast alle Beamten deshalb privat versichert, weil ihnen ihre öffentlichen Arbeitgeber - anders als private - nicht den hälftigen Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Krankenversicherung zahlen. Stattdessen zahlen sie ihnen im konkreten Krankheitsfall eine Beihilfe, die während des aktiven Dienstes 50 und im Pensionsalter 70 Prozent der tatsächlichen medizinischen Kosten beträgt, die der Beamte jedes Mal mit Belegen beantragen muss.
Für die 50 oder 30 Prozent der Krankheitskosten, die von den Beihilfestellen nicht übernommen werden, schließen Beamte private Krankenversicherungen ab, bei denen sie niedrigere Prämien zahlen müssen als Arbeitnehmer, die ihr Krankheitsrisiko zu 100 Prozent absichern wollen. Das gilt vor allem bei Berufseinsteigern, die man mit vermeintlich günstigen Angeboten lockt. Durch Preissteigerungen, bei denen privaten Krankenversicherungen kaum Grenzen gesetzt sind, können die Beiträge mit der Zeit trotzdem Höhen erreichen, die den Versicherten Probleme bereiten - vor allem im Alter und bei Beamten außerhalb der höheren Einkommensgruppen.
Gewinner: Schlechter bezahlte Beamte, Steuerzahler und Krankenversicherte
Beamte, die sich gesetzlich versichern wollen, haben bisher nicht die Möglichkeit ihren Beihilfeanspruch mit entsprechend niedrigeren Beiträgen zur gesetzlichen Krankenkasse zu kombinieren. Stattdessen müssen sie dort statt 7,3 Prozent ihres Einkommens 14,6 Prozent abführen, weil man ihnen den (wegen des nunmehr nur theoretischen Beihilfeanspruchs verweigerten) Arbeitgeberanteil mit in Rechnung stellt.
Durch diese Einschränkung der Wahlfreiheit entscheiden sich viele Beamte für Privatversicherungen, obwohl auch diese Einzelbelege für jeden Krankheitsfall haben wollen, die noch einmal so viel bürokratischen Aufwand verursachen wie die Beihilfeanträge - und deren Bearbeitung bis zur Auszahlung so lange dauern kann, dass in der Zwischenzeit Mahnungen von Zahnärzten oder Krankenhäusern eintreffen, wenn deren Rechnungen nicht mit Ersparnissen überbrückt werden können.
Erlaubt man Beamten mit Einkommen unterhalb der Versicherungspflicht, sich wie Angestellte zu versichern - also mit Anspruch auf einen vom Arbeitgeber anstatt einer Beihilfe gezahlten Arbeitgeberanteil -, dann würde der Studie nach mindestens ein Fünftel von ihnen nicht nur durch weniger Bürokratie, sondern auch finanziell profitieren, wenn man die Versicherungspflichtgrenze bei 57.600 Euro belässt. Die etwa 12 Prozent oder umgerechnet 377.000 Beamten, die mehr verdienen als diese 57.600 Euro, sowie 89.000 mitversicherte Familienangehörige würden diesem Modell nach weitgehend in privaten Krankenkassen verbleiben.
Da die 2,7 Millionen restlichen Beamten immer noch auf ein Durchschnittsjahreseinkommen von fast 38.000 Euro kommen, würden die gesetzlichen Krankenkassen davon profitieren. Verrechnet man ihre 15,2 Milliarden Euro Beiträge mit den voraussichtlich von ihnen verursachten Kosten in Höhe von 11,8 Milliarden Euro, dann könnten die gesetzlichen Krankenkassen ihre Beiträge um 0,34 Prozentpunkte senken.
Verlierer wären Ärzte und Zahnärzte
Verlierer solch einer Umstellung wären Ärzte, die sich die Behandlung von Privatversicherten derzeit mindestens um den Faktor 2,6 höher honorieren lassen als die von Kassenpatienten, weshalb viele Privatversicherte den Eindruck haben, sie bekämen bei Fachärzten zwar schneller Termine, müssten dort aber wesentlich länger in den Wartezimmern warten, weil reihenweise Untersuchungen mit offenbar teuren Gerätschaften vorgenommen werden, die möglicherweise eher der finanziellen Gesundheit des Arztes als ihrer eigenen körperlichen dienlich sind.
Die privaten Abrechnungssätze sind zudem noch höher, als sie auf den ersten Blick scheinen: Weil ein Arzt oder Zahnarzt nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) bzw. der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) ohne weitere Begründung den 2,3-fachen Satz der festgelegten Behandlungssumme berechnen darf, wird dieser Betrag von den privaten Kassen ohne weitere Nachfragen erstattet, wie die Bayerische Beamtenkrankenkasse Telepolis schon vor Jahren bestätigte (vgl. Deutschland sucht das Superrezept).
Höchst fragwürdig scheinen auch die Kriterien, nach denen Ärzte einen noch höheren Satz berechnen dürfen. Funktionär Martin Eulitz nannte als Beispiel, bei dem der Arzt den 3,5-fachen Satz verlangen kann, einen "nervösen Patienten". Das private Abrechnungssystem stellt so einen Anreiz für Ärzte und Zahnärzte dar, ihre Patienten bei der Behandlung zu verunsichern, um so für die gleiche Leistung deutlich mehr abrechnen zu können. Abgesehen von dieser Nervosität des Patienten darf jeder Zahnarzt laut Gebührenordnung gleich viel verlangen - egal wie gut oder schlecht er arbeitet.
Reaktionen
Trotzdem sprachen nicht nur Ärzte, sondern auch Beamtenfunktionäre gegen die von der Studie empfohlene Umstellung aus. Eine Sprecherin des Beamtenbundes verwies in diesem Zusammenhang auf die "Fürsorgepflicht" das Bundes, der Länder und anderer Gebietskörperschaften, aus der sich der Beihilfeanspruch ergebe. Ob diese Fürsorgepflicht beim heutigen Stand der Versorgung durch gesetzliche Krankenkassen nicht schon längst auch durch die Zahlung eines Arbeitgeberanteils an diese erfüllt wäre, müssten Gerichte entscheiden.
Beim Verband der privaten Krankenversicherungen, die durch so eine Reform knapp die Hälfte ihrer 8,8 Millionen Vollversicherten verlieren würden, war heute Vormittag niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Sie mussten - seit ihnen das der Gesetzgeber vorschieb - Rückstellungen für ihre Versicherten vornehmen, die verhindern sollen, dass die Beiträge dieser Versicherten unbezahlbar hoch werden, wenn sie alt und krank sind. Die Studie schätzt, dass sich diese Rückstellungen inzwischen auf 72 Milliarden Euro belaufen, die die privaten Krankenversicherungen nicht ohne Widerstand hergeben werden wollen, auch wenn sie vorgeblich für die Versicherten angespart wurden.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
