"Traditionelle Männlichkeit ist psychologisch schädlich"
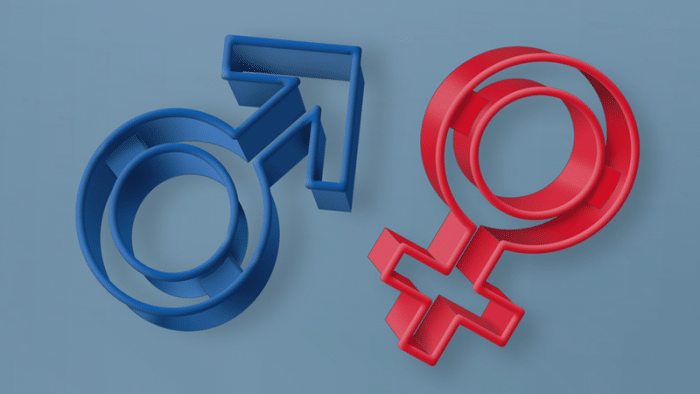
Der US-Psychologenverband APA hat Richtlinien für einen Umgang mit Jungen und Männern veröffentlicht und spricht von "Maskulinitäten", die auf Normen konstruiert werden
Der amerikanische Psychologenverband APA hat erstmals Richtlinien für den psychologische Umgang mit Jungen und Männern veröffentlicht. Für Mädchen und Frauen gibt es solche bereits seit 2007, auch für sexuelle oder ethnische Minderheiten. Man habe 13 Jahre lang an denen für das männliche Geschlecht gearbeitet, gibt er sich allerdings selbstkritisch. Bis in die 1960er Jahre hinein sei die Psychologie die der (weißen) Männer gewesen. Die meisten Untersuchungen seien mit Männern durchgeführt wurden, zudem habe man geglaubt, eine "gesunde" Psychologie müsse daran ausgerichtet sein, dass sich Männer und Frauen mit ihren gegensätzlichen Rollenbildern identifizieren. Die "Psychologie des Mannes" werde noch kaum gelehrt, obgleich sie mit "komplexen und unterschiedlichen wirtschaftlichen, biologischen, entwicklungsbedingten, psychologischen und soziokulturellen Faktoren" assoziiert sei.
Männer hätten allgemein wegen ihres Geschlechts Vorteile und größere Macht, aber es gebe auch viele negative Folgen. Sie würden unverhältnismäßig harter Disziplin unterworfen, scheitern häufiger an der Universitätsausbildung, haben mehr psychische Probleme (vollendeter Suizid), mehr körperliche Probleme (Herz-Kreislauf) oder andere Probleme wie Gewalt, Gefängnis, Drogen, früher Tod oder Beziehungsprobleme. Aus psychologischer Sicht kommt dazu auch noch, dass Männer oft nicht Hilfe suchen, wenn sie das brauchen, und es viele Hürden gibt, geschlechtsspezifische Behandlung anzunehmen.
Männlichkeitsideologie
Im Mittelpunkt steht, was als "masculinity ideology", also als Männlichkeitsideologie, bezeichnet wird. Das wird auch die meiste Aufmerksamkeit - und Ablehnung finden. Die traditionelle Männlichkeit sei nämlich "psychologisch schädlich", wenn man Jungen zur Unterdrückung ihrer Gefühle anhält, würde das innere und äußere Folgen haben. Traditionelle Männlichkeit wird als "Stoizismus, Konkurrenz, Dominanz und Aggression" gekennzeichnet, sie sei als Ganzes schädlich, Männer, die so erzogen werden, würden weniger wahrscheinlich "gesundes Verhalten" zeigen.
Je stärker die maskulinen Normen ausgeprägt seien, heißt es mit Verweis auf eine Studie, desto eher wären die Männer geneigt, gesundheitlich riskantes Verhalten wie starkes Trinken, Rauchen oder Vermeidung von Gemüse als normal zu betrachten und selbst zu praktizieren. Insgesamt sei Maskulinität mit einer geringeren Sorge um sich selbst verbunden. Viele Männer seien so erzogen worden, sagt der Psychologe Fredric Rabinowitz, dass sie selbstgenügsam sein und auf sich selbst aufpassen können müssen: "Jeder Hinweis, dass irgendwas nicht okay ist, muss geheim gehalten werden."
Und wenn die Männlichkeit dann noch auf Fragen der Rasse, der sozialen Klasse oder der Sexualität trifft, werde es zusätzlich schwierig, da dann Vorurteile, Diskriminierung und Schikanieren ins Spiel kommen. Zwar werde die Geschlechterfrage flexibler genommen als früher, aber gerade Jungen und Männer, die aus der maskulinen Rolle herausfallen, weil sie schwul, bisexuell oder transgender sind, würden in der Familie, aber auch in der Schule oft schlechter behandelt oder zurückgewiesen werden.
Klinische Psychologen sollten sich der vorherrschenden Männlichkeitsideale bewusst sein, auch bei sich selbst. Sie sollten sich klar über die vielen damit zusammenhängenden Aspekte von der Spiritualität über das Alter bis zum ethnischen Hintergrund sein und verstehen, dass die Macht, die Privilegien und der Sexismus der Männer ihnen gleichzeitig nützt und sie in starre Rollen zwängt. "Sexismus ist ein Nebenprodukt, ein Verstärker und eine Rechtfertigung der männlichen Privilegien."
"Wenn wir die Männer verändern, können wir die Welt verändern."
Geachtet werden sollte auch auf Schul- oder Lernprobleme, die langfristige Folgen haben können. Aggression und Gewalt sollten reduziert werden, Psychologen sollten Indizien für künftigen Drogenmissbrauch und Selbstmord verstehen, Männer dabei unterstützen, ihre Gesundheit zu schützen, und Homophobie, Transphobie, rassistische Vorurteile und andere Diskriminierungen in Institutionen wie dem Strafrechtssystem bekämpfen. Unterstützt werden sollte auch der Umgang der Väter mit Kindern und "gesunde familiäre Beziehungen".
Überhaupt sei es gut, nicht von der Männlichkeit, sondern plural von Männlichkeiten zu sprechen. Die Richtlinie 1 schlägt denn auch die Akzeptanz vor, dass "Maskulinitäten auf sozialen, kulturellen und kontextuellen Normen konstruiert werden". Die Biologie wird hier nicht erwähnt, Geschlecht wird als "nicht-binäres Konstrukt" definiert, das nicht mit sexueller Orientierung gleichzusetzen sei.
Man müsse aber auch die positiven Aspekte der Männlichkeit wie Mut, Opferbereitschaft oder Führungsqualitäten unterstützen, während die "schädlichen Ideologien" wie Gewalt oder Sexismus bekämpft werden. Allerdings wird dann auch gesagt, dass es eigentlich kaum Unterschiede im grundlegenden Verhalten von Frauen und Männern gebe. So würden sich Männer ebenso sehr um ihre Kinder kümmern wie Frauen, während emotionale Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen klein seien und mitunter nicht den Stereotypen entsprechen, wenn beispielsweise Mädchen im Teenager-Alter ihren Ärger eher zeigen als Jungen.
Und das sei letztlich auch die Botschaft der Richtlinien an die Männer, also ihnen zu vermitteln, "dass sie anpassungsfähig, emotional und ganz außerhalb der Normen handeln können". Aber die Botschaft der Psychologen geht noch weiter. Wenn sie sich darum bemühen, dass Menschen aus den "Männlichkeitsregeln ausbrechen, die ihnen nicht helfen", dann könnten die Folgen weit über die psychische Gesundheit der Männer hinausreichen: "Wenn wir die Männer verändern, können wir die Welt verändern."
