15 Jahre Hartz-Reformen
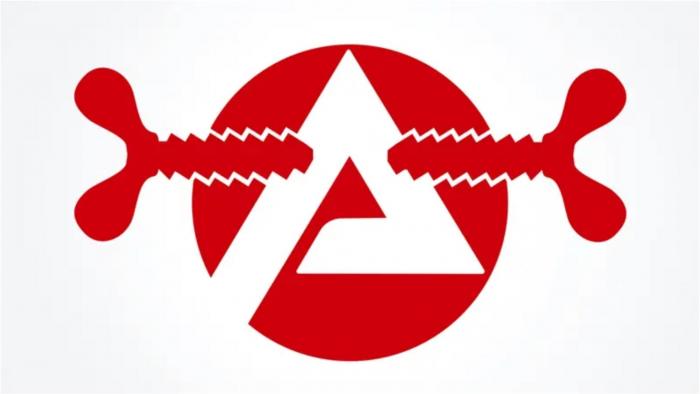
- 15 Jahre Hartz-Reformen
- Fußnoten
- Auf einer Seite lesen
Ein sozialpolitischer "Paradigmenwechsel" ist zur Selbstverständlichkeit geworden
Beim "zehnjährigen Jubiläum" der Agenda 2010, gab es noch ziemlich viel Tamtam. Diskutiert wurde, ob die als "Hartz-Reformen" in den Duden eingegangen Gesetze als Erfolg gewertet werden sollten. Ja, sie waren ein Erfolg - sagten die meisten Politiker und Journalisten, die das deutsche "Arbeitsmarktwunder" und in den zurück eroberten Konkurrenzvorsprung gegenüber anderen EU-Staaten wie in der Weltwirtschaft ins Feld führten.1
Ein kleines "Aber" gab es allerdings auch: Öffentlich wurde bedauert, dass die sozialpolitischen Änderungen der "umstrittensten Sozialreform der Nachkriegszeit" (tagesschau) zu prekären Arbeitsverhältnissen, zu mehr Armut und zu mehr sozialer Ungleichheit geführt hätten - ein Argument, das von links ziemlich stark gemacht wurde. Das war vor fünf Jahren.
Von solchen Diskussionen ist in diesem Jahr, immerhin auch ein runder Geburtstag, nicht mehr viel zu hören. Die Auseinandersetzung um die umstrittene Reform ist so tot wie Wolfgang Clement, einer ihrer "Macher". Das Leben mit Hartz IV ist offenbar zur Selbstverständlichkeit geworden - insbesondere für die fast 7 Millionen "Hartzis" (auch das ein neues Wort im Duden!), die von den Regelsätzen leben müssen, auch wenn sie das auf Dauer gar nicht können.
Selbstverständlich geworden sind auch flaschensammelnde Rentner und die seit Einführung der Reform stetig mehr werdenden Tafeln und Kleiderkammern, die das Überleben unter Hartz IV überhaupt möglich machen. Zudem bestimmen die Hartz-Gesetze direkt oder indirekt den gesamten deutschen Arbeitsmarkt, wo Arbeitnehmer sich zu vielem erpressen lassen, um nur ja dem Schicksal der Hartz-Empfänger zu entgehen: befristete Arbeitsverträge, unbezahlte Überstunden, (vermeintliche Zusicherung von) Arbeitssicherung gegen Lohneinbußen usw.
Ein Gesetz hat vor fünfzehn Jahren schlagartig die Lebenswirklichkeit von Millionen verändert. Heute, nur ein paar Jahre später, ist daraus das neue "Normal" geworden, das nicht mehr als Wirkung eines politischen Willens wahrgenommen wird. Was damals mit welcher politischen Berechnung als neue Bedingung, nach der sich alle zu richten haben, fixiert wurde, ist längst völlig aus dem Blick geraten - eine Feststellung, die nicht alleine für die Geschichte der Hartz-Gesetze gilt.
Ganz gegen die Konjunktur des Zeitgeists, der die Hartz-Gesetze wie vieles andere auch als die "eben" geltende Normalität abhakt, deshalb im Folgenden einige Erinnerungen an die Gründe (I) für die wichtigste Reform der rot-grünen Schröder-Regierung sowie ein Blick auf ihre Inhalte (II) und ihre nicht geringen Folgen (III).
Deutsche Drangsale um die Jahrtausendwende
Zu Beginn der 2000er Jahre verzeichneten die deutschen Statistiken hohe Arbeitslosenzahlen: Nach offiziellen Angaben, die üblicherweise einen gewissen Teil der wirklichen Arbeitslosigkeit nicht erfassen, ca. 5 Millionen, bei einer Arbeitslosenquote zwischen 10 und 15%. Gleichzeitig war die Staatsverschuldung massiv angestiegen - von 538 Milliarden Euro in 1990 auf 1211 Milliarden Euro in 2000. Ein nicht unwesentlicher Teil dieser Verschuldung entsprang den staatlichen Zuschüssen zu den Sozialversicherungs-Kassen. Generell galt Deutschland damals als der "kranke Mann Europas" - für seine politische Führung war das der Grund für durchschlagende Reformen.
Wie war es zu dieser Situation gekommen? In einem Land, das sich zuvor als "Modell Deutschland" gefeiert hatte? Es ist ebenso interessant wie (be)merkenswert, dass nicht - wie die populäre Erklärung meist lautet - Misserfolge und staatliches Versagen dazu geführt hatten. Eher verhielt es sich umgekehrt. Gerade die durchaus erfolgreichen Konkurrenz-Strategien der deutschen Wirtschaft in Sachen Exportnation wie die der deutschen Politik, die das Ende des Kalten Kriegs genutzt hatte, um "Ostdeutschland" zurück zu gewinnen, stellten die deutsche Regierung vor einige Probleme.
Rationalisierungen und Krisen
Die Bundesrepublik hatte ab den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts in der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG, später EU) das Mittel gefunden, den eigenen Absatzmarkt kontinuierlich zu erweitern. Mit ihren Exporterfolgen hatten deutsche Unternehmen innerhalb der europäischen "Gemeinschaft" zahllose Unternehmen und ganze Branchen niederkonkurriert. Im Gegenzug waren die deutschen Regierungen bereit gewesen, einige meist lohnintensiven Branchen zu opfern, die im europäischen Vergleich nicht mithalten konnten. Der Niedergang der Textilindustrie und Fischerei sowie die Krise der Stahl-und Werftindustrie trugen zu steigenden Arbeitslosenzahlen und der "neuen Armut" in Westdeutschland bei.
Diejenigen deutschen Unternehmen, die mittels Zugriff auf den europäischen Markt enorm an Kapital akkumuliert hatten, waren in der Lage, ihre Betriebe mit Rationalisierungsinvestitionen auf den neuesten Stand der Weltmarktkonkurrenz zu bringen. Ihre Erfolgsstrategien wie ein im Vergleich zu den Nachkriegsjahren etwas verlangsamtes Gesamtwachstum ließen die Arbeitslosenzahlen im westlichen Teil Deutschlands ab Mitte der 1970er Jahre ziemlich kontinuierlich steigen. Die fälligen "Sanierungen", etwa im Bergbau und der Stahlindustrie, wurden mit Frühverrentungen "sozialverträglich" über die Bühne gebracht.2 Die sozialen Folgekosten beim Schließen nicht mehr gewinnbringender Betriebe, vor allem in der Montanindustrie an Rhein/Ruhr/Saar, wurden damit den Beitragszahlern der Arbeitslosen- und Rentenversicherung aufgebürdet.
Die Modernisierungspolitik der deutschen Unternehmen führte somit zu massiv steigenden Ansprüchen an die Kassen der Arbeitslosen- und Rentenversicherung. Gleichzeitig sanken deren Einnahmen dadurch, dass weniger Beiträge eingezahlt wurden - was auch für die Krankenversicherung galt. In sämtlichen Abteilungen der Sozialversicherung kam es alsbald zu den berühmten "schwarzen Löchern" - kein Wunder, denn die Konstruktion dieser Kassen macht es geradezu notwendig, dass sie dann in Schwierigkeiten kommen, wenn die Einzahlungen geringer und zumindest Teile (Arbeitslosen- und Rentenversicherung) von ihnen vermehrt gebraucht werden.
Der staatliche Umgang damit war zunächst einmal eine lange Kette von Beschlüssen und Reformen, mit denen Einzahlungen erhöht, Auszahlungen verringert und Bedingungen auf Seiten der Beitragszahler verschlechtert wurden.
"Wiedervereinigung" und die Politik der "Treuhand"
Ab 1991 kam die Privatisierung der ehemaligen DDR-Betriebe dazu. Im nationalen Diskurs wird die staatliche Zusammenführung von DDR und BRD meist als "Wiedervereinigung" bezeichnet. Der Sache nach fand diese Zusammenführung allerdings als Anschluss der sozialistischen DDR an die kapitalistische BRD statt: Kein wesentlicher Bestandteil der ökonomischen oder politischen Räson der DDR blieb erhalten oder wurde von der Bundesrepublik übernommen. Alles, was in der DDR existierte, wurde unter die in der BRD geltenden Prinzipien und Gesetze subsumiert. Das gilt insbesondere für die Sozialpolitik des anderen Deutschlands.
Die Eingliederung der gesamten DDR-Ökonomie in die Bundesrepublik Deutschland führte die eigens dafür geschaffene "Treuhandanstalt" durch. Ihre Aufgabe bestand darin, das ehemalige sozialistische "Volkseigentum" in privates Eigentum zu verwandeln. Nach der Verheißung des bundesdeutschen Kanzlers Kohl sollten so "blühende Landschaften" entstehen. Verschiedene Vorstellungen und Planungen über den ökonomischen Umbau aus der Endphase der noch souveränen DDR (Anteilsscheine an Betriebsangehörige/staatliche Dachholding) wurden dabei verdrängt zugunsten der von der BRD-Führung einzig erwünschten Lösung: schnelle Privatisierung durch marktwirtschaftlich erfahrene Westmanager.
Die Treuhandanstalt hat nach der Wiedervereinigung ab Oktober 1990 über das Schicksal von rund 8500 ehemaligen Staatsbetrieben mit etwa 4 Millionen Beschäftigten entschieden. Die Betriebe wurden teilweise an Alteigentümer zurückgegeben, per Management-Buy-out versteigert, vor allem aber "abgewickelt", d.h. geschlossen: 3713 bis Ende 1994! Bezogen auf die Arbeitsplätze der ehemaligen DDR-Bürger sah die Bilanz der Privatisierung Ende 1994 so aus:
Von 4,1 Millionen Arbeitsplätzen, die zum 1. Juli 1990 bei der Treuhand zugeordneten Unternehmen bestanden hatten, waren bei bereits privatisierten oder noch in Eigentum der Treuhand befindlichen Unternehmen zusammen mit von Investoren zugesagten (!) (Hervorhebung d. Verf., weil unklar ist, wie viel von diesen Zusagen eingehalten wurde) Arbeitsplätzen Ende 1994 noch 1,5 Millionen vorhanden.
Dieter Grosser
Insgesamt war die Zerstörung an industriellem Bestand im Bereich Ostdeutschland durch die Privatisierungspolitik größer als die Schäden des 2. Weltkriegs!
Wo liegen die Gründe für diese beispiellose Deindustrialisierung?
Zu nennen sind:
- Viele der ehemals volkseigenen Betriebe erschienen aus Sicht einer kapitalistischen Kosten-Gewinn-Rechnung im vorgefundenen Zustand als nicht genügend profitträchtig. Ihnen wurde angekreidet, dass sie "zu viele" Arbeiter beschäftigen (also den neuen Kosten-Nutzen-Kriterien nicht genügen) bzw. mit einem "überalterten" Maschinenpark ausgestattet sind ("Überalterung" misst sich in einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation nicht an der Funktionsfähigkeit von Maschinen, sondern daran, ob diese auf dem letzten Stand der weltwirtschaftlichen Konkurrenz mithalten können).
- Eine Weiterexistenz dieser Betriebe würde insofern eine kapitalistische "Sanierung" erfordern, die die Betriebs- (sprich: vor allem die Arbeits)kosten durch Rationalisierungsinvestitionen senkt und die Betriebe für ihren neuen Zweck - Gewinnerwirtschaftung in der marktwirtschaftlichen Konkurrenz - herrichtet. Tatsächlich verkaufte die Treuhandanstalt viele DDR-Betriebe mit dieser Zielsetzung an westliche Unternehmer und zahlte diesen enorme Subventionen für die vorstellig gemachten Sanierungskosten. Angesichts der bereits existierenden Überfüllung der Märkte kauften viele (West-)Unternehmen die DDR-Betriebe aber nur, um sie nach Auslaufen gewisser Übergangsfristen zu schließen und sich so eine eventuelle neue Konkurrenz aus dem Weg zu räumen (Beispiel: Schließung des Kali-Bergwerks in Bischofferode durch den neuen West-Eigentümer Kali und Salz).
- Dieses Schicksal traf auch Unternehmen der DDR, die mit neuer und damit konkurrenzfähiger Technologie ausgestattet waren (etwa die gerade gebaute Glasfabrik Ilmenau, die in der Lage gewesen wäre, große Teile des europäischen Markts zu bedienen). Sie wurden verkauft und geschlossen.
- Zur negativen Rentabilitätsbeurteilung der volkseigenen Betriebe trug bei, dass deren bisherige Kunden just im Moment der Privatisierung wegbrachen - denn zur selben Zeit lösten sich mit dem Auseinanderfallen des "Ostblocks" die wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Staaten auf. Statt der bisher üblichen staatlichen Verrechnungseinheiten sind nun Weltmarkt-Devisen (Dollar, Dmark) für die Produkte zu zahlen, was die alten Handelsbeziehungen des RGW (Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe) schlagartig zum Erliegen brachte.
- Ebenso konnte die DDR-eigene, besondere Fertigungstiefe ihrer Betriebe und ihr ziemlich einzigartiges Recycling-System (beides zustande gekommen, weil die DDR-Produktion sich von Zulieferern/Rohstoffimporten möglichst unabhängig machen musste) vor den neuen Rentabilitätskriterien nicht standhalten. Auch das brachte das Aus für unzählige Betriebsteile und ganze Unternehmen mit sich.
Obwohl es also durchaus stimmt, dass ein Teil der "abgewickelten" Betriebe stillgelegt wurde, weil bereits existierende kapitalistische Unternehmen sich auf diese Art Markt- und Konkurrenzvorteile verschaffen wollen, ist die besonders bei Ex-DDR-Bürgern verbreitete Vorstellung von einer Art bösartigem Masterplan zur Abwicklung ihrer Arbeitsplätze verkehrt.
Die neuen Eigentümer, meist westdeutsche Unternehmen, handelten ihrer Marktlogik gemäß - und die orientiert sich nicht daran, wo "gute Arbeit" geleistet wird oder Menschen Einkommensquellen brauchen, sondern fragt in aller brutalen Sachlichkeit, wie sie ihren Konkurrenzerfolg erringen bzw. absichern können. Wenn dafür eine Betriebsschließung nützlich erschien, dann war (und ist!) das ein ebenso taugliches Mittel wie an anderem Ort eine Milliardeninvestition.
Die vor die Tür gesetzten Arbeiter der Ex-DDR werden damit praktisch konfrontiert mit dem ehernen Grundgesetz der Marktwirtschaft, nach dem es einen Arbeitsplatz und eine Existenzmöglichkeit nur geben kann, wenn damit ein Unternehmen einen seinen Kalkulationen entsprechenden Gewinn macht - ein Grundsatz, dessen Härte ihr alter sozialistischer Staat ihnen ersparen wollte.
Genauso wenig stimmt allerdings die Behauptung der meist westlichen Stimmen, die Zerschlagung der DDR-Wirtschaft bringe nur zum Ausdruck, wie rückständig und ineffektiv die "Zentralverwaltungswirtschaft" schon immer gewesen sei. Bei genauerem Hinsehen sei alles noch viel maroder und bizarrer gewesen als man es sich in seinen härtesten Systemvergleichen erdacht hätte.
Unterschlagen wird in solchen Diskursen, dass die Betriebe der DDR nicht an "objektiv gültigen" "Sachzwängen" gescheitert sind, und auch nicht, weil ihre planwirtschaftliche Art des Wirtschaftens über kurz oder lang sowieso zusammengebrochen wäre. Sie sind bei der Übernahme des ostdeutschen Staats durch die Bundesrepublik einem neuen, für sie bisher nicht gültigen Zweck untergeordnet worden: Sie sollten ab sofort tauglich sein für die Erwirtschaftung von Gewinn am Weltmarkt. Gemessen an diesem Zweck hat alles Mögliche für die neuen Eigentümer nicht gepasst, was in der DDR kein Problem oder sogar gerade erwünscht war: die Beschäftigung von vielen Arbeitskräften; Maschinen, die nicht auf dem neuesten Stand der Weltmarktkonkurrenz waren; soziale und kulturelle Einrichtungen des Betriebs.
Mit allen erdenklichen sozialstaatlichen Konstruktionen (Kurzarbeit Null, Frühverrentung, Beschäftigungsgesellschaften, Qualifizierungsprogramme der Arbeitsämter) versuchte die Kohl-Regierung, die Massenentlassungen auf dem Gebiet der früheren DDR in statistisch unauffälligere Formen zu überführen und soziale Proteste durch zeitliche Streckung und eine Individualisierungsstrategie zu verhindern. Trotzdem blieben Demonstrationen und Proteste nicht aus - es bildeten sich erneut "Montagsdemonstrationen", nun als Opposition gegen die Betriebsschließungen.
Diese zwischenzeitlich durchaus massenhaften Demonstrationen gegen die "Treuhand" und sonstigen Proteste (Betriebsbesetzung, Hungerstreik) der Arbeiter wurden mit Hinweis auf die nun einwandfreie demokratische Legitimation der deutschen Herrschaft und auf die ökonomische Alternativlosigkeit des Vorgehens der Treuhandanstalt zurückgewiesen. 1991 erschoss die RAF (Rote Armee Fraktion) den Treuhandchef Rohwedder als "Arbeiterfeind". Über die Beurteilung des Anschlags durch die Bevölkerung der Ex-DDR ist offiziell nichts weiter bekannt. Die neue Chefin Birgit Breuel fuhr mit der Arbeit unter dem Motto "Privatisierung geht vor Sanierung" fort.
Steigende Arbeitslosenzahlen
Die Arbeitslosenzahlen im Gebiet der ehemaligen DDR stiegen von 1990 an auf einen Höchststand von über 22% Anfang des Jahres 2005. Parallel dazu wanderten zwei Millionen Menschen von Ost nach West, was in diesem Fall niemand als "Abstimmung mit den Füßen" über deren neues, freies Vaterland nehmen sollte. Die neuen Bundesbürger wandern ja in aller Freiheit lediglich ihren Arbeitsplätzen hinterher und machen so sachgemäßen Gebrauch von der grundgesetzlich gewährten Freizügigkeit im vergrößerten Bundesgebiet. Die Geburtenrate, die in der DDR zuvor bei 1,6 Kindern gelegen hatte (BRD 1,3) brach in den neuen Bundesländern stark ein und erreicht 1994 mit 0,7 Kindern ihren tiefsten Wert.
Auch die wiedervereinigten "Brüder und Schwestern", die unter den Bedingungen der ersehnten Freiheit massenhaft keine Einkommensquellen mehr finden, wurden per staatlichem Beschluss aus den bundesdeutschen Sozialkassen finanziert. Sie haben zwar nicht eingezahlt, aber der deutsche Staat garantierte ihre Ansprüche, um die sozialen Folgen des ökonomischen Kahlschlags abzufedern, die Betroffenen zu befrieden und die neu etablierte Eigentumsordnung und ihre politische Verwaltung nicht unnötig zu gefährden.
Inanspruchnahme der Sozialkassen
Die Kosten für die marktwirtschaftliche Privatisierung der ostdeutschen sozialistischen Ökonomie halste der deutsche Staat auf diese Weise zu einem guten Teil den Arbeitnehmern und ihren Kassen auf: Arbeitslose, Umzuschulende und (Früh)Rentner wurden mit ihren im DDR-System angesammelten Ansprüchen in die westdeutschen Sozialversicherungen übernommen. Der westdeutschen Regierung kam es zu diesem Zeitpunkt unbedingt darauf an, ihren neuen Bürgern angesichts der massenhaften Arbeitsplatzverluste das Gefühl zu vermitteln, dass sie sich auf die soziale Absicherung in ihrem neuen Vaterland verlassen können. Bedenken, dass diese vom Kassenstandpunkt aus "zweckfremde" Inanspruchnahme der Sozialversicherungen und die entsprechende Belastung des Staatshaushalts zum Problem werden könnte (wie sie der damalige SPD-Kanzlerkandidat Lafontaine geäußert hat), wurden als "unpatriotisch" charakterisiert und nach Kräften ins politische Abseits gedrängt.
Die vereinigungsbedingte Sonderkonjunktur der westdeutschen Wirtschaft, die den "Zonis" die ersehnten Westwaren, insbesondere Autos, verkaufen konnte, sorgte in den ersten Jahren der 1990er noch für eine gewisse Entlastung am Arbeitsmarkt und in den Sozialkassen, doch dann setzten auch im Westen erneut Entlassungen und Rationalisierungsinvestitionen als unternehmerische Antwort auf Absatzprobleme ein. Die Arbeitslosenzahlen wurden kontinuierlich größer - im Jahr 2005 wurden (neben einer Dunkelziffer nicht gemeldeter) etwa 5 Millionen regierungsamtlich gezählt. Die "schwarzen Löcher" in sämtlichen Kassen wuchsen konstruktionsbedingt mit. Damit stieg der Zuschuss, den der nun endlich "alternativlose" Weststaat aus seinen Haushaltsmitteln in die Arbeitslosen- und vor allem Rentenkasse zu leisten hatte.
Mit ihm wuchs das staatliche Bedürfnis nach durchgreifenden Reformen auf diesem Feld.
Renate Dillmann/Arian Schiffer-Nasserie: Der soziale Staat. Über nützliche Armut und ihre Verwaltung. Ökonomische Grundlagen/Politische Maßnahmen/Historische Etappen. Hamburg 2018