Atomwaffen: Was, wenn die nukleare Abschreckung scheitert?
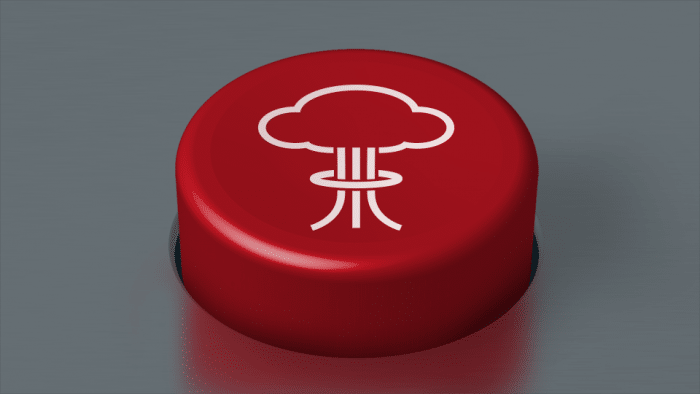
Bei wachsenden Spannungen setzt der Westen auf Abschreckung. Das ist ein gefährlicher Irrweg. Sicherheitspolitik muss demokratisiert werden. Ein Gastbeitrag.
Der Frieden ist das Meisterstück der Vernunft.
Immanuel Kant
Meines Erachtens hat es niemals eine Chance gegeben, dass die atomare Abschreckung das Friedensproblem für immer lösen würde: Diese Lösung wirkt auf mich wie eine hirnverbrannte Verrücktheit.
Carl Friedrich von Weizsäcker
Obwohl es um die Friedensbewegung ein wenig still geworden ist, bleibt die Sicherheitspolitik ein zentrales Thema von öffentlichem Interesse. Sicherheitspolitische Belange sind heute nicht mehr ausschließlich Wissenschaftlern, Politikern oder militärischen Experten vorbehalten.
Wenn auch die Entscheidungsverantwortung über Sicherheit und Frieden letztendlich im westlichen Bündnis bei den Mandatsträgern liegt, so sind diese zumindest vor einer sensibilisierten und kritischen Öffentlichkeit zu rechtfertigen, die die Bedeutung dieses existenziellen Politikbereiches erkannt hat.
Unterschiedlichste Konzepte zur Friedenssicherung werden bis heute kontrovers diskutiert, dies auch entsprechend der Werthaftigkeit des Themas mit emotionaler Vehemenz.
Trotz grundsätzlicher konzeptioneller Unterschiede wird allerdings deutlich, dass allen Positionen ein weitgehend gemeinsames Ziel zugrunde liegt: das Bemühen um eine dauerhafte Friedensordnung in Europa und auf dem gesamten Globus.
Die Wege, die zur Erreichung dieses Ziels beschritten werden müssen, sind aber nicht deterministisch festlegbar. Nicht alle möglichen Einflussgrößen können unter sich ständig ändernden Rahmenbedingungen a priori bestimmt werden, bzw. bedacht werden.
Der Weg zum Frieden bedarf vor allem kreativer Gestaltung und ist nur als ein konstruktiver, dynamischer Prozess beschreibbar.
So ist es überhaupt denkbar, dass wegweisende und zukunftsorientierte Konzeptionen entstehen können, die eine glaubwürdige Grundlage für eine handlungsorientierte Friedens- und Sicherheitspolitik bieten.
Um eine wegweisende Konzeption zu entwerfen, ist es zuerst notwendig, die Rahmenbedingungen zu untersuchen, die die heutige internationale Politik dominieren.
Dies ist zum einen das Phänomen der Macht und zum anderen das der grenzenlosen Zerstörungskraft der Atomwaffen. Beide bedingen sich wechselseitig und haben bis heute die Sicherheitsstrategien der Staaten wesentlich bestimmt.
In seinen negativen Auswirkungen gilt Macht in der internationalen Politik als Krisenfaktor ersten Ranges. Sie ist seit Jahrhunderten eine der gefährlichsten Herausforderungen der menschlichen Existenz.
Dies gilt nicht erst seit dem Vorhandensein der Atomwaffen. In seinen philosophischen Überlegungen "Zur Theorie der Macht" macht Carl Friedrich von Weizsäcker deutlich, dass die Gefahr menschlichen Machtverhaltens in seiner Zügellosigkeit und Unbegrenztheit begründet liegt.
Diese Unbegrenztheit lässt sich nur dadurch erklären, dass sich der Mensch in einem ständigen Existenzkampf Gefahren ausgesetzt sieht, denen er aus reinem Selbsterhaltungstrieb begegnen möchte.
Je größer er die Gefahren einschätzt, desto mehr Mittel (z. B. Werkzeuge, Waffen) hält er zu seinem eigenen Schutz für notwendig. Seine Intension, eigene Machtmittel bereitzustellen, ist folglich "zweckrational" und "defensiv".
Unbegrenztes Anhäufen von Machtmitteln erfolgt immer dann, wenn der Mensch aus Einbildung Gefahren überschätzt oder aus einem übertriebenen Sicherheitsbedürfnis heraus handelt.
Verschärfend wirkt dabei eine Konkurrenz oder Rivalität zweier Parteien, die kontinuierlich um ihre eigene Existenzsicherung fürchten.
Dieses von Weizsäcker entworfene Modell der Machtkonkurrenz findet auf der internationalen Ebene seine Entsprechung im Konflikt der Welt- und Atommächte USA, Russland, China und Indien.
In der ständigen Angst vor möglicher Machteinbuße oder vor aggressiven Übergriffen des Gegners haben sie gewaltige Zerstörungsarsenale angehäuft. Die eigentlichen Antreiber im politischen Schachspiel um Positionen im Weltgefüge sind machtpolitischen Ursprungs.
Trotz der Vielfältigkeit unterschiedlicher Machtmittel ist und bleibt das militärische Gewaltpotenzial das sichtbarste und gefährlichste Instrument internationaler Macht. Aber auch der Wirtschaftsmacht kommt entscheidende Bedeutung zu.
Macht durch Wirtschaft und Militär
Machtpolitische Ziele und ökonomische Interessen stehen international in enger Wechselwirkung. Obwohl Wirtschaftsmacht im Vergleich zur Militärmacht weniger offensichtlich ist, ist sie deswegen nicht weniger erfolgreich.
Die bis heute asymmetrischen Handelsstrukturen zwischen Ländern des Südens und den westlichen Industrieländern – auch als ein Resultat aus den Kolonialstrukturen – sind ein Beleg dafür.
Es bleibt festzuhalten, dass das schrankenlose Machtstreben eine wesentliche Bestimmungsgröße für die Konfliktträchtigkeit unserer heutigen Welt ist.
Die Existenz der Atomwaffen hat zu einer grundsätzlichen Veränderung im Umgang der Machtblöcke zueinander geführt. Im Bewusstsein der zerstörerischen Wirkung dieser Waffen ist es bisher noch zu keiner direkten militärischen Auseinandersetzung gekommen.
Unter dem Druck und der Belastung gegenseitiger Zerstörung ist der machtpolitische Interessenkampf so gewichtet, dass ein unmittelbares Aufeinandertreffen bisher vermieden werden konnte.
Durch zielgenaue Trägermittel, die jeden Punkt der Erde mit gewaltiger Zerstörung treffen können, dürfte ein Krieg zwischen den Atommächten kein vernünftiges Mittel der Politik sein. Heute steht einer möglichen Gewinnerwartung eines Angriffskrieges ein gewaltiges Schadensrisiko gegenüber.
Noch zu Moltkes Zeiten galt, dass der Krieg ein Element der von Gott eingesetzten Weltordnung sei. Krieg war unbedingtes Mittel der Politik und nach dem weltlichen Verständnis der Theorie vom gerechten Krieg nur noch politischen Zwecken des jeweiligen Herrschers unterworfen.
Die Existenz globaler Vernichtungskraft hat dem Menschen Grenzen aufgezeigt und signalisiert dringlich die Notwendigkeit, sich in der Anwendung militärischer Macht zu mäßigen. Um der möglichen Unbegrenztheit der Macht begegnen zu können, wurden Atomwaffen in ein sicherheitspolitisches Konzept eingebunden.
Ein Angriffskrieg wird mit einem so hohen Risiko belegt, dass der zu erwartende Schaden erheblich größer sein wird als der mögliche Gewinn. Dieses Sicherheitsverständnis entspricht dem einfachen Modell, Macht durch Gegenmacht auszugleichen.
Alle verteidigungspolitischen Bemühungen des Westens sind auf die Verhinderung eines Krieges ausgerichtet. Innerhalb dieser Logik ist Kriegsverhütung nur über die Fähigkeit zur Kriegführung glaubwürdig.
Kriegführungsfähigkeit beschränkt sich nicht auf eine spezielle Waffenart, sondern umfasst das gesamte Spektrum konventioneller und auch atomarer Waffen. Das entscheidende Fundament der heutigen Sicherheitspolitik bildet das Prinzip der Abschreckung.
Abschreckung will einen möglichen Gegner bereits vor dem Griff zur Waffe davon überzeugen, dass sich ein Angriff nicht lohnt. Sie ist nur als rationales Denkmodell funktionsfähig. Abschreckung kann nur dann wirksam sein, wenn der Kontrahent sie als glaubhaft einschätzt.
Das setzt voraus, dass neben der Fähigkeit zur Verteidigung auch die Entschlossenheit dokumentiert werden muss, die eigenen Zerstörungsinstrumente im Ernstfall einzusetzen.
Eng gekoppelt mit der Abschreckung ist das Prinzip des Gleichgewichts. Es besagt, dass sich die Gewichte aller politischen, wirtschaftlichen und militärischen Kräfte in ihrer Gesamtheit die Waage halten müssen, um den Frieden und die Sicherheit des betroffenen Staates zu erhalten.
Atomwaffen: Widerspruch zwischen Gleichgewicht und Überlegenheit
Nun ist es bis heute nicht gelungen, das angestrebte Gleichgewicht dauerhaft zu stabilisieren. Indem man Gleichgewicht forderte, suchte man stets die eigene Überlegenheit, den eigenen Vorteil. Die Chancen für eine geopolitische Balance sind gering, zumal sich innerhalb des gültigen Paradigmas Gegner ständig misstrauen und sich erst dann sicher fühlen, wenn sie stärker sind als der andere.
Die sich ständig aufschaukelnden Bedrohungsängste führen in der Folge zu einem unbegrenzten Rüstungswettlauf. Falls die Abschreckung versagt, muss verteidigt werden.
Verteidigung ist nur dann sinnvoll, wenn das, was verteidigt wird, nicht zerstört wird. Die militärische Verteidigung im westlichen Bündnis ist eng mit dem Begriff der Vorneverteidigung verbunden.
Für die Bundesrepublik bildet die grenznahe und gemeinsame Verteidigung die eigentliche "Geschäftsgrundlage" im NATO-Bündnis. Es gilt, den Schaden für die eigene Bevölkerung so gering wie möglich zu halten.
Damit sind rasche Konfliktbeendigung und Schadensbegrenzung im Rahmen der Vorneverteidigung die Bestimmungsgrößen einer glaubwürdigen Verteidigungsoption.
In Anbetracht der gesteigerten Zerstörungswirkung konventioneller Waffen ist die lebenswichtige Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland bereits durch einen länger dauernden konventionellen Krieg gefährdet.
Mit hohen Verlusten der Zivilbevölkerung wäre zu rechnen. Wie soll ein Verteidigungskrieg, der sich nicht auf die Kampfzone einschränken lässt, räumlich und zeitlich begrenzt werden? Einziges Mittel zur raschen Konfliktbeendigung wäre für die Nato der begrenzte Einsatz von Atomwaffen.
Den Krieg damit zu beenden, scheint eher ein von Hoffnung getragenes Wunschdenken zu sein. Die heutige Sicherheitspolitik fußt auf einem auf einen Gegner ausgerichteten Sicherheitsverständnis, um möglicher machtpolitischer Expansion begegnen zu können.
Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine setzt die Nato auf Stärkung ihrer strategischen und operativen Einsatzfähigkeit. Die Mitgliedsstaaten haben umfangreiche Rüstungsmaßnahmen beschlossen, um ihre Armeen zu "ertüchtigen".
Die Verteidigungsausgaben der Bundesrepublik sollen in den kommenden Jahren auf mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes gesteigert werden: Das bedeutet konkret einen Anstieg von rund 50 auf über 80 Milliarden Euro jährlich.
Die "Verteidigungspolitischen Richtlinien 2023" benennen Russland als die größte Bedrohung für den Frieden in Europa und weltweit. Die Bundeswehr und die Gesellschaft müsse wieder kriegstauglich werden.
"Wir wollen diese Auseinandersetzung nicht nur gewinnen, sondern wir müssen", so die Verteidigungspolitischen Richtlinien 2023.
Des Weiteren wird ausdrücklich betont, dass je nach Lageentwicklung die Bundeswehr auch international einsatzfähig sein müsse.
Die Nato ist das größte Militärbündnis, das Russland konventionell überlegen und atomar ebenbürtig ist. Militärstrategisch besteht keine Notwendigkeit zu einer so gewaltigen Aufrüstung aller Nato-Streitkräfte. Auch die jährlichen Rüstungsausgaben der Nato mit über einer Billion US-Dollar liegen weit über denen Russlands.
Immer wieder im Rüstungswettlauf
Diese Entwicklung zeigt sehr deutlich, dass immer wieder die gleichen Muster der Krisenbewältigung zur Anwendung kommen. Aus einer vermeintlichen Bedrohung entwickelt sich ein Rüstungswettlauf.
Der durch Abschreckung erkaufte Sicherheitszustand ist nicht mehr stabil. Die Atomwaffenstaaten fürchten stets durch die wachsende Treffgenauigkeit der gegnerischen Trägersysteme um den Verlust ihrer Fähigkeit zum Zweitschlag.
Zudem beinhaltet die "Nukleare Teilhabe" europäischer Nato-Staaten konkrete atomare Kriegführungsoptionen mit weitreichenden Konsequenzen:
- Nuklearwaffen könnten "chirurgisch" gezielt und begrenzt eingesetzt werden.
- Rüstungstechnisch führt diese Entwicklung zur Miniaturisierung der Atomwaffen mit hoher Zielgenauigkeit sowie sicherheitspolitisch zu einer Herabstufung der "Nuklearen Schwelle".
Hier zeigt sich, dass Abschreckung weder politisch noch technisch stabil ist. Mit ihr verbinden sich kontinuierlich neue Rüstungsschübe, um die Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit aufrechterhalten zu können.
Die Folgen dieser Strategie sind Krisenanfälligkeit, Konfrontation, und Ressourcenverschwendung. Auf der politischen Handlungsebene ist der Preis dieser Sicherheit eine ständige gefährliche Grenzsituation, deren Überschreiten katastrophale Folgen für die Menschheit hätte.
Das Streben nach Sicherheit, das auf Militärpolitik fokussiert ist, trägt nicht zur Lösung der globalen Probleme bei. Der menschengemachte Klimawandel gefährdet den Fortbestand des Lebens auf unserem Planeten. Das Abholzen der tropischen Regenwälder, das Fortschreiten der Wüsten sowie die Erwärmung der Atmosphäre sind nur ein kleiner Ausschnitt der Folgen unserer Lebensweise.
Es ist festzustellen, dass die gewohnten Denkschemata der tradierten Sicherheitspolitik nicht nur einer Ergänzung und Erweiterung bedürfen. Vielmehr wäre eine neue Strategie notwendig, die zur Überwindung der atomaren Abschreckung beitragen könnte. Auf diesem Weg wären folgende Zwischenschritte denkbar:
- Der Aufbau einer nuklearen "Minimalabschreckung" mit einer zahlenmäßig begrenzten Anzahl von Atomwaffen, der alle Atomwaffenstaaten vertraglich zustimmen müssten. .
- Verhandlungen mit dem Ziel der Einrichtung atomwaffenfreier Zonen.
- Rüstungskontrollverhandlungen über nukleare Abrüstung und Reduzierung konventioneller Streitkräfte.
Eine vertraglich vereinbarte "Minimalabschreckung" scheint bei der aktuellen Weltlage zwar unrealistisch zu sein. Der Atomwaffensperrvertrag ermöglichte aber, darüber zu verhandeln.
Die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien verpflichteten sich als Unterzeichnerstaaten in dem Vertrag, über die vollständige Abschaffung aller Atomwaffen zu verhandeln.
Dass dies durchaus gelingen könnte, belegen eine Reihe von Abkommen, die durch die UN-Vollversammlung beschlossen wurden. Etwa das Verbot von Antipersonenminen und Streumunition von 1999 oder auch die Gründung des Internationalen Strafgerichtshofes 2002; prominent und von großer Relevanz sind ebenso das Pariser Abkommen zum Klimaschutz von 2015 und der Atomwaffenverbotsvertrag (AVV), der am 22.01.2021 in Kraft trat.
Krisenprävention, Verständigung und Kooperation wären das Fundament einer zukunftsweisenden Sicherheitspolitik. Der Physiker und Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker warnte schon vor über 40 Jahren, dass die atomare Abschreckung der Menschheit nur ein kurzes Zeitfenster einräume, um dem Frieden auf der Welt eine Chance zu geben.
Rolf Bader, Kaufering (Obb). 1950, Diplom-Pädagoge, ehem. Offizier der Bundeswehr; ehem. Geschäftsführer der Deutschen Sektion der Internationalen Ärzte*innen für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzte*innen in sozialer Verantwortung e.V. (IPPNW)