"Der Philosoph sollte Altgriechisch und Programmieren lernen"
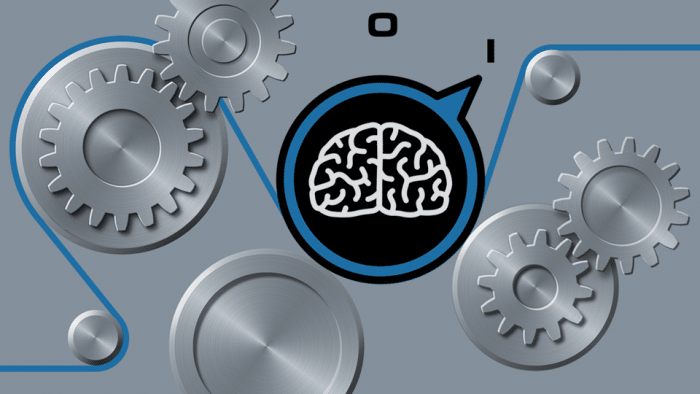
Ein Gespräch mit Martin Burckhardt über sein aktuelles Buch "Philosophie der Maschine" und die historischen Beziehungen von Apparaten und Begriffen, die zur Digitalisierung führten
Herr Burckhardt, ist es richtig, dass das theoretische Sprechen über Maschinen seit Jahrzehnten vor allem eines über "Medien" ist?
Martin Burckhardt: In der Tat - und das ist ein Zustand, der mich stets verwundert hat, umso mehr, als man in den letzten beiden Dekaden eine Art Entgrenzungs- und Aufrüstungsbewegung in Gang gesetzt hat. Da hat man nacheinander Multi-, Hyper- und Transmedialität ins Feld geführt, lauter Begriffe, die eigentlich eine Begriffsverlegenheit darstellen.
Was unterscheidet Ihren Ansatz von sogenannten "Medientheorien"?
Martin Burckhardt: Ich habe mich von Anbeginn mit der Frage beschäftigt, inwieweit der Computer überhaupt als Medium, das heißt: als Mittleres oder als Werkzeug aufzufassen ist. Die Antwort ist: Eine solche Charakteristik ergibt überhaupt keinen Sinn. Oder wenn, so nur denjenigen, dass er den Betreffenden mit dem Phantasma ausrüstet, er habe die Maschine im Griff, so wie man einen Hammer im Griff hat. Aber der Computer ist kein Werkzeug, sondern eine Werkstatt, also eine topographische, räumliche Ordnung. Lässt man sich darauf ein, ist man von vorneherein gegen jede Medientheorie geimpft.
Zudem lassen sich solche Paradoxa klären wie Steve Jobs’ Ausspruch: "Der Computer ist die Lösung. Was wir brauchen, ist das Problem." Oder noch schöner, Vilém Flussers "Wir entdecken, was wir erfunden haben." Mit der Digitalisierung erschließt sich eine neue Gedankenwerkstatt, oder wie ich sagen würde, ein Geisteskontinent, den man sukzessive erobern kann.
Einer der wenigen unmittelbaren Gewährsleute für Ihre Argumentation ist der Technikphilosoph Lewis Mumford, der 1967 den Begriff der "Megamaschine" prägte. Warum greifen Sie auf ihn zurück? Und was sind demgegenüber wesentlich neue Ansatzpunkte?
Martin Burckhardt: Was ich an Lewis Mumford stets gemocht habe, war seine Vorstellung, dass die Megamaschine aus Muskeln, Nerven und menschlichem Willen besteht. Das hat er mit Novalis gemein, der schrieb, dass das "Prinzip eines Kriegsschiffes in der Idee des Schiffbaumeisters [liegt], der durch Menschenhaufen und gehörige Werkzeuge und Materialien" all dies zu einer ungeheuren Maschine macht.
Warum ich auf dieser psychologischen Seite beharre? Nun, ich habe 1987 eine Reise in die USA gemacht, wo gerade eine heftige Debatte zur Künstlichen Intelligenz tobte - und da habe ich die Teilnehmer interviewt, Joseph Weizenbaum, Daniel Dennett, Hubert Lederer Dreyfus, ja selbst den Drogenpapst Timothy Leary, der sein LSD gerade durch den Computer ersetzt hatte. Das war genau das Befremden. Dass da eine Debatte tobte, die einiges mit religiösen Erlösungshoffnungen und Gottesbeweisen zu tun hatte, aber sich über diese Konterbande nicht klar war.
Das hat ja bis heute nicht aufgehört: Nehmen Sie nur Ray Kurzweil oder Nick Bostroms Idee der Superintelligenz, das alles sind Weltentwürfe, denen man eigentlich nur mit einem theologischen Instrumentarium begegnen kann. - Was nun Lewis Mumford anbelangt ... Nun, obwohl ich ihn schon sehr früh wahrgenommen habe, war ich zunächst gar nicht so sehr von ihm beeinflusst, oder wenn, auf eine untergründige Weise. Tatsächlich habe ich das Konzept der Megamaschine erst beim Schreiben des Buches wieder aufgegriffen.
Interessanterweise gibt es zwei deutschsprachige Autoren, die schon in Buchtiteln die "Megamaschine" aufgegriffen haben - die Sie aber nicht zitieren: Claus Eurich mit "Die Megamaschine" (1991) und Fabian Scheidler mit "Das Ende der Megamaschine" (2016). Haben Sie Ihr Projekt mit diesen Vorgängern abgeglichen? Ist da irgendwo noch ein Dialog möglich - oder, wenn nicht, warum nicht?
Martin Burckhardt: Ich muss gestehen, dass ich Eurich überhaupt nicht rezipiert habe. Vielleicht liegt's auch dran, dass man damals noch in die Staatsbibliothek pilgern musste - da gab's ihn halt nicht.
Eurich führt das Buch selbst nicht mehr in seiner aktuellen Schriftenliste. Ist es nicht so, dass Sie an gesellschafts- und ideologiekritische Projekte der 1960er bis frühen 80er Jahre eher anknüpfen als ‚reine Medientheorien‘ der letzten 30 Jahre? Ist Ihr Projekt nicht auch ein Beispiel, wie eine fundamentale Medienkritik dann derzeit auf eine sehr abstrakte Ebene führt? Eurich hat sich scheinbar entschlossen, eher in die Lebensberatung zu gehen und Menschen ins Hier und Jetzt jenseits der Medienwelt zurückzuholen. Es gibt auch noch weitere neuere Medientheorien, in denen man Anschlusspunkte zu Ihnen sehen kann, die Sie nicht in "Theorie der Maschine" erwähnen. Bei diesen anderen Autoren gibt es z. B. direktere Appelle, die bei Ihnen eher indirekt herauszulesen sind - wie bei Bernard Stiegler und seiner "Psychomacht", die sich nicht zuletzt über Medien artikuliert.
Martin Burckhardt: Der Eindruck stimmt schon. Wenn’s Einflüsse gibt, dann fallen sie in die Jugendzeiten zurück (lacht). Flusser, Lyotard, Baudrillards "Der symbolische Tausch und der Tod". Meine Zurückhaltung reinen Medientheorien gegenüber hat damit zu tun, dass mir ziemlich früh klar wurde, dass man zu einer Theorie überhaupt nur gelangen kann, wenn man sich über die Geschichtlichkeit im Klaren wird, genauer, in welchem Maße die eigene Begrifflichkeit noch immer mit den Toten parliert. Was ich niemals als Nachteil empfunden habe. Manchmal ist das Gespräch mit einem Toten sehr viel anregender, als wenn man sich mit einem hypernervösen Zeitgenossen herumschlagen muss.
Und Fabian Scheidler? Der hat ja nach eigener Aussage ein Buch geschrieben, das die letzten fünftausend Jahre behandelt.
Martin Burckhardt: Wenn ich es recht verstehe, nutzt er die Megamaschine als Passepartout, so wie man früher vom "System" gesprochen hat. Und genau hier liegt die Gefahr der Mumfordschen Megamaschine - dass sie zur bloßen unverbindlichen Metapher verkommt. Damit aber erweist sich ihr größter Vorteil, die Einbeziehung der menschlichen Dimension, auch als ihr größter Nachteil. Da kann man träumen, es sei möglich, aus der Megamaschine auszusteigen.
Hat es eine dem Computer vergleichbare universale Maschine schon einmal gegeben?
Sie würden also eine eher positive, affirmative Sichtweise bevorzugen?
Martin Burckhardt: Ja, als ich begonnen habe, über die Maschine nachzudenken, habe ich mich in der Position eines Ethnographen gefühlt, der ohne jeden ideologischen Ballast zunächst einmal nur zu verstehen versucht. Dabei war die Ausgangsfrage überaus einfach. Sie lautete: Hat es eine dem Computer vergleichbare universale Maschine schon einmal gegeben? Die Antwort ist: Ja, es gibt den Räderwerkautomaten des Mittelalters, der sich z. B. in Gestalt einer Papiermühle, einer mechanischen Uhr, aber auch eines Programms artikuliert, das eine Figurengruppe an einer Kathedrale steuert.
Genau da lag schon die erste Überraschung. Denn ich war, philosophisch erzogen, davon ausgegangen, dass die mechanische Uhr in die Zeit der mechanistischen Philosophie fallen müsste, in das 17. Jahrhundert eines Bacon, eines Newton, eines Descartes. Aber das ist nicht der Fall: Es gibt mechanische Uhren bereits im 12., 13. Jahrhundert. Wie also kommt es, dass Descartes sich gleich um fünf Jahrhunderte verspätet? Und was ist, im Umkehrschluss, ein solcher Automat, der als Objekt bereits eine solche Philosophie in sich trägt? Wie kann ich mit einem Ding ohne Denker operieren?
Wenn eine solche Frage auf dem Tisch liegt, kann man z. B. die Philosophen, aber auch die Scholasten des Mittelalters nicht mehr zum Nennwert nehmen. Denn haben wir den Denker ohne das dazugehörige Ding. Folglich muss man in Betracht ziehen, dass der philosophische Diskurs eine Art Phantomschmerz ist, dessen vorzügliche Funktion in der Übertönung einer als beunruhigend empfundenen Wirklichkeit besteht.
Um ein Beispiel zu geben: Mit der mechanischen Uhr, das ist unvermeidlich, wird Zeit Geld. Und fordert wiederum Zinsen. Das konfligiert aber unmittelbar mit der Idee des Geldes, das dem Souverän gehört und als Wertmesser betrachtet wird - wie eine Art Thermometer. In einer solchen Logik ist es undenkbar, dass der Wert des Geldes zu schwanken beginnt. Aber da die Feudalherren der Zeit zu Falschmünzerkönigen mutierten, die Münze ihres Nachbarn einschmolzen und, mit minderwertigen Metallen versetzt, zu einem doppelt so großen Goldschatz auftürmten, war Inflation unvermeidlich. Eigentlich, so würde man annehmen, sollte damit eine Diskussion über ein besseres Geldsystem anheben - aber weit gefehlt. Es gibt ungefähr achtzig Denkschriften der großen Scholasten, von Thomas von Aquin über Albertus Magnus bis zu Martin Luther, die sich allesamt mit der Frage des "gerechten Preises" beschäftigen - also das Thema verfehlen. Denn natürlich hat die Frage der Inflation nichts mit Individualmoral zu tun.
Diese Erfahrung hat sich mir tief eingebrannt. Wenn ich mich also in die mittelalterliche Theologie und Naturwissenschaft versenke, so nicht nur, um zu verstehen, was da gesagt wird, sondern auch, um zu verstehen, wie der sich anbahnende Kapitalismus genauer ausgeblendet wird. Genau hier beginnt mein Problem mit vielen Zeitgenossen, ob das nun der Ausstieg aus der Megamaschine ist oder das Beharren darauf, dass "souverän ist, wer über seine Daten verfügt", wie einige Zeitgenossen das in einem digitalen Manifest deklariert haben. Das erscheint mir wie ein Revirement eines scholastischen Diskurses. Man sollte über das System reden, aber schlägt sich stattdessen mit der Moral herum.
Das Reden über Maschinen wirft u. a. ein methodisches Problem auf: Es gibt einige theoretische Begriffe der Maschine, die man sehr weit fassen kann. Gilt das vielleicht umso mehr beim heute erreichten Stand der Digitalisierung?
Martin Burckhardt: Ja, man kann beobachten, wie sich im Schatten der Digitalisierung der dinghafte Begriff der Maschine auflöst. Würde man unsere Smartphones mit der Röhrentechnologie der ersten Computer bauen wollen, so wäre jeder Mensch im Besitz des größten Bauwerks der Welt, eines Bauwerks, das so energiehungrig ist, dass es den Elektrizitätsverbrauch ganzer Staaten übersteigt. Insofern konfrontiert uns die Digitalisierung mit einer Verzwergungsbewegung. Man könnte von einem Übertritt ins Postmaterielle sprechen.
Mit den immateriellen Geistkörpern, die uns die Bots und Algorithmen vorführen, kehrt die ursprüngliche, längst vergessene Bedeutung der Maschine zurück. Die alten Griechen haben ja, wenn sie von der mechane sprachen, nicht auf ein Gerät, sondern auf eine List, den Betrug an der Natur abgehoben. Deswegen gibt es am Anfang auch keine materiellen Maschinen zu bestaunen, ist die technologia ein Sammelbegriff für rhetorische Tropen.
Das ist für Leser sicher wichtig zu verstehen: Es geht Ihnen zentral darum, Konstruktionsprinzipien von Technik in Prinzipien der Logik, des menschlichen Denkens und Handelns aufzuzeigen. Ist das nicht durchaus schon ein Kernbestand vieler Medientheorien? Bei Benjamin übt der Zuschauer mit der Filmkamera das "Testende" und Prüfende des maschinisierten Blicks, bei Virilio entgrenzt die motorisierte Schnelligkeit das Raumempfinden und strukturiert die Zeit um usw. - Es würde im Gespräch mit Medientheoretikern immer schnell um die Frage gehen, wo ein Medienbegriff seine Grenze hat und wo andere Diskurse zuständig werden oder zumindest als solche benannt werden sollten. Wie kann man Ihre Methode und Stellung zur Theorietradition hier mit einem möglichst einfachen Begriff nochmal auf den Punkt bringen?
Martin Burckhardt: Das Dilemma ist - und das habe ich der Verklammerung von der ars memoria und der ars oblivionis, also der Gedächtnis- und Vergessenskunst, deutlich zu machen versucht -, dass man häufig gar nicht weiß, dass man es mit dem Ableger eines Maschinenkonzepts zu tun hat. Nehmen Sie den Begriff der isonomia, den man zu Platons Zeiten dem Begriff der Demokratie vorzog - weswegen Herodot die isonomia, die Gleichheit vor dem Gesetz, als vornehmsten Begriff überhaupt tituliert. Wenn Sie diesem Begriff nachspüren, sehen Sie, dass er sich der Inthronisation des deus ex machina verdankt …
Das müssen Sie jetzt aber erklären!
Martin Burckhardt: Sie haben Recht, das erschließt sich nicht unmittelbar. Ich versuche es trotzdem. Mit dem deus ex machina, der erstmals in Aischylos’ Eumeniden auftaucht, wird eine irdische Form der Rechtsprechung etabliert, werden andererseits die Götter aus dem Spiel genommen. In der autonom gewordenen Polis wiederum etabliert sich jener Bürgersinn, den die Bürger an den isomorphen Zeichen des Alphabets erlernt haben - und nun, als Gleichheitsprinzip, auf sich selbst übertragen. Um das herauszupräparieren, muss man jedoch wie ein Ethnologe oder ein Psychoanalytiker verfahren, man muss die Fremdheit des scheinbar Selbstverständlichen wieder in Erinnerung rufen. Darauf hat Benjamin ja angespielt, als er von einem "photographischen Unbewussten" sprach.
Die Frage ist: Wann eigentlich erfasst man die Gesetzmäßigkeit einer Sache? Wenn ich einen Hammer benutze, spüre ich ihn kaum, er erscheint mir wie eine Erweiterung meiner Hand. Erst im Zustand der Dysfunktion oder des Noch-nicht gerät das Werkzeug selbst in den Blick. Aus diesem Grund habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, die Dinge in statu nascendi zu betrachten. Die Einsichten, die sich hier auftun, stehen freilich im krassen Gegensatz zu vielen Medientheorien. Konkretes Beispiel: Wenn Sie nach dem Ursprung des Computers fragen, wird Ihnen, wie aus der Pistole geschossen, irgendein Name genannt: man spricht von einer Turing- oder von-Neumann-Maschine, möglicherweise sucht man auch bei Konrad Zuse Unterschlupf oder hält sich an die Macy-Protokolle.
Demgegenüber würde ich die Maschine wie eine gotische Kathedrale betrachten wollen, deren Bau sich über mehrere Jahrhunderte erstreckt hat. Mit einer solchen Charakterisierung verschwindet die heroische Betrachtung, man ist nicht mehr versucht, zu behaupten, man hätte die Sache im Griff. Damit erübrigen sich auch jene willkürlichen Grenzziehungen der Medienwissenschaft, die ja, in der Regel, ebenso unverhohlene wie willkürliche Besitzansprüche markieren, akademische Pissmarken, wenn Sie so wollen. Aber wie wollen Sie ohne Quantenmechanik einen Transistor in die Welt entlassen? Und was wäre die Medientheorie ohne ihr Forschungsobjekt?
"Jedes Menschenwerk ist auch mit dem dazugehörigen Menschenwahnsinn verknüpft"
Einige Ihrer Diagnosen sind finster - verbleiben aber auf einem sehr theoretischen Niveau. Mögen Sie uns etwas davon verraten, wo Sie heute auf einer soziopsychologischen und letztlich politischen Ebene die Problematiken einer technisierten Gesellschaft sehen?
Martin Burckhardt: Hmm … Vom Temperament her, aus künstlerischer Neugierde, wenn Sie so wollen, bin ich von den Möglichkeiten des Neuen absolut fasziniert. Das hat mich dazu gebracht, dass ich selbst im fortgeschrittenen Alter tief in die Welt der Programmierung eingestiegen bin.
In diesem Sinn wünsche ich mir keinen Exodus, keinen Austritt aus der Megamaschine, sondern dass man endlich, und zwar ganz und gar, einsteigt. Hier kommt allerdings, und das mögen Sie als finster bewerten, der Historiker in mir zum Vorschein, derjenige also, der die Geburt einer universalen Maschine gründlich studiert hat. Und da sind die Parallelen wirklich beängstigend. Das späte Mittelalter, das mit solchen Fremdkörpern wie Geld, Zins, Arbeitsteilung, aber auch der Zentralperspektive zu tun bekam, verfiel in dem Augenblick, da die anfängliche Begeisterung über den Räderwerkautomaten abebbte, in geradezu wütende Abwehrmechanismen. Antisemitismus, Ablasshandel, Inquisition, Hexenverbrennungen, all die Dinge, wie wir dem "finsteren Mittelalter" anlasten, sind in Wahrheit Resultate des Spätmittelalters. Der Hexenhammer, der Malleus maleficarum, wird im Jahr 1486 veröffentlicht und qua Buchdruck verbreitet, dem Jahr, da Sandro Botticelli die "Geburt der Venus" malte.
Eine ähnliche konstitutionelle Schizophrenie lässt sich heute beobachten. Gerade in dem Maße, in dem immer größere Teile unserer Lebens- und Gesellschaftswirklichkeit programmiert werden, wächst das Missvergnügen daran, entsteht jenes Delir von Identitätspolitik, Viktimismus und "Great again!"-Populismus, das - und das ist das Beunruhigende daran - auch die digital natives nicht im mindesten ausnimmt. In dieser merkwürdigen Melange aus Phantomschmerz und Phantomlust tritt die phantasmatischen Seite der Maschine hervor, nämlich, dass jedes Menschenwerk auch mit dem dazugehörigen Menschenwahnsinn verknüpft ist.
"Die Maschine, das ist nicht der große, böse Andere, die Maschine, das sind wir selbst!"
Wie kann eine Technik-Theorie in diesem Setting denn sinn- und wirkungsvoll intervenieren?
Martin Burckhardt: Wenn Sie Kants kleinen Aufsatz "Was ist Aufklärung?" lesen, dann erfahren Sie, dass es sehr bequem ist, unmündig zu sein. Kant plädiert dafür, dass der Selbstdenker sich seines Verstandes bedienen soll, ohne dass eine geistliche oder weltliche Autorität oder auch nur ein Buch für ihn denkt. Der Text endet mit dem Satz, dass der Mensch, der nun mehr ist als eine bloße Maschine, seiner Würde gemäß behandelt werden müsse. Darin steckt, implizit, die Einsicht, dass die Würde im Jenseits der Maschine entsteht.
Genau an dieser Stelle ist das Aufklärungsprojekt noch nicht zu Ende geführt, genauer: Es hat noch gar nicht begonnen. Man hat sich von geistlichen oder weltlichen Autoritäten emanzipiert, aber die Frage der Maschine, als eine gesellschaftsbestimmende Instanz, ist noch immer terra incognita. Wenn in den Diskursen vom Fluch und Segen der Technik die Rede ist, dominiert ein religiöses Vokabular, das wiederum grundiert ist von der Vorstellung, als sei die Technik ein Fatum, das über uns thront, ein kleiner schwarzlackierter Komet, der wie eine extraterrestrische, künstliche Intelligenz in unser Denken eingeschlagen ist. Ich hingegen würde sagen: Die Maschine, das ist nicht der große, böse Andere, die Maschine, das sind wir selbst!
Wie schätzen Sie aus Ihrer Perspektive den Zustand der deutschen Kulturwissenschaften ein? Sind diese für das schon angebrochene digitale Zeitalter wirklich gut gerüstet?
Martin Burckhardt: Wenn ich sehe, wie sehr man sich an den Medienbegriff klammert, habe ich meine Zweifel. Mir fehlt insgesamt das Bewusstsein der Historizität. Ich sage das als jemand, der schon in den 90ern Computerpioniere wie Babbage oder Ada Lovelace herausgegeben hat. Wenn man sich in die Geschichte des Computers hineinversetzt, gewinnen Sie einen anderen Blick. Es lassen sich die Phantasmen herauspräparieren, man gewinnt ein Bewusstsein, worin die eigentlichen Brüche und Triebkräfte bestehen.
Wenn ich z. B. die Aussage treffe, dass der "Computer eine Maschine zur Verwaltung von Populationen" ist und wenn ich dazu auf die Boolesche Formel abhebe (x=xn), klingt das wie eine Botschaft aus einer anderen Welt. Wenn Sie die dazugehörige Geschichte erzählen, etwa, dass der Genozid an den Juden ohne die Hollerithsche Lochkartentechnologie so nicht möglich gewesen wäre, ja, dass selbst die berüchtigte Tätowierung auf dem Unterarm die Nummer der Hollerith-Lochkarte war, bekommt das eine beunruhigende Prägnanz. Dass man diskursiv auf irgendwelchen Wellen herumreitet, aber die Geschichte der sozioplastischen Maschine verleugnet, finde ich höchst befremdlich.
Das hat mich z. B. von Kittler getrennt, mit dem ich bei der "Interface V" lange zu tun hatte. Kittler hat seine Studenten mit allen erdenklichen Weisheiten geimpft, aber er hat sich niemals durchringen können, die Geschichte des Computers ins Auge zu fassen. Dabei hätte es schon gereicht, wenn er in der Selbstmordart seines Helden Turing mehr als nur eine Anekdote gesehen hätte - nämlich dass selbiger sich durch das Essen eines vergifteten Apfels aus der Welt herausbefördert hat. Wie Schneewittchen ...
Können Sie uns Nicht-Eingeweihten noch etwas näher erklären, was Sie damit meinen?
Martin Burckhardt: Turings Selbstmord ist ein Vermächtnis, ein Abbild seines Denkens. Das Bild des Schneewittchens, das da in seinem gläsernen Sarg liegt und auf seine Reanimation wartet, ist eine präzise Beschreibung dessen, was mit dem Digitalisierungsvorgang passiert. Da wird ein endliches Objekt in einen Kenotaph überführt, wo es jederzeit reanimiert und mit Lichtgeschwindigkeit an einen anderen Ort der Welt teleportiert werden kann. Dieses Moment der Grenzenlosigkeit entspricht exakt den Vorstellungen, die sich Turing als Heranwachsender gemacht hat, als er von einer körperlosen, idealen Kommunikation geträumt hat. Diese psychologische Seite zu unterschlagen und demgegenüber auf der abstrakten, reinen Funktionalität zu beharren, halte ich für eine unstatthafte Objektfetischisierung, ja, letztlich für Metaphysik.
Die große Entwicklungslinie ihrer historischen Durchsicht führt von der Entstehung der Schrift über die Mechanisierung hin zu Maschinen, die reine Information prozessieren. Was sind Erkenntnisgewinne, die Sie Lesern Ihres Buches hierzu versprechen können?
Martin Burckhardt: Idealiter folgt mir der Leser in meiner Erzählung - und gewinnt einen neuen, man könnte auch sagen: grundfremden Blick auf die Welt. Ein praktischer Mehrwert wäre, dass er sich überflüssige Diskurse und Torheiten erspart. Zum Beispiel: diese ermüdende Debatte über Analog-Digital, die nichts als Nebelkerzen produziert. In dem Augenblick, da die Kultur die icons aus den Zeichen heraustreibt (also den Ochsen aus dem Aleph-Zeichen exorziert), entsteht jene weltfremde Ordnung, der wir heute, in einer neuen Iteration wieder begegnen. Wir sind, als alphabetisierte Wesen, längst aus der Natur herausgefallen. Also digital, durch und durch.
Nietzsche hat einmal sehr schön diesen Mechanismus beschrieben: Zuerst versteckt man die Ostereier - und dann, oh Wunder, findet man sie wieder. Strenggenommen ist es noch ein bisschen abgründiger. Denn das Osterei, das man versteckt, ist die mechane, der Betrug an der Natur - und wenn man es wiederfindet, gibt man dieses Ei sonderbarerweise als Natur oder als Naturphilosophie aus. Die Philosophie, die diesen Zaubertrick vorführt, gleicht einem Magier, der seinem eigenen Zaubertrick aufsitzt, und zwar dadurch, dass er die Maschine zu Metaphysik, zum ewigen Sein aufrüstet. A=A=A.
Die Wahrheit aber ist: Was wir "Natur" nennen, geht auf einen Begriff von Maschine zurück. Deshalb bezieht sich beispielsweise das Wort, das die alten Griechen für die alphabetische Letter benutzten, stoichos, gleichermaßen auf die Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft, ebenso wie auf die Hoplitenschar, die in Reih und Glied, ein Typ neben dem anderen, voran marschiert. Nun, was treiben wir heute anderes, wenn wir behaupten, dass unsere Gehirne Prozessoren entsprechen und Informationsverarbeitung betreiben? Metaphysik, digitale Metaphysik.
"Die Maschine strukturiert die Art und Weise, wie wir über die Götter, die Gesellschaft und über uns selbst denken"
Sie verwenden als einen weiteren Schlüsselbegriff "Sozioplastik". Was ist damit gemeint?
Martin Burckhardt: Dieser Punkt liegt mir wirklich am Herzen. Ich rede im Zusammenhang von der universalen Maschine von einer theo-, sozio- und psychoplastischen Instanz. Damit ist gemeint, dass die Maschine die Art und Weise strukturiert, wie wir über die Götter, die Gesellschaft und über uns selbst denken. Man beginnt erst von Pünktlichkeit und Taktgefühl zu reden, wenn eine mechanische Uhr existiert. Das Dilemma ist nur: Die Maschine hat die merkwürdige Tendenz, dass sich ihre Anfänge verunklaren. Sie wird zur black box, die zudem internalisiert wird - und als eine Form des Unbewussten erscheint. Anders als das Freudsche Unbewusste, das so etwas wie eine Naturausstattung ist (die "Urhorde in uns", wie Freud sagt), ist dieses Unbewusste ausgelagert. Es vermittelt sich im Umgang mit der Maschine.
Nun - wir können das in unserer Gegenwart wunderbar beobachten. Wir sehen die Emergenz von lauter Geschäftsmodellen, die sich auf die Gesetze von Moore und Metcalfe beziehen, also exponentielle Beschleunigung und Netzwerkeffekt, und sehen, dass sich das in der Gesellschaft einfach einhaust. Like it or not!
In Afrika ist das noch viel radikaler. In Ermangelung eines Banken- oder Gesundheitssystems verbreitet sich die blockchain rasant, kann man förmlich sehen, wie die Technologie eine neue Welt gleichsam evoziert. In alledem erweist die universale Maschine als symbolische Ordnung, als Quell aller Souveränität. Wir können uns tausendmal wünschen, dass wir echt, analog und unplugged sind, letztlich setzt sich das Alphabet durch. Das ist der Grund, weshalb ich im Buch so viel Zeit auf vermeintlich religiöse Fragen aufgewendet habe: auf die Schöpfung des Zeus aus dem Geist der Metallurgie, die Gnosis etc. Ich wollte vorführen, dass die Maschine nicht bloß die Praktiken einer Gesellschaft determiniert, sondern zuallererst ihren Götterhimmel und ihr Selbstverständnis affiziert.
Sie deuten die Übergänge zu einer rein philosophischen Begriffsbildung nur an. Ein Begriff, den ich mir gleichwohl notiert habe, den Sie in Abgrenzung zu Heideggers "Gestell" und zu Foucaults "Dispositiv" geprägt haben, ist das Triebwerk. Worin besteht der Vorteil, von einem Triebwerk zu sprechen?
Martin Burckhardt: Gestell und Dispositiv - das sind Begriffe, die etwas Statisches evozieren. Ich habe mich für das Triebwerk entscheiden, weil da einerseits das Unbewusste mitklingt, andererseits aber vollkommen klar ist, dass dabei immer auch materielle Gegebenheiten im Spiel sind. Die Maschine, in ihren verschiedenen Übermalungen, ist das Unbewusste - ein Unbewusstes zudem, das sich verändert, entwickelt und technische und kulturelle Metempsychosen durchläuft.
Sie spielen immer wieder auf die Problematik der Metaphysik an, wie sie, nach Nietzsche, Heidegger aufgeworfen hat. Die Ansätze von Derrida, die sich wesentlich auf Sprache und Schrift beziehen, wirken auf viele Leser noch kryptischer. Bietet Ihre Theorie vielleicht Chancen, die Relevanz solcher Philosophien am heutigen mediatisierten Setting anschaulicher als bisher aufzuzeigen?
Martin Burckhardt: Mich hat stets interessiert, mit welch außerordentlicher Vorsicht sich die Philosophen der Frage der Metaphysik genähert haben, oder vielmehr: ihr in Gestalt von Rätselformen ausgewichen sind. Durch die Beschäftigung mit dem Alphabet ist mir klargeworden, dass das Alphabet die Bedingung der Metaphysik ist. Erst die unwandelbare Letter, als eine Art göttlicher DNA, stiftet das Phantasma des unwandelbaren, ungeschaffenen, ewigen Seins.
Ohne Alphabet keine Metaphysik und keine Philosophie. Hier zeigt sich im Übrigen, dass mein Selbstverständnis nicht das eines Philosophen ist. Das mag daran liegen, dass ich durch die Konfrontation mit dem Ding ohne Denker in ein Feld hineingerutscht bin, wo ich mich mit der Veränderung der materiellen Kultur beschäftigt habe und wo die Philosophen keine sonderlich rühmliche Rolle gespielt haben.
In meinen früheren Büchern habe ich die Auseinandersetzung mit Philosophie und Theologie geradezu peinlich vermieden. Durch die intensive Lektüre jedoch, die mich durch die gesamte Philosophiegeschichte geführt hat, ist die Frage der philosophischen Selbstverzauberung immer größer und drängender geworden. Dass die Entdeckung der Maschine auf das Ende der Metaphysik, oder, flapsig gesagt, auf den Tod des Osterhasen hinausläuft.
Interessanterweise hat dies Heidegger nach der Lektüre eines frühen Kybernetikers, Gotthard Günther, selbst begriffen: dass man die klassische Philosophie abschaffen muss, um frei philosophieren zu können. Aber was heißt das? In der antiken Philosophie, das ist bei den Sophisten noch überdeutlich, war die Vertrautheit mit der Schrift, der universalen Maschine des Alphabets, das Kapital des Philosophen. Und heute ist das, wie man weiß, digital.
Strenggenommen also müsste sich der Philosoph auf die digitale Welt einlassen. Aber wie kann man das tun? Indem man sich alphabetisiert und sich mit den Grundzügen des Schriftsystems vertraut macht. Nur so kann man sich der transformativen Kraft dieser Schrift bewusst werden - also der Tatsache, dass wir nicht aus einer Gottesperspektive heraus planen, sondern, im Umgang mit der Schrift, Gedanken herauspräparieren, Gedanken, die wir zu Anfang nicht einmal auf dem Radar hatten. Dieses Moment des iteratives Designs …
… das man auch learning by doing nennen könnte ...
Martin Burckhardt: … ganz genau, das verändert die Position des Philosophen grundsätzlich. Seine Aufgabe bestünde nun darin, sich ganz und gar auf diese neue Megamaschine einzulassen, andererseits, skeptisch, sich der Wirkungen dieser Schriftordnung bewusst zu sein und zu verhindern, dass man die Schrift vergöttlicht und zur Heiligen Schrift und ewigen Wahrheit erklärt. Verstehen Sie? Die totale Rollenumkehrung! Keine Metaphysik mehr, sondern Verhinderung von Metaphysik. Zu diesem Zweck sollte der Philosoph, scherzweise gesagt, Altgriechisch und Programmieren lernen, und zwar nicht, um das eine oder andere zur Metaphysik zu veredeln, sondern um einen freien und offenen Blick zu behalten, geistesgegenwärtig zu sein. Darum geht’s! Dass die Maschine nicht als ebenso unbewusste wie totalitäre Sozioplastik wirkt, sondern dass man die eigenen Gestaltungsräume erkennt.
Ihr Buch hat eine ungewöhnliche Form. Die Fußnoten bleiben sparsam und sind an den Schluss gerückt. Jeder Absatz trägt eine durchgehende Nummer. Was hat Sie zu dieser Konzeption bewogen?
Martin Burckhardt: Was ich an der Form gemocht habe, war die Möglichkeit der Beschleunigung, zum anderen, dass man mit Ellipsen der diskursiven Trägheit entkommt, dass man Gedankensprünge machen, Verdichtungen erzeugen kann. Das hat aber auch einen ganz praktischen Hintergrund. Viele komplexe historische Sachverhalte, mit denen ich mich manchmal über Monate, ja, Jahre beschäftigt habe, haben sich auf diese Weise auf eine handliche Größe zurechtstutzen lassen. So ist meine lange Beschäftigung mit der unbefleckten Empfängnis - die ich für die coolste Maschine, ja, für das erstaunlichste kulturelle Himmelfahrtsprojekt überhaupt halte -, auf eine Seite zusammengeschrumpft, und das gilt auch für die Geldtheorie des Mittelalters usw. usf.
Hätte ich diese Form nicht gewählt, hätte sich das Projekt ins Uferlose ausgedehnt. Und dadurch, dass das historische Material in den Hintergrund tritt, bleibt der Hauptfaden der Gedankenführung sichtbar, nämlich, die Frage, wie sich das Denken (die Philosophie) zum Ding ohne Denker verhält. Und was der Preis ist, den die Philosophie bezahlen muss, um endlich zur Sache zu kommen.
Was sind Arten der Resonanz, die Sie sich für Ihr Theorie-Projekt wünschen? Gibt es eigentlich genügend Orte, an denen hierzu das lebendige Gespräch entsteht? Und, wenn nein, was steht dem entgegen?
Martin Burckhardt: Es hat schon eine Reihe von Anknüpfungspunkten gegeben, zur Kunst- und Kulturwissenschaft, zur Ökonomie, zur Architektur, selbst zur Theologie. Das schlägt sich auch in den verschiedenen Fächern nieder, für die man mich als Gastprofessor geladen hat. Dennoch zweifle ich, ob es da so etwas wie ein "lebendiges Gespräch" gibt.
Ein Grund für die Nicht-Entstehung eines solchen ist, dass die Grenzen der Disziplinen wie Scheuklappen wirken. Wenn Sie beispielsweise über die Subjektkonstitution in der Renaissance nachdenken, dann wird Sie schon das Material dazu führen, die Zentralperspektive mit der Ökonomie, ja mit entstehender Staatlichkeit zusammenzudenken. Wenn das aber die Grenzen der Disziplin verletzt, gibt es keinen Grund, diesen Fragen nachzugehen. Intellektuell ist die Parzellierung des Denkens das größte Dilemma, gilt es, sich die Einheit der Welt vor Augen zu halten (was unter dem Rubrum des Anthropozäns, wenngleich in negativer, apokalyptischer Form auch geschieht).
Insofern glaube ich schon, dass ein Gespräch möglich ist - wie in der Renaissance, als man die Akademie, als Alternative zur mittelalterlichen Universität, wiederentdeckt hat. Dennoch gibt es dafür einen Preis zu entrichten. Niemand kann daherkommen und sagen: "Ich als Historiker, Natur-, Politik- oder Medienwissenschaftler …" Wo so viel Anfang ist, kann man sich nicht mehr auf seine Gedankenparzelle berufen. Und das geht mit einem Verlust an Privilegien und an Autorität einher.
Ich habe darin stets einen Vorzug gesehen: Denn da setzt man sich einer Frage aus, bei der die Realität nicht von vorneherein in Schubladen zerlegt worden ist. Und weil die Frage offen ist, ist mir diese intellektuelle Reise wie die Erkundung einer fremden Welt erschienen, gab es immer wieder Überraschungen, Entdeckungen, die mich völlig frappiert haben. Ich erinnere mich immer noch, wie ich auf dem Parkplatz der Staatsbibliothek stand und, während ich den Autoschlüssel hervorfingerte, ein Buch mit dem Titel "Sign and Design. The psychogenetic sources of the alphabet" hervorkramte und sah, dass das Alpha-Zeichen kein arbiträres Zeichen ist, sondern irgendwann einmal einen Ochsen dargestellt hatte. Und das war der Augenblick, als die Staatsbibliothek hinter mir sich erhob und davonflog.
Rilke hat das einmal ganz wunderbar in eine Frage gekleidet: "Ist es möglich, dass man Jahrtausende Zeit gehabt hat, zu schauen, nachzudenken und aufzuzeichnen, und dass man die Jahrtausende hat vergehen lassen wie eine Schulpause, in der man sein Butterbrot isst und einen Apfel?" Und die Antwort: Ja, das ist möglich.
Der Medienkünstler und Kulturtheoretiker Martin Burckhardt hat aktuell das Buch "Philosophie der Maschine" im Verlag Matthes und Seitz veröffentlicht.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
