Die Welt aus den Fugen: Wenn Krisen keine Metaphern sind
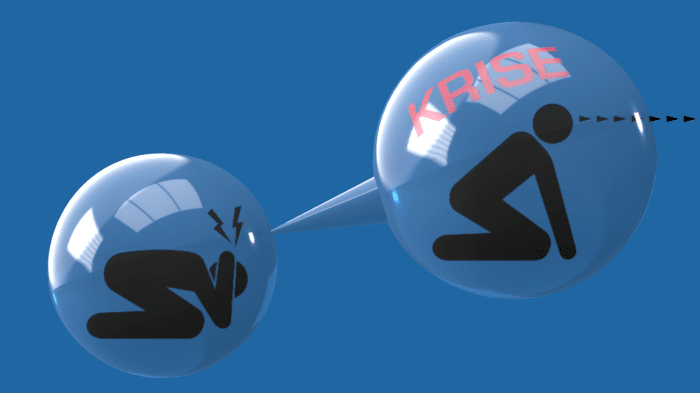
Begegnen uns Krisen nur als das, was sie sind? Als Abweichungen vom sogenannten Normalzustand? Ist der Imperativ "Maske auf!" gar ein subtiler Door Opener für politische Willkürakte?
Was verbirgt sich hinter der gegenwärtig nicht enden wollenden Covid-19-Krise? Nur flüchtige Beklommenheit oder vorübergehende Bange? Steht hinter der Bezeichnung Krise, auf deren Bedeutung wir uns aus sprachlicher Konvention geeinigt haben, gar eine Metapher? Eine, die den Begriff der Krise auf ein ganz anderes, viel abgründigeres und wesentlich furchterregenderes Phänomen verweisen lässt?
Der Reihe nach: Schwere Krisen ereignen sich seit Jahrtausenden nahezu unentwegt. Von der Krise der Gesellschaft ist periodisch wiederkehrend die Rede, von Zeit zu Zeit dominiert jene der Wirtschaft, danach geraten abwechselnd Politik und Kultur in die Bredouille. Vorübergehend werden die Krisen der Kirche, immer wieder jene der Umwelt und Natur virulent; gegenwärtig raubt ein Virus der Welt den Atem. Katastrophen und Kalamitäten können je nach Opportunität stilisiert, beschworen und damit sprachlich verstärkt, angeheizt oder überhaupt erst medial erzeugt und in die Erscheinung gebracht werden.
Aufgrund der schieren Häufigkeit ihrer Anwendungsfälle vermeinen wir Krisen nicht nur zu kennen und zu erkennen, sobald wir diesen begegnen, sondern auch noch, diese in ihrer Substanz zu verstehen. Doch selbst wenn wir bereits wiederholt auf der einen oder anderen Ebene unserer Lebenswirklichkeit in Notsituationen geraten und auf Katastrophen gestoßen sind, haben wir alleine durch diese Begegnungen noch nicht verstanden, was Krisen ihrem Wesen nach sind; wovon die Rede ist, wenn man von Krisen spricht.
Krise als sprachliche Escape-Strategie
Was, wenn die Krise als Krise gar kein Phänomen im klassischen Sinne, sondern primär die metaphorische Beschreibung eines Symptoms darstellt? Jenes Symptoms, das erst dann entsteht, wenn wir vom verstörenden Eigentlichen der Angst ablenken, welches sich plötzlich in die Mitte des Daseins drängt. Falls dies zutrifft, existieren Krisen nicht als Phänomene, sondern als sprachliche Versuche, mithilfe der Metapher der Krise die menschliche Hinfälligkeit verbal zu rationalisieren: die Krise als Beschwörung der Angst.
Eine kurze Begriffsbestimmung soll zunächst der Vielgestaltigkeit des Terminus Krise einen Rahmen geben: Das altgriechische Nomen krísis bzw. sein Verb krínein umfasste einerseits die Bereiche des Sichtens, Unterscheidens und Trennens und andererseits die Aspekte des Entscheidens, Beurteilens, ja sogar jene des Verurteilens. Eine krísis eröffnete Möglichkeiten für einen sprachlichen Weg, auf dem Ansichten bestätigt, oder Unterschiede, mithin das Unterschiedene selbst sichtbar gemacht werden konnten.
Im sprachlichen Fortgang tendierten Situationen allmählich zu einer bestimmten Seite oder schlugen, etwa an einem Wendepunkt, in deren Gegenrichtung, in ein schieres Gegenteil um. Demgemäß hatte jener, der die Krise beim Wort nahm, stets die sprichwörtliche Qual der Wahl, sich nach dem Sichten der Fakten für die eine oder die andere Seite zu entscheiden, denn (Vor-)Urteile wollten immer schon gefällt werden.
Die bedrohliche Zuspitzung eines Verlaufes oder einer Entwicklung ist jenes Merkmal, das als offensichtlichstes Symptom der Krise zum Ausdruck gelangt und, einem Signum gleich, erkennbar wird. Symptome manifestieren sich jedoch stets als Wirkung, niemals als Ursache. Daher deuten und verweisen diese lediglich auf zugrunde liegende Ursachen, so wie eine Metapher auf das mit ihr Gemeinte verweist. Das Symptom macht den Bezug ex post sprachlich und auch wirkungspsychologisch nachvollziehbar.
Die Welt als Masse …
Doch das Auf-die-Spitze-Treiben einer Entwicklung verfolgt von allem Anfang an auch ein anderes, ein der je eigenen Entwicklungsrichtung gegenläufiges Ziel: jenes, dass der gegenwärtige Zustand oder Verlauf einer gerade stattfindenden Entwicklung sich teilweise oder auch zur Gänze ändern möge. So zielt etwa die revolutionäre Beschleunigung einer politischen Entwicklung nicht auf die Festigung des Status quo, sondern auf dessen Beseitigung. Ausbrüche kollektiver Wut sind zudem selten Zeichen tiefgründiger Reflexionsprozesse; dagegen werden Massen (E. Canetti) primär von Emotionen gesteuert.
Covid-19 ist gerade dabei, die Welt zur Masse zu transformieren, die einem einzigen breiig-angstvollen Gedanken nachdenkt und sich einem diffusen Emotionscluster hingibt. Wie Gleichgeschaltete unterwerfen sich Millionen mit einer Handbewegung: "Maske auf" - und kaum jemand überprüft die Entscheider, die nach Belieben das Divisive in die Gesellschaft hineintragen oder das Desintegrative subkutan infiltrieren könnten. Und, was noch viel schwerer wiegt: So gut wie niemand überprüft die Methoden des Zustandekommens politischer Covid-19-Entscheidungen auf deren Stringenz und Konsistenz.
… zwischen Furcht und Angst
Der Begriff Krise ist im Laufe von über zwei Jahrtausenden zur Metapher geworden und erfüllt heute nur noch jene sprachliche Stellvertreterfunktion, für die er ursprünglich weder vorgesehen noch geeignet war. Denn wir sprechen von Krisen und meinen die Furcht, wir beschwören die Krisen und meinen die Angst. Krisen im Außen sind leichter zu rationalisieren, als das ihnen zugrunde liegende Phänomen der Angst.
Krisen versprechen bereits in ihrem Entstehen Auswege und - im Gegensatz zum Phänomen der Angst - lähmen sie nicht, sie verzögern und verlangsamen. Denn als Moment der beflügelnden Irritation wirken Krisen lediglich im künstlerischen und wissenschaftlichen Bereich in Gestalt schöpferisch treibender, fast bedrohlich intensivierender Kraft.
Die existenziellen Grundbefindlichkeiten von Furcht und Angst, in allen ihren Facetten und Ausprägungen, aber vor allem in ihrer Abgründigkeit, sind jenes, woraus sich das sprachliche Symptom, dem wir die Bezeichnung Krise verliehen haben, nährt. Auf solchen Befindlichkeiten baut die Bedrängnis und mit dieser die Metapher der Krise auf: Sie beunruhigt, erschüttert das Vertrauen, nimmt die Ruhe. Sie verunsichert und verstört, weil sie den Status quo fundamental infrage stellt und diesen auch nicht bloß temporär oder punktuell, sondern systematisch zu transformieren droht. Dadurch ist sie jedenfalls in der Lage, die gewohnte Ordnung nachhaltig, oft sogar irreversibel zu verändern oder zu zerstören.
Ohne die philosophische Fundierung der Strukturganzheit des Daseins ausführlich zu bemühen, sei festgehalten, dass der Begriff der Krise niemals die Tiefe einer die Angst ontologisch fundierenden Sorge erreicht oder gar berührt.
Hereinnehmen der Zukunft in die Gegenwart
Sprechen wir von konkreten pandemischen Krisen wie etwa Covid-19, so befinden wir uns zwischen den verbalen Mühlsteinen konkreter Furcht und diffuser Angst. Wir ängstigen uns vor dem, was als kommendes Unheil droht, was zeitlich herannaht, vor dem, "was uns überfällt und sich unser bemächtigt", wie E. Lévinas dies formulierte. Sobald wir die Metapher der Krise anwenden, zweifeln wir, anstatt zu vertrauen. Der Blick in und auf die Zukunft wird von der, trotz immenser Abnutzung immer noch höchst wirksamen, Metapher verstellt.
Denn obwohl gerade diese Metapher zu den sprachlich am stärksten abgenutzten und am meisten abgeschliffenen zählt, müsste der Blick auf alles Zukünftige von diesem Tiefpunkt aus erst wieder mühsam freigelegt werden. Sobald alle Symptome überwunden wären, hätte man auch die Krise beseitigt: Dieser Trugschluss endet, auf einem allzu voreiligen Urteil gründend, oftmals in einer neuen Krise; im Falle von Covid-19 in einer bis dato lehrbuchartig verdrängten Wirtschaftskrise, die erhebliche soziopolitische Verwerfungen nach sich ziehen kann. Doch der Wunsch nach rascher Krisenbeseitigung dominiert das symptomatische Denken, wodurch sich jede neu hinzukommende Katastrophe letztlich nur als Perpetuierung der alten Angst entpuppt.
Sobald wir jedoch, ohne den Begriff der Krise zu verwenden, von unserer Zukunft sprechen, hoffen wir, eine kommende Chance ergreifen zu können. Und auch die Bezeichnung Chance ist eine sprachliche Wendung, eine Metapher des Erwartens. Denn der Begriff des Erwartens bedeutet nicht das Warten auf ein bestimmtes Eintreten, sondern das Hereinnehmen der Zukunft in die Gegenwart, als Trost spendende Vorwegnahme günstiger Ereignisse.
Und obwohl wir wissen, dass in der Gegenwart niemals das Äquivalent der Zukunft gefunden werden kann, halten wir uns stets in dieser Möglichkeit, da sie bereits das Heute mit tröstender Wirkung erfüllt. Diese Vorwegnahme in Form von Hoffnung versetzt in die Lage, jenem, das wir Krise nennen, wirksam begegnen und trotzen zu können.
Paul Sailer-Wlasits ist Sprachphilosoph und Politikwissenschaftler in Wien. Sein neues Buch "Uneigentlichkeit. Philosophische Besichtigungen zwischen Metapher, Zeugenschaft und Wahrsprechen" erschien 2020 im Verlag Königshausen & Neumann.
4
