G20-Finanzminister wollen "globales Steuerdumping" beenden
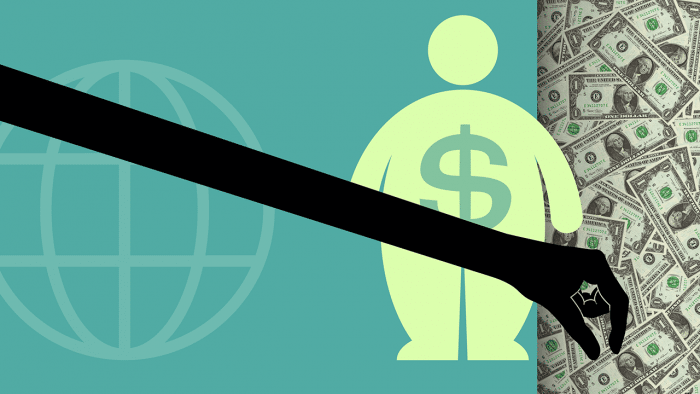
Mindeststeuer für Unternehmen: Bundesfinanzminister Scholz "zuversichtlich wie schon lange nicht mehr". IWF will Reiche stärker besteuern. Angst vor Zerfall der Gesellschaften spielt eine Rolle
Janet Yellen, ehemalige Chefin der US-Notenbank (FED) und neue Finanzministerin unter der Regierung von Joe Biden, hatte vor ein paar Tagen einen Mindestsatz zur Besteuerung von Unternehmen weltweit gefordert.
Offensichtlich ist sie damit bei den aktuellen Beratungen der Finanzminister der zwanzig führenden Wirtschaftsnationen (G20) auf offene Ohren gestoßen. Die Minister berieten sich am Rande der Online-Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) auch über die geforderte Mindeststeuer.
Yellen setzte sie mit 21 Prozent auf die Tagesordnung. Auf der Sitzung der G20-Finanzminister im Juli sollen dann Nägel mit Köpfen gemacht und eine grundsätzliche Einigung erzielt werden. "Gemeinsam können wir mit einer globalen Mindeststeuer sicherstellen, dass die Weltwirtschaft gedeiht auf der Basis fairer Wettbewerbsbedingungen in der Besteuerung multinationaler Konzerne", sagte Yellen am vergangenen Montag in einer Rede vor dem Rat für globale Angelegenheiten in Chicago.
"Es geht darum, sicherzustellen, dass Regierungen über stabile Steuersysteme verfügen, die genügend Einnahmen generieren, um in wichtige öffentliche Güter zu investieren und auf Krisen zu reagieren, und dass alle Bürger die Last der Staatsfinanzierung fair teilen."
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) drängt auf ein multilaterales Abkommen für eine Digitalsteuer. Doch wichtiger ist Yellen ganz offensichtlich die Mindeststeuer auf Unternehmensgewinne, die sie im Rahmen der G20 umsetzen will, denn damit hätte sie die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer im Boot.
Scholz hofft auf China
Die Beratungen der G20-Finanzminister über das Vorhaben liefen offensichtlich sehr gut. Deshalb zeigte sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) danach sehr optimistisch, dass diese Steuer auf Ebene der G20 tatsächlich eingeführt wird. "Ich bin so zuversichtlich wie lange nicht mehr, dass wir dieses wichtige Vorhaben diesen Sommer zu einem Ergebnis führen", erklärte Scholz begeistert. Die neue US-Regierung unter Präsident Joe Biden habe eine "deutliche Ansage" gemacht, dass sie einen Steuerdumping-Wettbewerb nicht weiter hinnehmen wolle.
Für Scholz war das ein klares "Zeichen", dass man sich im Sommer einigen werde und auch China dabei mitmachen werde. Er argumentierte ähnlich wie Yellen. Er hält ein gut austariertes Steuersystem für unerlässlich, damit die Staaten ihre Aufgaben finanzieren könnten. Das sei angesichts der Krise und ihren finanziellen Aufwendungen besonders dringlich. Alle Unternehmen müssten ihren Beitrag zu diesen Kosten leisten, sagte Scholz.
Nicht nur er ist begeistert, Sven Giegold hofft ebenfalls darauf, dass dem ruinösen weltweiten Steuerwettbewerb endlich ein Ende gesetzt wird. Auch der finanzpolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament sieht nun "eine historische Chance", um "Schluss mit dem Steuerdumping!" zu machen!"
Giegold hatte Scholz vor den Beratungen eine "ausweichende Reaktion" vorgeworfen und ihn aufgefordert, den Vorschlag der US-Finanzministerin aufzugreifen. Yellen habe die Hand ausgestreckt, jetzt müsse sie Europa nur ergreifen.
Neue Töne aus Washington...
Offensichtlich ist, dass nach der Abwahl von Donald Trump, der während seiner ganzen Amtszeit bei solchen Vorhaben auf der Bremse stand und alle Vorstöße verhinderte, nun neue Töne aus Washington kommen. Biden hatte schon 2019 erklärt, dass kein Unternehmen, das Milliardengewinne schreibt, weniger Steuern zahlen sollte als Feuerwehrleute und Lehrer. Besonders nimmt er sich bei seiner Kritik den Online-Händler Amazon vor, den er gerade erneut ins Visier genommen hat.
Denn Amazon hatte zum Beispiel in den Jahren 2017 und 2018 gar keine Bundessteuern gezahlt und erst 2019 damit begonnen. Das Unternehmen nutze "verschiedene Schlupflöcher", um Steuern zu umgehen. "Ich werde dem ein Ende setzen", kündigte Biden an, der das augenscheinlich einigermaßen ernst meint.
Dem seit 30 Jahren andauernden Steuerwettbewerb um die niedrigsten Unternehmenssteuersätze, in den auch die Trump-Regierung tiefer eingestiegen war, soll nun der Garaus gemacht werden. Trump hatte die Steuern auf Unternehmensgewinne von 35 auf 21 Prozent gesenkt. Die Biden-Regierung will den Steuersatz nun wieder auf 28 Prozent anheben, also deutlich über den vorgeschlagenen weltweiten Mindeststeuersatz.
Geld für ein Billionen-Dollar-Investitionsprogramm
Klar ist, dass Biden Geld für seine Pläne in die Kassen bekommen will. Schließlich sollen mehr als zwei Billionen US-Dollar fließen, um die Wirtschaft in der Coronavirus-Krise wieder anzukurbeln.
Allein 620 Millionen US-Dollar sollen fließen, um Straßen und Brücken zu reparieren. Für gut 300 Milliarden US-Dollar sollen alte Wasserleitungen ausgetauscht werden, das Breitbandinternet soll ausgebaut und das Stromnetzes an die Anforderungen von extremeren Wetterereignissen angepasst werden. Mit 300 Milliarden US-Dollar sollen alte und neue Sozialbauten renoviert und besser isoliert und das Energiesystem langfristig umgebaut werden, um Antworten auf die Klimakrise zu finden.
Unter anderem sollen Dieselbusse im Nahverkehr durch E-Busse ersetzt werden und eine halbe Million Ladestationen für Elektroautos bis 2030 gebaut werden. Als Ziel wird formuliert, "bis spätestens 2050 eine zu 100 Prozent saubere Energiewirtschaft und eine Netto-Null-Emission" zu erreichen. Wie das erreicht werden soll, bleibt derweil aber völlig unklar. Es zeichnet sich im Infrastrukturprogramm bestenfalls nur in schwachen Ansätzen ab.
Der große Unterschied zu Trump ist eben, dass Biden seine Maßnahmen nicht über eine immer weiter ausufernde Verschuldung finanzieren will. Deshalb sollen nicht nur die Unternehmensgewinne, sondern generell Reiche auch in den USA wieder stärker besteuert werden. Deren Steuern waren unter Trump ebenfalls massiv gesenkt worden.
Der Anteil der Reichen
In diese Richtung hatte Yellen schon als designierte Finanzministerin einen Vorstoß gewagt. Sie hatte sich bereits bei ihrer Anhörung im Finanzausschuss des Senats für eine höhere Besteuerung der Wohlhabenderen ausgesprochen, um die Kosten für die Coronavirus-Pandemie stemmen zu können. Sie plädierte schon damals dafür, dass die Reichen ihren "fairen Anteil" an den entstehenden Kosten übernehmen sollen.
Um die Wirtschaft anzukurbeln, müsse geklotzt, statt gekleckert werden. "Ohne weitere Maßnahmen riskieren wir eine längere und schmerzlichere Rezession und dann eine länger dauernde Heilung der Wirtschaft", hatte Yellen erklärt.
Interessant ist, dass sie nun ausgerechnet vom Internationalen Währungsfonds (IWF) unterstützt wird. Der glänzte bisher eher mit gegenteiligen Vorstellungen und Plänen und setzte sich für eine neoliberale Deregulierung und Steuererleichterungen ein. Deshalb hatten Länder wie zum Portugal viel darangesetzt, sich möglichst schnell aus der IWF-Umklammerung zu befreien, um politischen Spielraum zu gewinnen.
Die Linksregierung erhöhte Löhne und Renten, weitete Sozialleistungen wieder aus und baute die Arbeitslosigkeit massiv ab. So wurde viel Geld in die Kassen gespült, womit aus einem Defizit sogar ein Haushaltsüberschuss wurde.
IWF für eine höhere Besteuerung für Reiche
Es war einigermaßen erstaunlich, dass sich kürzlich aus dem IWF David Amaglobeli, Vitor Gaspar und Paolo Mauro schon für eine höhere Besteuerung für Reiche eingesetzte hatten. Ihr Beitrag trägt den Titel: "Jedem eine faire Chance geben."
Sie argumentierten, dass die Covid-Pandemie den "Teufelskreis der Ungleichheit" verschärft und die schwächsten Gruppen am härtesten getroffen habe. Das waren wahrlich neue Töne aus der Finanzinstitution, die sich plötzlich auch um das Wohl von Frauen sorgt. Denn Frauen seien von der Pandemie "besonders betroffen", da sie in den von COVID-19 betroffenen Sektoren wie dem Gastgewerbe und dem Einzelhandel tendenziell überrepräsentiert sind. Das gelte vor allem in ärmeren Ländern.
Um den Teufelskreis zu durchbrechen und jedem eine faire Chance auf Wohlstand zu geben, stellten sie fest, dass "Regierungen den Zugang zu grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen - wie Gesundheitsversorgung (einschließlich Impfungen) und Bildung - verbessern und die Umverteilungspolitik stärken" sollten. Hohe Sozialausgaben seien aber nur dann wirksam bei der Armutsbekämpfung, "wenn sie eine angemessene Unterstützung bieten und die ärmsten Schichten der Gesellschaft abdecken", wird erklärt.
Da für die Verbesserung beim Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen natürlich auch zusätzliche Ressourcen benötigt werden, müssen die Einnahmen der Staaten erhöht werden. Dazu hatten die drei IWF-Experten verschiedene Vorschläge gemacht.
Die Ausgaben könnten je nach den Gegebenheiten eines Landes durch die Stärkung der allgemeinen Steuerkapazität aufgebracht werden. Viele Länder könnten Vermögens- und Erbschaftssteuern erhöhen oder einführen oder auch die Steuerprogression anheben, um hohe Einkommen stärker zu besteuern. Einige Regierungen hätten auch Spielraum, um die Spitzensteuersätze anzuheben, während andere die Beseitigung von Schlupflöchern bei der Besteuerung von Kapitaleinkommen konzentrieren könnten. Darüber hinaus könnten auch temporär eine Abgabe für Haushalte mit hohen Einkommen eingeführt und die Unternehmensbesteuerung reformiert werden.
Das alles sind neue Töne aus einem IWF, der mit seinen Austeritätsprogrammen zum Beispiel in Griechenland zur massiven Verarmung breiter Schichten genauso beigetragen hatte wie zur Ausblutung des Gesundheit- oder Bildungssystems. Aber nun wird argumentiert, dass über die vorgeschlagene Politik eher "gesellschaftlicher Zusammenhalt" geschaffen werden könne.
Unterschwellig wird damit andererseits davor gewarnt, dass es zum Zerfall von Gesellschaften und damit zu massiven Unruhen kommen dürfte, wenn der Teufelskreis nicht durchbrochen wird.
Allerdings war bis Mittwoch noch nicht klar, ob es sich dabei nur um eine Minderheitsmeinung im IWF handelt oder ob sich tatsächlich langsam gesunder Menschenverstand auch im IWF breitmacht angesichts der Tatsache, dass Portugal nach der Finanzkrise etliche der nun offenbar angestrebten Ziele genau darüber erreicht hat, dass man in Lissabon die IWF-Programme nicht umgesetzt und die Austeritätspolitik beendet hatte.
So unterstützt nun auch die IWF-Chefin Kristalina Georgieva die drei Experten und spricht sich für eine "faire Chance" bei "Impfungen", dem "Wiederaufbau" und der "Zukunft" aus. Sie übernimmt in ihren einleitenden Worten zur Frühjahrskonferenz weitgehend die Positionen der drei Experten und spricht vom Schutz "gefährdeter Haushalte und lebensfähiger Unternehmen". Die müssten unterstützt werden, solange die Krise andauert.
Dazu müsste es "gezielte fiskalische Maßnahmen" und die "Beibehaltung günstiger Finanzierungsbedingungen" geben. Die Staaten sollten ihre Investitionen aufstocken, um "grüne Projekte und digitale Infrastruktur" zu stärken. Aber auch "die Gesundheit und Bildung der Menschen" müsse sichergestellt werden, erklärt die IWF-Chefin.
Da die Länder dazu ausreichende öffentliche Einnahmen benötigten, werde in vielen Fällen eine "progressivere Besteuerung" und eine "Mindestbesteuerung von Unternehmen" benötigt. Im aktuellen Fiscal Monitor des IWF werden die Positionen noch klarer ausgeführt.
Darin wird ausdrücklich von der höheren Besteuerung von "höheren Einkommen und Vermögen" und von einer Art temporären "Covid-Steuer" gesprochen. Von der Einführung einer Vermögenssteuer ist der IWF allerdings nicht überzeugt:
"Bevor sie sich neuen Instrumenten zuwenden, sollten die Länder die Schließung von Schlupflöchern, eine progressivere Einkommensbesteuerung und einen stärkeren Rückgriff auf Eigentums- und Erbschaftssteuern in Erwägung ziehen, die nach wie vor zu wenig genutzt werden."
In Bezug auf eine Covid-Steuer erinnert der IWF-Bericht daran, dass unter anderem in Deutschland zur Wiedervereinigung eine Steuer eingeführt wurde. Allerdings wurden über den Solidaritätszuschlag praktisch alle Einkommen besteuert, nicht nur die hohen, weshalb das eigentlich kein gutes Beispiel ist. Und sonderlich temporär war der auch nicht, denn es gibt ihn noch immer.