Große Vision, harte Landung?
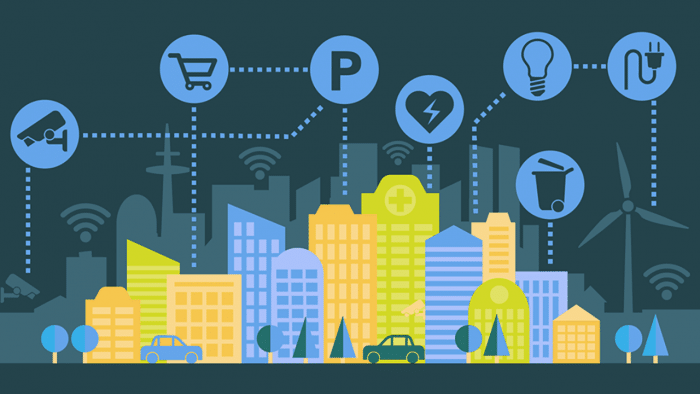
Die digitale Transformation der Städte: Ein Narrativ und viel gesellschaftliche Ambivalenz
Vor einigen Jahren zeichnete der Jenaer Karikaturist Bernd Zeller das Bild dreier Steinzeitmenschen. Einer hält eine Fackel in der Hand, die beiden anderen betrachten ihn mit entsetztem Gesicht und sagen: "Feuer ist ein unkalkulierbares Risiko. Auf solchen Fortschritt können wir verzichten." Tatsächlich mag man sich fragen, ob sich wohl vor einigen hunderttausend Jahren die Kulturtechniken, Essen zu kochen und Wohnungen zu heizen, durchgesetzt hätten, wenn solche Stimmungen und Zukunftserwartungen vorherrschen.
Immerhin, mit Smart Cities scheint man vielerorts euphorische Hoffnungen zu verbinden. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff? Als Smart City kann man eine Stadt bezeichnen, in der digitale Technologien bezüglich Infrastruktur, Gebäude, Mobilität usw. intelligent und systemübergreifend verknüpft werden, um Ressourcen wie Energie, Wasser etc. hocheffizient zu nutzen und ihren Verbrauch zu reduzieren. Hier werden vernetzte Services antizipiert, entwickelt und realisiert, wird Platz für Innovationen und zur Erprobung neuer Ideen, Verhaltensweisen und Lösungswege geschaffen.
Im Sinne von "Good Governance" werden in einer Smart City zudem interaktive Kommunikations- und Management-Systeme eingesetzt, um die urbane Dynamik effektiv steuern zu können. Eine optimale Vernetzung, auch innerhalb der Kommunalverwaltung, erleichtert nicht nur den Alltag in allen Lebensbereichen, sondern kann ökologische und ökonomische Vorteile mit sich bringen - und bei zielführendem Einsatz auch neue Lösungen im Bereich der Bürgerbeteiligung hervorbringen.
Soweit die Theorie. Die Wirklichkeit ist prosaischer. Bislang stellt der Begriff "Smart City" vor allem den Versuch der Wirtschaft dar, sich die Städte als neuen globalen Megamarkt zu erschließen, indem man suggeriert, die alte Stadt sei out. Genauer: Bei allen Problemen, die in den urbanen Zentren bestehen bzw. sich um sie ranken, sei die Stadt allein durch ein immenses Maß an neuer Technologie für die Zukunft fit zu machen.
Und an ausgewählten Orten entfaltet das bereits Wirkung: Getüftelt und gebaut wird mittlerweile weltweit an einzelnen Puzzleteilen der Stadt der Zukunft, so auch an den Hudson Yards in New York. Das gesamte Investment wird unter dem Werbeslogan "A new neighborhood for the next generation" gebündelt, und gemeint ist damit nicht nur die Rundumversorgung mit Food, Fun und Fitness, sondern auch die Errungenschaften der neuesten Technik, die die Bewegungen der Besucher und die Bedürfnisse der Bewohner genauestens registriert.
Mithilfe von Smart Data, sprich: Tausenden von Sensoren, die von den Einkaufsgewohnheiten bis zur Nutzung von Energie das Verhalten messen, entstanden hier seit 2016 Mosaiksteine für Städte der Zukunft. Das bedeutet nicht allein, dass der Hochhauskomplex mit einem ökologisch innovativen Energieversorgungssystem ausgestattet wird, das es via Datenanalyse möglich macht, Temperatur, Beleuchtung und Belüftung zu optimieren, sondern auch, dass die Umgebung jede Regung ihrer Benutzer registriert oder ausspioniert, je nach Betrachtungswinkel und Gemütslage.
Was mit der Datensammlung, die unter dem Stichwort "responsive neighborhood" firmiert, sonst noch geschehen kann, wird nicht gesagt. Es reicht, dass man auf die andern herabblicken kann. 374 Meter hoch ist der Wohnturm, den die Architekten Kohn, Pedersen und Fox, die auch den Masterplan für das Gelände entworfen haben, auf den Hudson Yards hochziehen.
Vollzieht sich die digitale Transformation automatisch und in die richtige Richtung weiter? Dies anzunehmen wäre naiv. Die Publizistin Mercedes Bunz merkt an: "Wir mögen zwar das Gefühl haben, die Digitalisierung sei etwas, das uns bloß zustößt; allerdings heißt das noch lange nicht, dass wir keinen Einfluss darauf haben, wie sie sich vollzieht. Wie sie sich konkret ereignet, ist nicht entschieden - und das bedeutet, wir müssen beginnen, sie aktiver gesellschaftlich zu gestalten."
In seinem durchaus optimistischen Buch "Wir sind die Stadt!" geht Hanno Rauterberg einen anderen Weg. Er sagt - und zeigt es in vielen Beispielen -, dass die Digitalmoderne eben vieles in der Stadt ändert, sie aber bisher keineswegs dazu geführt hat, dass das Stadtleben erlahmt, oder sich von den Straßen und Plätzen zurückzieht. Sein Credo lautet, die dystopischen Schwarzseher ein Stück entwaffnend:
Ohne Bewegung und Wandel wäre eine Großstadt keine. Sie lebt vom Zweifel, vom Experiment, von der Freude am Aufbruch.
Wenn die Bürgerschaft einer Stadt über ihre Kommunikation und ihren gesamten digitalen Lifestyle zu Smart Citizens würde, wenn sich Akteursnetzwerke veränderten und die Machtstrukturen heutiger Städte stärker durch global agierende Player der Datenökonomie geprägt würden, könnten sich Themen, Prozesse und Qualitäten der Stadtentwicklung massiv wandeln - ob nun zum Guten oder zum Schlechten, scheint bislang eher eine Glaubens- als eine Wissensfrage.
Laut Schätzungen der OECD liegt der weltweite Investitionsbedarf für Infrastrukturprojekte bei jährlich rund 1.800 Milliarden US-Dollar, und dies bis mindestens 2030. Offensichtlich ist, dass ein großer Teil dieser Investitionen in den Städten getätigt werden wird. Wenn man den Hype um Smart Cities verstehen will, muss man wissen, dass global agierende Technologieunternehmen sich einen erbitterten Wettstreit um Anteile an diesem urbanen Megamarkt liefern.
Während die technische Grundausstattung unserer Städte bislang im Prinzip auf Steinen, Beton und einer beachtlichen Anzahl von Kupferkabel-Kilometern basierte, soll aus Sicht der "Techies" die Transformation in den Städten ein komplexes Geflecht aus klassischen Ver- und Entsorgungs- sowie neuen IuK-Infrastrukturen, aber auch aus sozialen Netzwerken hervorbringen - und damit die Wege in die Smart City bahnen. Allein damit entsteht ein großer ökonomischer Druck auf die Städte, der sich höchst unterschiedlich auswirken kann.
Die einschlägige Industrie macht vollmundig Versprechungen und weist, so beredt wie bildreich, auf verlockende Möglichkeiten hin: Städte - handlich, flexibel und hip wie das neueste Smartphone. Stadtverkehr - einfach aber dennoch vernetzt, sauber und leise, wie in der Werbung. Städtische Diskurse und Demokratie - direkt, unzensiert und doch voll von schwärmender Intelligenz, wie in den sozialen Netzwerken. Technik, die begeistern kann und Konflikte löst, die uns heute unüberwindbar scheinen.
Das wird dann suggestiv ins (Schau-) Bild gesetzt: die glückliche Familie nimmt ihre Zukunftsstadt von einem opulenten Balkon im fünften Stock aus wahr; überall begrünte Fassaden und bummelnde Flaneure, fliegende Autos, eitel Sonnenschein. So mögen es zumindest die glühenden Verfechter der Digitalisierung sehen. Allerdings, unter dem Eindruck von Überwachung, Troll-Fabriken und Fake News könnte man auch reflexartig in eine Abwehrposition verfallen. Zumal die angeblich kostenlosen Onlineservices der Internetwelt das Kernelement der Smart Cities bilden, mit dem wir uns alle quasi selbst enteignen (indem wir unsere Daten ohne Gegenleistungen der Internetökonomie zur Verfügung stellen) und uns so Unternehmen und Geschäftsmodellen ausliefern, die mit ihren Servern in einer aufziehenden "The-Winner-Takes-It-All-Ökonomie" die Macht übernehmen.
Doch nun scheint die Corona-Pandemie die Debatte über die digitale Durchdringung von Städten zu verändern. Stadtstaaten wie Singapur nutzen das planerische Konzept der Smart City, um den Raum der Stadt umfassend mit aus Daten gewonnenen Informationen zu verknüpfen.
So lassen sich etwa Transport- und Energieflüsse im Rahmen von 3-D-Modellen in ihren stadträumlichen Auswirkungen überprüfen. Das Tracking der Bewegungsprofile infizierter Stadtbewohner erscheint dabei bloß als eine weitere Anwendung des Smart-City-Kalküls. Dieses erlaubt Singapurs Regierung, die Ausbreitung des Coronavirus nicht nur nachträglich zu rekonstruieren, sondern auch antizipierende Eingriffe vorzunehmen. Muss man daraus folgern, dass Gesellschaften, die die neuen digitalen Instrumente besonders affirmativ einsetzen, auch besonders erfolgreich sind?
Technik und Wissenschaft entfalten - ebenso wie Märkte - gewaltige Kräfte, und grundsätzlich wohnt einer solchen Dynamik keinerlei moralische Instanz inne, die mögliche Negativentwicklungen aus sich heraus stoppen würde und könnte. Was einmal gedacht ist, wird nicht mehr zurückgenommen, und eine Entwicklung wie die der Digitalisierung zieht im Prinzip unaufhaltsam ihre Bahn.
Gleichwohl kann, ja muss man Leitplanken ziehen: Solch wirkmächtige Technologien brauchen gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Denn globale Technologieunternehmen wie Google, Microsoft, Airbnb oder Uber geben sich augenscheinlich nicht mehr mit der Kommerzialisierung aller sozialen Handlungen zufrieden. Vielmehr investieren sie ihre Börsengewinne in Immobilien und Land. Ihrer jeweiligen Unternehmenslogik folgend, haben sie auch begonnen, selbst Städte der Zukunft zu planen. Dass dabei das Gemeinnützige im Brennpunkt steht, mag man mit Fug bezweifeln.
Trotzdem helfen die Kassandrarufe nicht weiter. Sofern die Kontrolle über unsere Daten (und das, was damit angestellt wird) im Sinne individueller Rechte und gemeinwohlorientiert gesichert ist - worum man sich aktuell ja in Barcelona sehr bemüht -, kann sich eine Dystopie flugs in eine Utopie verwandeln. Denn natürlich tragen digitale Steuerungen zu einem wesentlich effizienteren Betrieb städtischer Infrastrukturen bei.
Werden die hier entstehenden Daten z.B. mit anonymisierten Mobilfunkdaten und weiteren kommunalen Strukturdaten kombiniert, kann die Infrastrukturplanung beschleunigt und verfeinert werden. Mithilfe eines Crowd-Mapping ist es relativ einfach möglich, breite Informationen über gefährliche Kreuzungspunkte zu erhalten, indem man den Radlern selbst die Chance gibt, Gefahrenstellen per Smartphone zu posten.
Regelmäßige Auswertungen dieser Karten zeigen den zuständigen Behörden zuverlässig relevante Gefährdungen an. Akzeptiert man eine solche Weisheit der Vielen, setzt man entsprechende Finanzmittel ein, dann ließen sich nicht nur die städtischen Angebote deutlich verbessern, sondern es könnte auch eine neuartige Priorisierung von Investitionsprojekten erfolgen. Hier würden Qualifizierung und Demokratisierung gleichermaßen Platz greifen.
Ähnliche Möglichkeiten bestehen bei der Messung bestimmter Schadstoffbelastungen. Auch hier ist es technisch bereits möglich, dass Bürger über das Nutzen von Sensoren die offiziellen Zahlen der Stadt zu bestimmten Umweltbelastungen hinterfragen bzw. ergänzen können. In dieser Form kann neue Technik auch zu einer Art Empowerment der Bürger führen, da man nicht allein subjektive Einschätzungen, sondern durchaus belastbare Messergebnisse in Debatten mit der Stadtverwaltung einfließen lassen kann. Allein die Präsenz oder auch nur die Möglichkeit solcher Netzwerke aus Bürger-Sensoren, dürfte Verwaltungshandeln per se disziplinieren, weil Bürgerinnen und Bürger beredt Zeugnis ablegen können über ökologische und gesundheitliche Missstände.
Aus solchen und ähnlichen Ideen wurde das Konzept der "Cognitive Cities" geboren, das neben einer höheren, selbstlernenden und "erkennenden" Stufe der Informationsverarbeitung zur intelligenten "urban governance" auch den verstärkten Einsatz der Bürger als "Sensoren" der vernetzten Systeme vorschlägt. Und im Bereich der Big-Data Anwendungen versprechen Ansätze der predictive analytics die schnellstmögliche Warnung vor bisher Unvorhersehbarem wie Gewalttaten und Naturkatastrophen. Mit anderen Worten: Die Phantasie der technischen Machbarkeit kann tatsächlich einmünden in die Vorstellung eines besseren Lebens und seiner vernunftgesteuerten Regelung.
Manche Wahrnehmung freilich führt in die Irre. Es ist ja keineswegs so, dass eine smarte zwangsläufig eine komplett neu errichtete Stadt sein muss. Digitale Technologien zeichnen sich ja nicht zuletzt durch ihre Mikro-Größen aus, die wir in beinahe jedes Haus aus vorigen Jahrhunderten implementieren können. Offenkundig finden etwa Venedigs Paläste, Plätze und Brücken sich viel einfacher - und ohne nennenswerten Gesichtsverlust - in der digitalen Transformation zurecht und werden smart, als dass sie in der Lage gewesen wären, sich an die grobschlächtigen Anforderungen der industriellen Revolution anzupassen.
Der umtriebige Architekt und MIT-Forscher Carlo Ratti sieht eine beinahe ewige Konstanz der urbanen Formgebung - viele Elemente der heutigen Stadt fanden sich schon bei den Griechen und Römern. Grundsätzlich gilt: Menschen brauchen auch in der Zukunft Strukturen, Böden und Wände. Deshalb ist Ratti der Überzeugung, dass es im Digitaldiskurs nicht um den grundlegenden Um- oder Neubau von Städten geht.
Vielmehr erhält das Urbane ein neues Betriebssystem, weil sich das Sein und das Miteinander der Urbanisten in den gegebenen Strukturen und Räumen vollständig wandeln werden. Weswegen es vielversprechender sein mag, den Smart City-Potentialen im gesellschaftlichen Leben - in und zwischen den Häusern - nachzuspüren, und weniger in spekulativen Visionen für gänzlich neue Städte.
Geschichte ist, auf das Urbane bezogen, eben keineswegs obsolet. Blicken wir kurz zurück: Im ursprünglichen Haus, im oikos, wie die Griechen es nannten, sind Produktion und Reproduktion zusammengefasst. Während oikos - aus dem sich etymologisch die Ökonomie ableitet - sowohl das Haus als auch den Hausherren, seine Familie, die Sklaven, ihre Tätigkeiten und alles Gut des Haushalts meinte, wurde der zweite griechische Begriff für Haus, domos, auch als Verb gebraucht - woraus sich dann die Domestizierung ableitete.
Das Haus hat also von Beginn an einen doppelten Charakter: Als Urzelle der Ökonomie und als Verortung von Identität, als Haushalt und als Zuhause. Genau das gilt auch für die Stadt: Sie lebt vom Handel, und zugleich ist sie Lebensmittelpunkt vieler. Das ist ein konstitutives Element des Urbanistischen, die Digitalisierung hebt das nicht auf.
Deshalb bedarf die zukunftsfähige Gestaltung der Stadt einer Herangehensweise, die nicht (nur) ökonomischen oder ingenieurmäßigen Prämissen folgt. Natürlich wird die datengetriebene Optimierung vieles ausschalten, was urbane Leben heute noch prägt. Wenn es schiefgeht, wird die Stadt der Zukunft eine optimierte Maschine zur Erledigung von Aufgaben.
Zwar mag offenbleiben, ob die Stadt auch einem wirtschaftlich-materiellen Niedergang entgegengeht, doch wird es in ihr vermutlich mehr um Entfremdung als um Nachbarschaft und Verbundenheit gehen. Und dennoch: Jede Epoche hat ihre Brüche zu durchleben, muss mit ihnen zurechtzukommen. Der Digitalisierungs-Tsunami wird das Gesicht der Stadt und das Gefühl von Urbanität grundlegend verändern. Aber - das haben die Elektrifizierung, das Automobil oder die Sozialversicherungssysteme ja ebenfalls gemacht.