Ist das noch Krisenmodus oder schon Transformation?
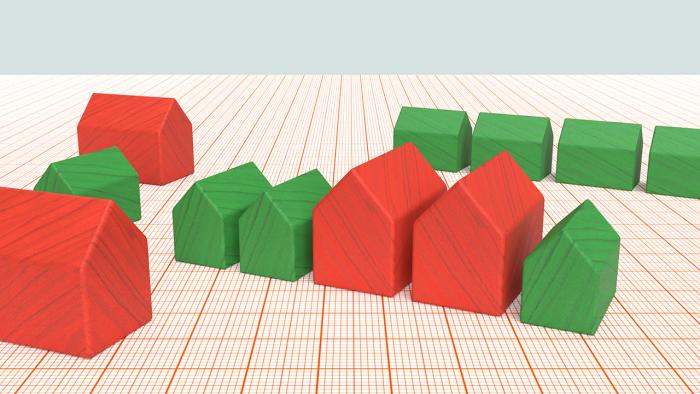
(Nicht nur) die deutschen Städte stehen vor grundlegenden Herausforderungen.
Inflation, Zuwanderung, Corona-Pandemie, Klimakrise und nun auch noch Energieknappheit – angesichts der Vielzahl an sich gegenseitig bedingenden und überlagernden Ereignisse stellt sich die Frage nach dem generellen Umgang mit Krisen in den Städten: Kann die Praxis des Umgangs mit Krisen bereits als Einstieg in Transformationsprozesse gesehen werden?
Welche Anforderungen ergeben sich daraus an das kommunale Handeln, das oft auf langfristig angelegten Konzepten und Planungen basiert? Wie passen Agilität und Resilienz zusammen? Solche Zusammenhänge werden ja nicht nur, wie jüngst, im Rahmen eines "Difu-Dialogs zur Zukunft der Städte" diskutiert, sondern sie sind vielerorts angekommen. Und sei es unausgesprochen.
Doch leider ist die Sache nicht so einfach. Ob ein soziales System wie die Stadt sich selbst planen kann und mit welchen Problemen man dabei rechnen müsse, hat auch den berühmten Soziologen Niklas Luhmann beschäftigt. Diese Frage zu stellen bedeutete für ihn nicht, sie mit der trivialen Feststellung zu beantworten, dass alle Planung unzulänglich sei.
Nicht dass sie ihre Ziele verfehlte oder hinter ihnen zurückblieb, nicht ihre unbeabsichtigten Nebenfolgen standen zur Debatte, das eigentliche Problem war vielmehr, "daß Planung Betroffene erzeugt – sei es, daß sie Benachteiligte werden, sei es, daß nicht alle ihre Wünsche erfüllt werden. Die Betroffenen werden wissen wollen und sie werden freie Kapazitäten im System nutzen wollen, um zu erfahren und möglichst zu ändern, was geplant wird".
Weil sich Planung außerdem an der Komplexität des Systems orientieren müsse, diese aber niemals vollständig abbilden könne, sei es stets möglich, ihr Lücken und Defizite nachzuweisen. Immer seien irgendwelche Interessen übergangen, mögliche Folgen nicht beachtet, Risiken falsch eingeschätzt und vor allem: andere Prioritäten zurückgesetzt worden. Nicht jeder vermag das so kompliziert auszudrücken, aber jeder kennt das, was damit gemeint ist.
In ihrem Aufsatz "Dilemmas in a General Theory of Planning" haben Horst Rittel und Melvin Webber sehr schön dargelegt, dass man zeitgenössische Planung in erster Linie als Umgang mit wicked problems begreifen müsse, also mit vertrackten, ja bösartigen Problemen. Denn jenseits von Wünschen und Postulaten sind Aufgabe und Ziel stets unscharf.
Will man etwa einen benachteiligten Stadtteil aufwerten, stellt sich zunächst die Frage, um was es im Kern geht: Ist es die nicht sanierte Bausubstanz, ist es die soziale Benachteiligung der Bewohner oder die im Stadtteil fehlende Wirtschaftsstruktur?
Eine eindeutige Antwort fällt schwer, da sich die Probleme überlagern und gegenseitig bedingen. Insofern erstaunt es nicht, dass auch die Suche nach Zielen und Maßnahmen wicked ist: Es gibt keine richtigen und falschen Lösungen für Planungsprobleme, sondern nur gute bzw. schlechte Lösungen, die immer eine normative Wertung enthalten.
Was für den einen die Lösung eines Problems darstellt, generiert Probleme für andere. Die Aufwertung eines Stadtteils kann zur Verdrängung der angestammten Bevölkerung führen. Hinzu kommt ein weiterer Wesenszug von Planung: Sie wirkt langfristig und das trial and error-Prinzip ist nicht gültig: So existiert beispielsweise ein im Zuge der Revitalisierung einer Brachfläche neu errichtetes Gebäude für lange Zeit.
Hinterher lässt sich nicht mehr ausprobieren, ob an Stelle des neuen Einkaufszentrums vielleicht Wohnbebauung die attraktivere Lösung gewesen wäre oder man nicht besser einen neuen Park dort angelegt hätte. Mit anderen Worten: Stadtplanung beschäftigt sich mit Problemen, die in der Regel weder eindeutig definierbar noch vollständig lösbar sind.
Dies bedeutet auch, dass die entsprechenden Ziele und Maßnahmen nie hundertprozentig funktionieren können, sondern je nach Blickwinkel von bestimmten Akteuren gut, und von anderen hingegen als schlecht empfunden werden. Parkraumbewirtschaftung stellt für Autofahrer sicher ein Ärgernis dar, während Fußgänger und Radfahrer sich über freie Geh- und Radwege und weniger Autoverkehr freuen.
Stadtplanung muss sich offensichtlich von der Vorstellung trennen, perfekte Maßnahmen, die alle glücklich machen, zu entwickeln und umzusetzen. Eher geht es darum, zwischen unterschiedlichen Interessen zu vermitteln, dabei schwächere Interessen, die sich sonst nicht durchsetzen können, im Auge zu behalten und ggf. mit planerischen Maßnahmen zu unterstützen.
Daraus muss man folgern, dass Planung keine gleichsam betonierte Definition oder Handlungsanweisung mehr darstellen kann. Überhaupt wird man sich die Frage stellen müssen, ob Stadtentwicklung nicht etwas mit der Spieltheorie zu tun hat, der zufolge die Spieler sich entscheiden, ohne die einzelnen Gegebenheiten des Problems zu kennen, von denen einige bekannt sind, andere zufallsbedingt, wieder andere unbestimmbar. Zumal Urbanität, wie es der Soziologe Hartmut Häußermann einmal formulierte, "nicht das Ergebnis bewusster planerischer Entscheidung ist, sondern das Ergebnis einer Entwicklung, an der eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure, Interessen und Initiativen usw. beteiligt sind. In diesem vielschichtigen Prozess entsteht, wenn es gut geht, ein urbaner Ort. Planung behindert solche Prozesse eher, als dass sie diese befördert."
Doch dieses Verdikt ist weniger vernichtend als es klingt; durch den Kontext wird klar, dass keineswegs die Daseinsberechtigung von Planung in Zweifel gezogen wird. Will sie aber ihre Rolle als steuernde Instanz zurückerlangen, muss die Improvisation – die im Kleinen durchaus Sinn macht – durch ein stabiles Konstrukt gestützt und in eine ganzheitliche Strategie eingebettet werden. Dabei kommt insbesondere der Frage, wie dabei immanente, bisher vielleicht kaum beachtete soziale und situative Qualitäten freigesetzt und für eine nachhaltige Konzeption der Stadt fruchtbar gemacht werden können, eine entscheidende Bedeutung zu.
Das Ganze – die Stadt – weist Eigenschaften auf, die sich nicht allein erklären lassen aus den Funktionen seiner Bestandteile (also des Wohnens, des Verkehrs, des Einzelhandels usw.). Vielmehr hat das Ganze Eigenschaften, die den Teilen, aus denen es besteht, fremd sind. Man nennt das Emergenz. Wenn man die Algorithmen der Veränderung kennt, kann man berechnen, welche Muster entstehen werden.
Allerdings kennen wir diese nicht, zumindest nicht genau genug. Doch immerhin gibt es stabilisierende Elemente. Denn das "Spiel der Stadt" war immer ein sorgfältiges Ausbalancieren zwischen strukturellen Ordnungssystemen, um das Chaotische der Stadt zu kontrollieren und der notwendigen Adaption an veränderte Umweltbedingungen.
Entsprechendes gilt für das "Spiel der Natur" oder auch für unsere Sprache: Wir gehen außerordentlich sorgfältig mit der Syntax unserer Sprachen um, mit dem Ziel sicherzustellen, dass wir uns verstehen. Wir erlauben uns aber sehr viel Freiheit bei der Veränderung der einzelnen Wörter.
So ist ein "Hamburger" plötzlich nicht mehr, was er einmal war, und auch Herr Mitterrand konnte den Wortwechsel vom "Ascenseur" zum "Lift" weder aufhalten noch juristisch einklagen. In der grammatikalischen Position stehen der "Hamburger" und der "Lift" aber seit Jahrhunderten an der gleichen Stelle.
Gewiss, die Frage, wie die Stadt von Übermorgen strukturiert sein wird, was sie charakterisiert oder ausmacht, und wie sie aussieht, ist damit nicht beantwortet. Aber! Es wäre ohnehin vermessen – wenn nicht gar fatal –, darauf überhaupt eine klare, eindeutige Antwort zu erwarten.
Zum einen helfen ausformulierte, festgefügte Stadtvisionen nicht weiter. Denn deren Gebrauchswert, das lehrt die Geschichte, war immer dadurch beschränkt, dass mit ihr die Zeit ausgeschaltet wurde; der Wandel war stets zu wenig mitgedacht.
Urbane Utopien waren nie als Prozess gedacht, nie beseelt von nichtlinearer Dynamik. Und die technokratischen Visionen der Spezialisten, ihre Hilfsmittel, mit denen sie hofften, die Stadtkrise zu überwinden, zeigten bloß ihre Begrenztheit. Welchen Grund gibt es zu glauben, dass dies sich bei den heutigen Projektionen anders verhielte?
Zum anderen, und dem nicht widersprechend, ist und bleibt Stadtentwicklung eine komplizierte Angelegenheit mit vielen Wechselwirkungen und Rückkopplungseffekten. Es gibt diesbezüglich nicht nur eine Sichtweise und nicht nur eine richtige Entwicklung.
Nun deutet heute vieles darauf hin, dass die ganze bewohnte Erde Stadt werden wird. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt bereits in Städten, in weniger als zehn Jahren wird diese Zahl auf zwei Drittel angestiegen sein. Damit wird deutlich, dass sich die entscheidenden Herausforderungen der Weltgesellschaft tatsächlich am Urbanen festmachen werden.
Dazu gehören ökologische Themen ebenso wie Aspekte der Versorgung, logistische Herausforderungen genauso wie die soziale Frage. Insbesondere aber geht es um die Wechselbeziehung von gelebtem Alltag und gebauter Umwelt. Ganz in diesem Sinne äußerte sich auch der Schriftsteller Ingo Schulze:
Denn um zu beantworten, was für eine Stadt wir wollen, das heißt, welche Funktion, welche Räume, welche Architektur wir uns wünschen, müssen wir wissen, was wir wollen und wer wir sind. Umgekehrt lässt sich aus der Architektur, aus der Anlage einer Stadt etc. darauf schließen, welche Interessen sich durchgesetzt haben, welches Bild die Gesellschaft von sich entwirft, welche Geschichte erzählt werden soll.
Es muss also auch um eine geistig-gedankliche Vorstellung dessen gehen, was Stadt in Zeiten des technologischen und gesellschaftlichen Umbruchs sein könnte.
Dabei lassen sich durchaus einige unterschiedliche Stoßrichtungen des zeitgenössischen Urbanismus umreißen. Sie lauten: Verdichtung, Durchmischung, Mobilität, neue Landschaftsbildung. Verdichtung zielt nicht nur auf Büroturmquartiere, Verkehrsknotenpunkte und Wohnareale, sondern auch auf Grünräume mit ihren Zyklen ökologischer Selbstregeneration etwa auf ehemaligen Industriehalden im Sinne einer in die Stadt zurückgekehrten Natur.
Durchmischt werden, im Kampf gegen die aus Amerika kommende Ideologie der Gated Communities, die sozialen Schichten, Lebensalter, Kulturhintergründe, aber auch die täglichen Lebensfunktionen: kombinierte Quartiere des Wohnens, Arbeitens, Ausruhens, Lernens, Einkaufens, Genesens, oder auch einfach des Rentebeziehens.
Mobil gemacht werden soll das gesamte Stadtgebiet für dessen Bewohner: nicht durch ein Verkehrsnetz möglichst gleichmäßiger Schnellanbindungen, sondern durch abgestufte Erschließung, die dem Raum seine Topographie und seine entlegenen Stellen belässt. Zugleich erobert das postindustrielle Zeitalter vom New Yorker Fresh Kills Park bis zum deutschen Vorzeigeprojekt Emscher Park den Industrieschrottplatz als umweltverträglichen Lebensraum zurück.
Ob nun CO2-Problematik (Postfossile Stadt, Degrowth), Ressourcenfragen (Urban Mining, Recycling City), Partizipation (Reclaim the City) oder flächendeckende Datenerfassung und –auswertung (Smart City, E-Commerce): Viele grundlegende Entwicklungen und Herausforderungen, die die Städte prägen, können an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden.
Grundsätzlich aber gilt dabei: Technologische Innovation (allein) löst kein Problem. Statt die Natur durch eine technische Umwelt zu ersetzen, müssen wir sinnvolle Zusammenhänge für Bewohner und Nutzer entwickeln. Das wäre schon mal ein wesentlicher Beitrag zur notwendigen Transformation.