Spricht das Brexit-Chaos gegen direkte Demokratie?
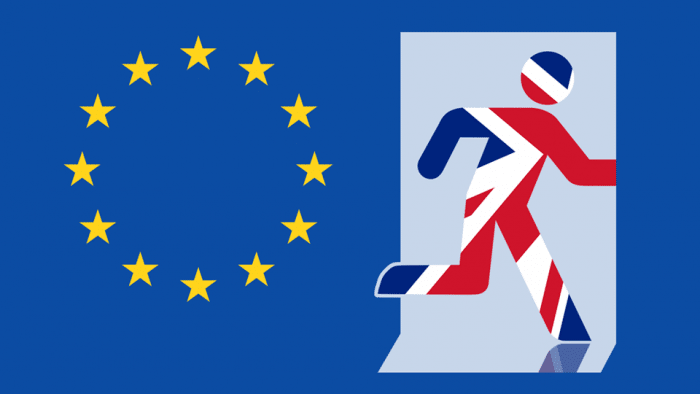
Das Referendum hatte wenig mit dem zu tun, wie direkte Demokratie optimalerweise zu gestalten ist
Die britische Gesellschaft ist tief gespalten, die Regierung von Theresa May angeschlagen, Ratlosigkeit greift um sich und das Land steuert auf einen harten, ungeregelten Brexit zu mit möglicherweise dramatischen Folgen. Und das alles ist das Ergebnis eines Referendums. In diesen Tagen scheint der Brexit daher so manchem als Beleg dafür zu dienen, dass man von direkter Demokratie lieber die Finger lassen sollte. Dass sie Populismus hervorbringt statt Problemlösungen, dass sie Gesellschaften spaltet, statt sie zu befrieden. Doch stimmt das? Spricht das Brexit-Chaos gegen direkte Demokratie?
Nein. Und zwar schon deshalb nicht, weil das Brexit-Referendum im Jahr 2016 wenig mit dem zu tun hatte, wie direkte Demokratie optimalerweise zu gestalten ist. Instrumente der direkten Demokratie wie Volksabstimmungen sind ja nicht allein dazu gedacht, dass das Volk zu einer vorgegebenen Frage Ja oder Nein sagt. Sondern die Abstimmung soll den Abschluss einer konstruktiven gesellschaftlichen Diskussion darstellen. Dazu ist es förderlich, dass die Abstimmung aus der Gesellschaft erwächst, dass sie von "unten" gefordert und erarbeitet wird. Das Brexit-Referendum hingegen war von oben angeordnet. Nicht nur das, es war verflochten mit den machtpolitischen Interessen des damaligen Premierministers David Cameron, der mit einer von ihm erwarteten Entscheidung pro EU die Kritiker in seiner Partei ruhigstellen und so seine Position sichern wollte. Eine Volksabstimmung, die wie Schweinefutter der grunzenden Meute hingeworfen wird, damit sie Ruhe gibt - das ist schon mal keine gute Voraussetzung für eine gelingende gesellschaftliche Willensbildung.
Die Kampagne vor dem Referendum war dann kein Musterbeispiel einer sachlichen Debatte, sondern von offensichtlichen Lügen geprägt. Nur ein Beispiel zur Erinnerung: Die Austritts-Befürworter beklagten, das Vereinigte Königreich zahle jede Woche 350 Millionen Pfund an die EU. Die Zahl war völlig aus der Luft gegriffen. Die Gefahr gezielter Falschinformation besteht bei politischen Diskussionen natürlich immer. Die Auswüchse während der Brexit-Kampagne wären jedoch vielleicht nicht so dramatisch gewesen, wenn jeder Haushalt eine offizielle neutrale Zusammenstellung der Pro- und Contra-Argumente erhalte hätte. Auch das ist ein Element einer gedeihlichen Kultur direkter Demokratie, wie es etwa in der Schweiz mit ihren "Abstimmungsbüchlein" oder in Kalifornien und Oregon üblich ist. Dabei hätte auch deutlicher werden können, dass man die EU nicht verlassen und gleichzeitig alle Vorteile des Binnenmarkts behalten kann, was offensichtlich vielen Austritts-Befürwortern nicht klar war.
Darüber hinaus war das Referendum mit fragwürdigen Abstimmungsregeln versehen. Denn der Austritt aus der EU ist eine dermaßen fundamentale Angelegenheit, dass sie eine qualifizierte Mehrheit verlangt hätte, wie es bei Verfassungsänderungen in anderen Ländern üblich ist. Stattdessen hat eine wackelige Mehrheit von 51,89 % den knappen Sieg davon getragen.
Wenn das Brexit-Referendum in Sachen direkter Demokratie etwas darstellt, dann ein abschreckendes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte.
Lieber mal eine missglückte Entscheidung als eine verunglückte Demokratie
Und was, wenn das Referendum allen Anforderungen genügt hätte und die Entscheidung dennoch so ausgegangen wäre, wie sie ausgegangen ist? Dann ist zu sagen: Auch demokratische Entscheidungen, die man missbilligt, sind legitime Entscheidungen. Die Entscheidung für den Brexit mag man für unklug, dumm und rückwärtsgewandt halten. Doch es muss einer Nation gestattet sein, sich demokratisch für den Austritt aus einem Staatenverbund zu entscheiden, auch wenn deren Mitglieder so stark miteinander verwoben sind wie in der EU.
Die Kritik am Brexit ist das eine, die Kritik am direktdemokratischen Entscheidungsverfahren etwas anderes. Wir sollten die beiden Dinge nicht vermischen. Grundsätzlich gilt: Lieber mal eine missglückte Entscheidung als eine verunglückte Demokratie. Volksabstimmungen sind keine Garantie für kluge Entscheidungen, ebenso wenig wie parlamentarische Beschlüsse. Das tiefe Misstrauen gegenüber den Bürgern allerdings, das sich hinter der grundsätzlichen Kritik an direkter Demokratie verbirgt, ist für die Demokratie langfristig viel gefährlicher als einzelne verfehlte Entscheidungen. Denn die herablassende Haltung, wichtige politische Themen seien für die normalen Bürger zu komplex, ruft jenes wutbürgerliche Misstrauen gegen "die da oben" hervor, das die Demokratie untergräbt, die man doch bewahren will.
Auch die viel beklagte Spaltung der britischen Gesellschaft sollten wir nicht dem direktdemokratischen Entscheidungsprozess in die Schuhe schieben. Sie hat ihre Ursache vielmehr vor allem darin, dass sich Befürworter und Gegner des Brexits auf fast genau jeweils eine Hälfte der Bevölkerung verteilen. Der soziale Unfrieden wäre nicht minder groß, wenn die Entscheidung für den Brexit durch das Parlament getroffen worden wäre. Im Gegenteil, man stelle sich vor, eine knappe Mehrheit des britischen Unterhauses hätte den Austritt aus der EU beschlossen. Zu der sozialen Spaltung käme bei Millionen Bürgern das Gefühl einer massiven Bevormundung hinzu.
Viele Befürworter der britischen EU-Mitgliedschaft verlangen ein zweites Referendum. Ob das noch realistisch ist, darf bezweifelt werden. Nicht zu bezweifeln jedoch ist, dass ein zweites Referendum legitim wäre. Bemerkenswerterweise wird genau das von manchen bestritten. Eine zweite Befragung sei undemokratisch, heißt es. Dahinter steht anscheinend die Auffassung, dass die Ergebnisse von Volksabstimmungen unantastbar sind. Das ist natürlich Unsinn. Der Witz der direkten Demokratie ist nicht, das Volk für unfehlbar zu halten, sondern es selbst entscheiden zu lassen. Und wer selbst entscheidet, kann sich auch selbst korrigieren. Undemokratisch wäre nicht eine erneute Abstimmung, sondern der Bevölkerung zu unterstellen, sie sei nicht lernfähig.
Warum ein zweites Referendum richtig wäre
Mehr noch, ein zweites Referendum wäre nicht nur demokratietheoretisch völlig in Ordnung, sondern geradezu folgerichtig. Denn die knappe Entscheidung für den Brexit im Jahr 2016 erfolgte ohne eine konkrete Vorstellung davon, wie dieser Brexit aussehen könnte. Jetzt aber liegen die verfügbaren Optionen klar auf dem Tisch, und ihre jeweiligen Konsequenzen für die Briten sind absehbar. Das Volk wollte mehrheitlich den Brexit, nun sollte es auch darüber entscheiden, wie es ihn will - und ob es ihn unter den gegebenen Umständen überhaupt noch will. Wer eine Scheidung von seinem Ehepartner wünscht, überlässt ja auch nicht alle Folgeentscheidungen seinem Anwalt, sondern muss sie selbst verantworten.
Käme es zu einem neuen Referendum, wäre also weniger entscheidend, dass man ein zweites Mal abstimmt, sondern auf welche Weise man abstimmt: auf welcher Grundlage, mit welchen Informationen, mit welchen Entscheidungsoptionen. Der von der May-Regierung ausgehandelte Brexit-Vertrag müsste ebenso zur Abstimmung gestellt werden wie der Austritt ohne Deal und die Rücknahme des Austritts-Gesuchs.
Vor allem aber sollte eine erneute Volksabstimmung nicht mit dem Plan angesetzt werden, ein bestimmtes Ergebnis herbeiführen zu können. Damit würde man den Fehler von David Cameron nur unter anderen Vorzeichen wiederholen. Sondern ein zweites Referendum müsste den Briten die Möglichkeit geben, mit ausreichend Zeit, ergebnisoffen und fundiert mit dem Wissen von heute die verfügbaren Optionen zu diskutieren, auch wenn das Thema die Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich bereits seit Jahren beherrscht. Und die Entscheidung sollte eine reine Sachentscheidung sein, also nicht mit der Frage nach dem Fortbestehen der derzeitigen Regierung verquickt werden. Denn das wäre wiederum ein Motor für Polarisierung und Populismus. Ziel müsste eine endgültige, bindende Entscheidung sein, die die Gesellschaft auch befrieden kann.
Wie auch immer ein zweites Referendum ausginge, könnte es so zumindest zeigen, wie direkte Demokratie nicht nur scheinbar Probleme schafft, sondern wie sie - wenn man es richtig macht - Probleme lösen kann.
Roland Kipke ist Philosoph an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und Autor des jüngst erschienenen Buches "Jeder zählt. Was Demokratie ist und was sie sein soll".
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
