Warum Marxisten die Digitalisierung nicht verstehen
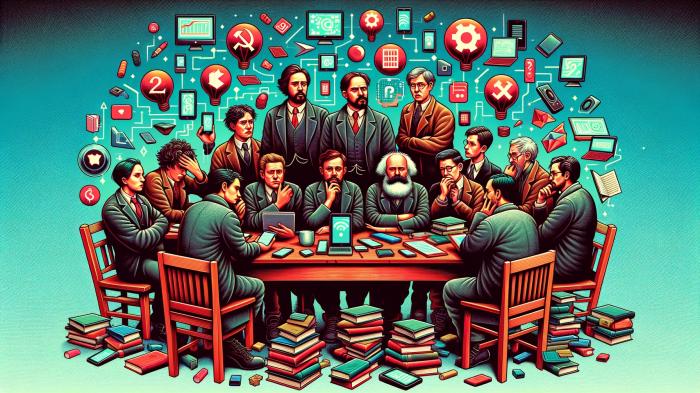
KI-generierte Illustration
- Warum Marxisten die Digitalisierung nicht verstehen
- Plattform-Demokratie-Spektakel
- Fazit
- Literatur
- Fußnoten
- Auf einer Seite lesen
Keine Chance gegen Plattformkapitalismus? Analyse ohne Biss: Wichtige technologische Debatten werden ignoriert. Eine kritische Auseinandersetzung.
Der Marxismus wurde oft tot gesagt, zeigt sich aber langlebiger als erwartet. Der renommierte Suhrkamp-Wissenschaftsverlag brachte kürzlich einen Sammelband überwiegend marxistischer Theoretiker:innen zum "Digitalen Kapitalismus" heraus.
Die Debatte, die Analyse braucht
Deren Beiträge sind fast alle politisch links, feministisch, ökologisch, marxistisch und sie dokumentieren vor allem eins: Eine offenbar langjährige hartnäckige Weigerung vieler Marxist:innen, sich mit politischen Debatten und theoretischen Diskursen rund um Informationsgesellschaft, Internet, Web2.0 und zuletzt "Digitalisierung" auseinanderzusetzen.
Der Sammelband Carstensen/Schaupp/Sevignani (Hg.): "Theorien des digitalen Kapitalismus" gibt laut Suhrkamp einen Einblick in theoretische Analysen, Zeitdiagnosen und Debatten des digitalen Kapitalismus und bespricht "entlang der Felder Arbeit, Ökonomie, Politik, Kultur und Subjekt" Formen und Auswirkungen der kapitalistischen Digitalisierung.
Etliche der 33 Autor:innen bekleiden Lehrstühle, haben in den letzten Jahren Bücher zum digitalen oder Plattform-Kapitalismus vorgelegt und wirken doch seltsam ratlos: Eine integrative Theorie des digitalen Kapitalismus scheine zwar "unmöglich", gleichwohl wolle man "Verbindungen der disparaten Ansätze" ausleuchten (so das Backcover).
Wofür Partei ergriffen wird
Leider erweisen sich die Ansätze nach langer, mühsamer Lektüre als nicht so disparat wie erwartet, eher als eintönig. Unnötig schwer gemacht wird dem Leser jedoch das Ausleuchten der überraschend schwachen Verbindungen innerhalb enger Zitierzirkel aus dem Milieu der Alt-68er-Next-Generation.
Partei ergriffen wird für die Seite der Arbeit, gegen das Kapital, das Patriarchat, den Neoliberalismus und seine humanitären und ökologischen Verfehlungen. Letzteres im Beitrag eines Thomas Barth (mit dem Rezensenten weder identisch noch verwandt noch bekannt).
So weit, so gut, auch wenn keiner der Texte Biss genug hat, etwa eine digitale Privatisierung der Macht durch die Klasse der Superreichen zu attackieren (Krysmanski, siehe Literaturverzeichnis am Ende des Artikels).
Gemeinsam ist vielen Texten aber ihre weitgehende Ignoranz gegenüber kritischen Technikdiskursen zur Digitalisierung, sogar gegenüber marxistischen Theoretikern wie Mark Poster, der bereits 1990 eine Erweiterung von Marx' Begriff der Produktionsverhältnisse zu den digitalen "Informationsverhältnissen" vorgelegt hatte.
Nicht Marx, aber Marxisten ignorieren Technologie
Vor über 20 Jahren zeigte sich der US-Neomarxist Mark Poster (1941-2012) erstaunt über das Ausmaß, in dem viele Marxisten dazu neigten, neue Technologien "fast vollständig zu ignorieren". Diese nahmen an, dass der Kapitalismus den entstehenden Cyberspace, das Internet vollständig übernehmen würde.
Poster fand das sehr überraschend, weil Marx doch stets darauf geachtet habe, die Art und Weise zu untersuchen, wie soziale Innovationen sowohl für bestehende Institutionen als auch in Richtung ihrer Infragestellung wirkten (Poster 2003).
Marx selber wäre sogar so weit gegangen, disruptiv-brutale Ereignisse wie die Zerstörung der indischen Baumwollindustrie durch britische Kolonialisten insofern zu begrüßen, als sie die historische Entwicklung zum Sozialismus fördern könnten.
Das Internet: Nur eine weitere Teufelei
Das Misstrauen marxistischer Kritiker gegenüber dem Internet erschien Mark Poster daher übertrieben, besonders angesichts der Chancen progressiver Netzkultur in der Open-Source und Hacker-Szene.
Sein Optimismus speiste sich aus dem, was damals als "Kalifornische Ideologie" wegen Ignoranz gegenüber der sozialen Frage kritisiert und heute auch als Transhumanismus bezeichnet wird.
Es war die Zeit einer ersten Verbreitung von Unternehmens-Websites, gefolgt von Börsen-Hype und Dotcom-Crash 2001, als im Kampf um die Netzkultur noch vieles offen war. Für Marxisten war es damals jedoch schon offensichtlich, so Mark Poster, dass das Internet nur eine weitere Teufelei war, um die Reichen noch reicher und die Armen noch ärmer zu machen.
Die Sieger und eine spezielle Ignoranz
Heute, nach der Durchsetzung des Plattform- oder Überwachungskapitalismus, müssen wir leider feststellen, dass die Pessimisten nicht völlig falsch lagen. Zwar hat sich die widerständige Netzkultur weiterhin gehalten, doch Dotcom-Konzerne stehen in der Öffentlichkeit und an den Börsen als Sieger da.
Marxistische Kritik an der Plattform-Industrie leidet heute unter deren Ignoranz zwar nicht mehr gegenüber der Technologie selbst, aber gegenüber den sie betreffenden Diskursen. Technik- und Netzkritik, wie sie auf Telepolis seit drei Jahrzehnten gepflegt wird, scheint in vielen Suhrkamp-Beiträgen unbekannt zu sein.
Eine progressive Perspektive wird markiert durch Berichte über Arbeitskämpfe gegen Digitalkonzerne, deren unethische Geschäftspolitik, feministische Beiträge zum Thema Care und Digitales sowie ökologische Kritik, bei Thomas Barth (dem Beiträger, nicht dem Rezensenten), auf dessen Text "Nachhaltigkeit im digitalen Kapitalismus" jedoch niemand weiter eingeht.
Oft wird auch versucht, Kulturkritik am digitalen Kapitalismus zu üben, politisch die Sache der (digital) Arbeitenden gegen die Seite des (Dotcom-) Kapitals zu vertreten oder marxistische Begriffe auf die Thematik der Digitalisierung anzuwenden.
Digitalisierung: Schwer von (Marx'schem) Begriff
Die Einleitung klärt zunächst die Begriffe Digitalisierung und Informatisierung, wobei letztere die Vergegenständlichung geistiger, regulierend-orientierender Tätigkeiten meint. In Zeichen oder Information erlange dabei nur ein Teil menschlicher Fähigkeiten, Erfahrungen und Wissens "eine eigenständige Gestalt".
Andere Kommunikationspartner:innen müssten die vergegenständlichten Informationen dann wieder in ihr Wissen und ihre Erfahrungen einbetten. Diese kooperative "Arbeit an den Zeichen" (Fn1) bediene sich auch unterschiedlicher Informationstechniken. Informatisierung meine in einem zweiten Sinn die "Materialisierung des Informationsgebrauchs" (Fn2) in Informationssystemen.
Es ginge hier um den organisierten und vergegenständlichten Umgang mit Informationen. Digitalisierung sei demgegenüber die Formalisierung, Reduktion und Integration von Information, die in virtuellen Modellen gipfle, welche Tätigkeiten, Arbeit und der Herstellung von Technik vorausgehe.1
Gleich die erste Fußnote der Einleitung verweist auf einen posthum erschienenen Band mit Schriften von Arne Raeithel (1943-96) "Selbstorganisation, Kooperation, Zeichenprozess" (1998), die zweite auf den Beitrag von Andreas Boes und Tobias Kämpf, "Informatisierung und Informationsraum: Eine Theorie der digitalen Transformation"2, so als hätten diese Raeithels für das Thema des Sammelbandes einschlägige Arbeiten weiterentwickelt.
Leider nehmen Boes und Kaempf keinen Bezug auf Raeithel und auch sonst keiner der Beiträge –die drei weiteren Texte der Herausgeber:innen inbegriffen.
Boes und Kämpf blicken in ihrem Beitrag auf die Informatisierung als zentrales Element der Produktivkräfte, aus "historischer Perspektive" sogar als "Teil der conditio humana" sowie auf Information als soziale Kategorie.
Soziale Kommunikation als Form gesellschaftlicher Arbeit
Arne Raeithel hatte in den 1980er- und 1990er-Jahren die Ehre, diese drei "konzeptionellen Säulen" nicht nur als grundlegend vorauszuahnen, sondern zumindest teilweise auch bereits tiefer und detaillierter auszuarbeiten als Boes und Kämpf in ihrem Text erkennen lassen.
Sie monieren gleichwohl am Stand der Forschung, dass wegen der Marx’schen Fokussierung auf industrielle Handarbeit die "Sphäre der Kopfarbeit" vernachlässigt wurde. Ihr "Konzept der Informatisierung" will "an dieser analytischen Leerstelle" ansetzen, doch die vermeintliche Leerstelle hätte sich durch Lektüre von Raeithel mehr als schließen lassen.
Ihr historischer Rückblick auf Zeichensysteme bis Buchdruck bleibt deutlich hinter Raeithels Geschichte der "symbolischen Herstellung sozialer Kohärenz" zurück, der Vor- und Frühgeschichte bis Ethnologie aufbietet (Raeithel 1998).
Arne Raeithel analysierte soziale Kommunikation als Form gesellschaftlicher Arbeit, basierend auf einem vergegenständlichten Begriff von Sprechhandlungen bzw. generell von Information als Trägerin einer symbolisch geteilten Welt (1989).
Dabei schloss Raeithel, der selbst programmieren konnte, ausdrücklich "rechnergestützte" Arbeit im digitalen Bereich ein und formulierte einen Arbeitsbegriff, der kognitive Tätigkeit an symbolischen Gegenständen ins Visier nahm (1992).
Veränderungen von Können, Begriffen und Werkzeugen
Der so gezeichnete Arbeitsprozess zielt auf Veränderungen von Können, Begriffen und Werkzeugen, und ging damit weit über die theoretische Analyse von Boes und Kaempf hinaus. Raeithel bewegte sich schon in Bereichen, die der vorliegende Suhrkamp-Sammelband eher defizitär im Kapitel "Kultur und Subjekte" behandelt.
Der von Boes und Kämpf als Gipfel ihrer Analyse präsentierte, von "Bild, Ton, Zeichen usw." erfüllte "Informationsraum" überzeugt nicht wirklich: Er sei sozialer Handlungsraum, durchdringe die Gesellschaft, "eröffne das Potenzial für einen egalitären Modus der gesellschaftlichen Produktion von Wissen".
Dies sind heute Gemeinplätze oder schon lange fragwürdig gewordenen Hoffnungen der "Kalifornischen Ideologie" des Silicon Valley.
Die Raummetapher für das Internet stammt aus den 1980er-Jahren, der Cyberspace, den die Matrix-Filme auf die Leinwand brachten, und ist seit einer guten Dekade als Ordnungsmodell des Internets in den Medienwissenschaften kanonisiert (Bleicher 2010).
Es ist nicht alles Marx, was glänzt
Manchmal ist es nur das Werbe-Spektakel einer PR-Abteilung, das Digitalisierung strahlen lässt. Ulrich Dolata und Jan-Felix Schrape entwerfen in ihrem Beitrag "Politische Ökonomie und Regulierung digitaler Plattformen" ein überraschend unkritisches, teils fast affirmatives Bild der Plattformkonzerne.
Aus Sicht der Organisations- und Innovationssoziologie verteidigen sie zunächst die US-Technologiekonzerne Amazon, Apple, Alphabet/Google und Meta/Facebook gegen die Vorhaltung, dort würde in einem "asset-light-Geschäftsmodell" weitgehendes Outsourcing betrieben. Unklar bleibt dabei, warum sie Microsoft ausnehmen.
Ihre analytische Teilung von "Plattformunternehmen als organisatorischer Kern" und der "Plattform als sozialer Handlungsraum" scheint die Unabhängigkeit besagter "Handlungsräume" von den Konzernen zu betonen.
Das spielt deren Management in die Hände, das die Freiheit ihrer Nutzer gegenüber eigener manipulativer Eingriffe herausstellt. Dolata und Schrape erwähnen zwar das Machtgefälle zwischen Nutzer:innen und Konzernen, haben aber wenig Einwände gegen konzernseitige "lückenlose Beobachtung" des Nutzerverhaltens, dessen Daten "zunächst als Rohmaterial anfallen".
Sie kritisieren den Ansatz von Shoshana Zuboff, weil deren "Überwachungskapitalismus" bei der Entstehung dieser Daten fälschlich von "unbezahlter digitaler Arbeit" der Nutzer ausgehe, obwohl es doch "viel trivialer" um die "bereitwillige Offenlegung ... alltäglichen Verhaltens" ginge. Was den Nutzer:innen, die ihre "Datenspuren oft achtlos und im Vorbeigehen liefern", entzogen wird, seien wertlose Rohstoffe.
Das moralische Recht der Konzerne?
Diese werden erst von den Konzernen durch "Aufbereitungs- und Veredelungsleistungen" zur Ware erhoben. Die Konzerne erwerben damit offenbar nicht nur das ökonomische, sondern auch noch das moralische Recht, private Kommunikation als "handelbare Datensätze und personalisierte Werbemöglichkeiten" zu Geld zu machen.
Die Fixierung auf Marx'sche Wertlehre verstellt hier womöglich den Blick auf die Manipulation der Nutzer:innen, deren Daten nicht "achtlos im Vorbeigehen", sondern in vorsätzlich süchtig machenden Strukturen produziert werden.
Beim Thema Regulierung sehen Dolata und Schrape die Plattformen unter "intensiver Beobachtung" einer "politischen Öffentlichkeit". Zivilgesellschaft und Journalisten hätten "Desinformationsdynamiken" und "Verletzungen der Privatsphäre" aufgedeckt – nebenbei bemerkt: auch in genau jenen Konzernaktivitäten, die Dolata und Schrape als "Veredelungsleistungen" anpriesen.
Doch die Plattformkonzerne hätten auf die Kritik "durchaus reagiert – etwa mit Transparenzinitiativen sowie Versuchen einer institutionalisierten Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure in ihre eigenen Regulierungsstrukturen".
Beispiele nennen die Autoren nicht, daher kommt die Frage nicht auf, ob es sich dabei nur um die üblichen PR-Spektakel gehandelt haben könnte.