Warum die Hirnforschung die Psychologie braucht
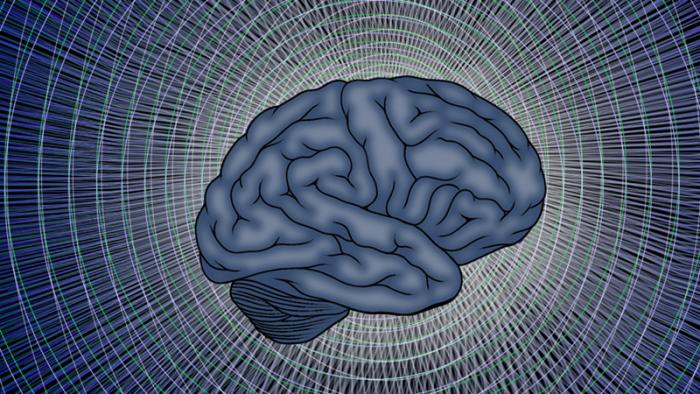
Rätsel Bewusstsein, Gedankenlesen, Gehirnschreibmaschine – was kann die Hirnforschung hier leisten? Kommt sie ohne Psychologie und Philosophie aus oder setzt sie sie umgekehrt zwingend voraus?
Wie Bewusstsein entsteht, wie unser Wahrnehmen, Denken und Fühlen funktioniert, wie wir Entscheidungen treffen und was unser Verhalten bestimmt – all das sind Fragen, die Forscherinnen und Forscher rund um den Globus beschäftigen. Regelmäßig melden sich auch Fachleute aus der Philosophie zu Wort. Manchen gilt die Entstehung des Bewusstseins gar als eines der größten ungelösten Rätsel der Menschheit.
Diese Fragen sind aber nicht nur im rein wissenschaftlichen Sinn von Bedeutung. Tatsächlich geht es auch um unmittelbar lebensrelevante Themen: Wie organisieren wir unser gesellschaftliches Miteinander? Wie unsere Arbeit? Wie müssen Verhaltensregeln – denken Sie an die Pandemie oder den Klimaschutz – gestaltet sein, damit sie funktionieren?
Gemäß dem Reduktionismus funktioniert Wissenschaft so, dass sie allgemeine Erklärungen auf grundlegendere Prinzipien zurückführt [1].
Demnach würde es irgendwann eine Weltformel geben, eine "Theorie für alles", die jeden nur denkbaren Sachverhalt erklärt. Manche halten dann die Physik für die grundlegendste aller Wissenschaften, erwarten also von ihr letztlich diese Weltformel.
Bei den hier genannten Beispielen aus dem Bereich des Bewusstseins, Denkens und so weiter wurden spätestens seit der "Dekade des Gehirns" (den 1990ern) und in Deutschland dem "Manifest führender Hirnforscher [2]" aus dem Jahr 2004 die Erklärungsansprüche der Neurowissenschaften hervorgehoben.
Dieses Manifest wird bald 20 Jahre alt. Die damals formulierten Erklärungsansprüche – beispielsweise zur nahtlosen Erklärung des Bewusstseins oder Entwicklung besserer Behandlungen für psychische Störungen – wurden bekanntermaßen nicht erfüllt.
Neurotraum und Neurotechnologie
Aber auch bei konkreteren technischen Anwendungen, denken wir an den Bereich des "Gedankenlesens", hat sich nicht viel getan. Von dem Enthusiasmus, mithilfe der Hirnforschung unschlagbare Lügendetektoren zu entwickeln, ist wenig übrig geblieben.
Der "Chef-Gedankenleser" John-Dylan Haynes von der Humboldt-Universität in Berlin veröffentlichte dazu erst letztes Jahr ein Buch und zog das Fazit, solche Anwendungen befänden sich noch in einem sehr frühen Stadium [3]. So früh sogar, dass sich die Anwendungsreife nicht einmal sinnvoll beurteilen lasse.
Hier soll aber nicht unter den Tisch fallen, dass es in bestimmten Bereichen durchaus große Fortschritte gibt. Denken wir etwa an Gehirn-Computer-Schnittstellen. Diese erlauben manchen gelähmten Patienten die Kommunikation mit anderen. Ähnliche Systeme könnten in naher Zukunft die Steuerung von Prothesen verbessern. (Hier ein Forschungsprojekt [4]) von Gernot Müller-Putz vom Institut für Neurotechnologie der TU Graz.
Bei solchen Verfahren sollte man aber nicht den Eindruck erwecken, es handle sich um "Gehirnschreibmaschinen". Oft muss der Mensch sich vorstellen, eine bestimmte Bewegung durchzuführen, etwa Öffnen und Schließen der Hand. Ein Computeralgorithmus lernt dann, die damit verbundenen Gehirnaktivierungen in einem bestimmten Sinne zu interpretieren: etwa als Knopfdruck.
Die "Sprache der Neuronen", so es sie denn gibt, hat also noch niemand verstanden. Um Laien einen Eindruck zu vermitteln, wie das funktioniert, sei hier ein konkretes Beispiel genannt:
In der Studie von Mariska Vansteensel und Kollegen von der Universitätsklinik Utrecht bekam eine wegen der schweren Muskelkrankheit amyotrophe Lateralsklerose (ALS) in ihrem Körper gefangene Patientin Elektroden direkt auf die Gehirnoberfläche gelegt [5]. Dafür musste ein kleines Loch in ihren Schädel gebohrt werden. Dann ist die Qualität der Messungen aber viel besser als mit der herkömmlichen Elektroenzephalographie (EEG), die die Signale auf der Kopfhaut aufzeichnet.
Die Patientin lernte nach der Operation 38 Wochen lang mit einem Computer, damit bestimmte Aufgaben auszuführen. Um einen "Brain Click" zu signalisieren, sollte sie sich etwa eine Sekunde lang vorstellen, ihre Hand zu bewegen.
Im Endeffekt konnte sie dann mit einer Geschwindigkeit von 52 Sekunden pro Zeichen Wörter buchstabieren. Wenn man den Buchstabieralgorithmus verbesserte, wie wir es von unseren Smartphones kennen, konnte man die Rate auf 33 Sekunden pro Zeichen verbessern.
Die Studie ist nun zugegebenermaßen aus dem Jahr 2016, hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Solche Details muss man aber wissen, um die Anwendbarkeit einer Technologie zu verstehen.
Die Patientin verwendete übrigens vorzugsweise ein System, das ihre Augenbewegungen erkannte. Doch das funktioniert nicht unter allen Lichtverhältnissen. Daher der alternative Versuch mit der "Gehirnschreibmaschine".
Gehirn als Denkorgan
Das Gehirn wird nun gemeinhin als "Denkorgan" angesehen. Schon im 19. Jahrhundert zogen Physiologen den Vergleich, wie Nieren den Urin, so würde das Gehirn die Gedanken erzeugen. Doch was nutzt uns dieses Bild, wenn man so nicht Bewusstsein oder den Menschen erklären kann? Und: Was heißt das überhaupt?
In den Kognitionswissenschaften spricht sich gerade herum, Kognition (als Oberbegriff für: Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Entscheiden…) müsse gemäß dem 4E-Ansatz erforscht werden. Das steht für verkörpert (embodied), eingebettet (embedded; manchmal auch: situiert), in Interaktion mit der Welt (enacted) und erweitert (extended). 2018 erschien hierzu ein neues Lehrbuch [6] unter Mitwirkung des Bochumer Philosophieprofessors Albert Newen.
Gemeint ist damit, dass wir nun einmal keine reinen Gehirne sind, die in einer Nährlösung schwimmen. Wir haben einen ganzen Körper, in einer bestimmten Situation für eine bestimmte Interaktion. Mit dem "erweiterten Geist" (extended mind) meint man, dass auch Werkzeuge Teil unseres kognitiven Systems sind.
Letzteres kommt auch Cyborg-Fans und Biohackern entgegen, die allerlei Chips mit uns verschmelzen lassen wollen. Man braucht aber nur an sein Smartphone zu denken: Seit etwa die Zugverbindungen auf einen Blick und in Echtzeit abrufbar sind, kann ich mir die Abfahrtszeiten kaum noch merken; und wie man sich ohne Maps in einer fremden Stadt orientierte, kann ich mir kaum noch vorstellen.
Es geht hier nun nicht darum, ob das gut oder schlecht für einen Menschen ist. Übrigens war der alte Philosoph Sokrates vor rund 2.500 Jahren sogar ein Kritiker der Schriftsprache, weil er fürchtete, dass unsere Gedächtnisfähigkeiten darunter leiden. Was hätte er wohl von Online-Suchmaschinen und -Enzyklopädien gehalten?
Phänomenologie
Aus historischer Sicht kann man sich über 4E übrigens wundern: Schließlich reflektiert dies schlicht Grundannahmen, die schon vor 100 Jahren für die Phänomenologen selbstverständlich waren. Mit Formulierungen wie "In-der-Welt-Sein" oder dem "Leib" (als erfahrender Körper) gegenüber dem Körper als materielles Ding haben sie dies bereits ausgedrückt.
Solche deutschen (manchmal auch französischen) Wörter und Wendungen werden übrigens heute noch in englischen Fachaufsätzen verwendet, weil man sie nicht eins zu eins übersetzen kann. Oder um es einmal anders zu sagen: Um das "neue" 4E für innovativ zu halten, musste man erst einmal vergessen, was Phänomenologen schon lange wussten.
Wie der Name dieser Schule schon andeutet, halten Phänomenologen (man denke an Edmund Husserl oder Maurice Merleau-Ponty) die Phänomene, das, was uns erscheint, für grundlegend. Im Grunde sind auch die Ergebnisse eines physikalischen Teilchenbeschleunigers, die ein Physiker auf einem Computerbildschirm abliest, diesem erst einmal nur als Erscheinungen gegeben.
Ein Physiker könnte seine Methode damit verteidigen, dass die Messung von ihm unabhängig durchgeführt wird, durch das Instrument; und dass andere Physiker dieselben Messungen wiederholen und dann idealerweise auch dieselben oder ähnliche Ergebnisse erhalten. Das sei das entscheidende objektive – oder besser: intersubjektive – Element der Wissenschaft.
Und diesem – im 19. und 20. Jahrhundert sehr erfolgreichen – Weg folgte auch die Psychologie. Hier hat sich vor rund 100 Jahren der Behaviorismus durchgesetzt, mit seiner Annahme, dass nur das, was sich objektivieren lässt, einen wirklichen Platz in der Wissenschaft verdient.
Demnach sollte sich die "Seelenlehre" – wörtlich für "Psychologie" – mit dem Verhalten von Menschen und Tieren beschäftigen und nicht mit etwas Subjektiven wie Erscheinungen oder Bewusstsein. Also Seelenleere statt Seelenlehre?
In dieser starken Form rückte man später zwar wieder vom Behaviorismus ab – doch bis heute halten sich in Psychologie (und Psychiatrie) viele Vorurteile, nur das, was sich "objektiv" nachweisen lasse, sei real. Dementsprechend sind bis heute die quantitativen Verfahren, das nie aufhörende Messen, Zählen und statistische Rechnen, die dominanten Methoden.
Subjektivität
Doch lässt sich damit wirklich das Wesen der psychologischen Vorgänge verstehen? Lässt sich Bewusstsein entschlüsseln? Philosophen sprechen von der Subjektivität des Bewusstseins und meinen damit, dass sich manche seiner Eigenschaften nur vom Bewusstsein selbst erkennen lassen.
Und man kann sich umgekehrt fragen, was es wirklich erklärt, wenn man die neuronalen Mechanismen findet, aus denen Bewusstseinsvorgänge hervorgehen. Hirnforscher und Vertreter anderer Disziplinen suchen bereits seit Jahrzehnten nach dem sogenannten neuronalen Korrelat des Bewusstseins.
Stellen wir uns einmal vor, Außerirdische mit einem Superscanner kämen auf die Erde und begegneten dort einem Menschen. Mit ihrem Scanner könnten sie den Zustand von jedem Molekül, Atom, jeder elektrischen Ladung des Gehirns dieses Menschen im Bruchteil einer Sekunde auslesen und dann vollständig in einem Supercomputer simulieren.
Würden sie auf ihrem Computerbildschirm "sehen", was für Erlebnisse dieser Mensch hat? Würden sie dadurch überhaupt irgendetwas Wesentliches über Erlebnisse erfahren? Würde gar die Computersimulation ein Bewusstseinserlebnis haben, nämlich dasselbe des Originals?
Überraschenderweise schrieb ausgerechnet Christoph Koch, einer der bekanntesten Jäger nach dem neuronalen Korrelat des Bewusstseins, Bewusstsein lasse sich nicht berechnen [7]: Ebenso wenig wie die Simulation eines Schwarzen Lochs keine Gravitationskraft hätte, hätte die Simulation eines Gehirns Bewusstseinserlebnisse.
Welche "Zutat" fehlt dann aber fürs Bewusstsein, was tun die Neuronen und anderen Zellen des Nervensystems anderes als Information in Form von elektrischen Reizen zu verarbeiten? Kann Bewusstsein vielleicht doch nur subjektiv, nur aus der Perspektive der ersten Person, die die Bewusstseinserlebnisse hat, verstanden werden?
So weit geht Koch allerdings nicht. Doch meint er, Bewusstsein müsse in die Struktur des Systems eingebaut sein – also seinen Körper? Demnach könne es keine bewussten Computersimulationen, dafür eines Tages aber bewusste Roboter geben.
Bewusstseinsverwirrung
Dazu kommt auch noch, dass in der Forschungswelt alles andere als klar ist, was mit "Bewusstsein" überhaupt gemeint ist. Koch und andere zielen auf den Erlebnisgehalt ab und vermuten die dafür notwendigen neuronalen Strukturen gar nicht im großen Frontallappen unseres Gehirns, auf den wir Menschen so stolz sind, sondern eher im hinteren Teil der Großhirnrinde.
Andere Forscherinnen und Forscher, die Bewusstsein eher als Informationsverarbeitung und Verfügbarmachen von Information für das ganze System auffassen – beispielsweise gemäß der Global Neural Workspace Theory –, finden dann aber doch konsistent Aktivierungsmuster im Frontalhirn. Das neuronale Korrelat hängt also entscheidend davon ab, wie man Bewusstsein versteht und wie man es misst.
Insofern lässt sich die subjektive Komponente nicht aus der Wissenschaft eliminieren. Und das, wo sie doch so objektiv sein will! Vielleicht hat es dann aber gar keinen Sinn, ein Phänomen wie Bewusstsein erforschen zu wollen, wenn man seine entscheidenden Eigenschaften von vorneherein ausschließt.
In diesem Sinne geht auch der 4E-Ansatz nicht weit genug. Zwar braucht man eine holistischere Vorgehensweise, um Kognition zu verstehen. Eine, die Verkörperung, Verhalten und Umwelt mit einschließt.
Und für die subjektive Komponente braucht man eine Methodik, die subjektiven Sachverhalten gerecht wird. Genau das versucht die Phänomenologie. Francisco Varela, Evan Thomson und Eleanor Rosch haben schon in den 1990ern vorgeschlagen, mit einer "Neurophänomenologie" eine Brücke zwischen den Welten zu bauen.
Komplexität
Theorien sollen zwar so einfach wie möglich, also mit so wenig Annahmen und Entitäten wie möglich auskommen; sie nutzen uns aber auch nichts, wenn sie zu einfach sind. Daher müssen sie auch so komplex wie nötig sein.
Hierin bestünde ein echter Schritt nach vorne: anzuerkennen, dass man Menschen eben nicht mit denselben Methoden verstehen kann, mit denen man Elementarteilchen beschreibt. Neben dem angemessenen methodischen Pluralismus kommt dann auch noch die nötige begriffliche Reflexion hinzu.
Hirnforscher können sich nun ewig streiten, ob "das" neuronale Korrelat des Bewusstseins eher im vorderen oder hinteren Teil der Großhirnrinde zu finden ist. Wenn sie verstehen, dass sie den Begriff "Bewusstsein" unterschiedlich verwenden, dann löst sich der Widerspruch auf.
So wird deutlich, dass die Hirnforschung Psychologie oder Philosophie weder ablösen noch ersetzen kann. Umgekehrt setzt das Verständnis neurowissenschaflicher Daten voraus, dass man weiß, was so ein Gehirn, so ein Nervensystem, so ein Körper in einer bestimmten Umwelt tut [8].
Man kann natürlich Vorgänge des Nervensystems so beschreiben, wie man beispielsweise Wetterphänomene beschreibt: rein deskriptiv als Zustände, als Veränderungen und als Wenn-dann-Beziehungen. So wird man aber nicht verstehen, was der Mensch ist oder was es mit seinen Bewusstseinserlebnissen auf sich hat.
In einer neueren Überblicksarbeit beschreiben der Neurowissenschaftler Camilo Signorelli vom Institut für Informatik der Oxford Universität und Kollegen nun schon über 20 Ansätze zum Verständnis von Bewusstsein [9]. Verstehen wir das Phänomen aber desto besser, je mehr Ansätze und Theorien es zu seiner Beschreibung gibt? Oder müssen wir nicht doch erst auf der Ebene der Erscheinungen und Sprache gründlich arbeiten, wie es die Phänomenologen versuchten?
In einem rund zweistündigen Gespräch mit Hannes Wendler und Alexander Wendt von der Universität Heidelberg haben wir dem Zusammenhang von Sprache, Psychologie und Hirnforschung auf den Zahn gefühlt. Interessierte können es sich im Podcast der Arbeitsgruppe Philosophie & Psychologie auf Youtube [10] oder Spotify [11] anhören.
Hinweis: Dieser Artikel erscheint ebenfalls im Blog "Menschen-Bilder" [12] des Autors.
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-6444377
Links in diesem Artikel:
[1] https://www.heise.de/tp/features/Reduktionismus-und-die-Erklaerung-von-Alltagsphaenomenen-6009962.html
[2] https://www.spektrum.de/thema/das-manifest/852357
[3] https://www.heise.de/tp/features/Hirnforschers-Traum-vom-Gedankenlesen-6153469.html
[4] https://www.youtube.com/watch?v=IxkhzPVXDto
[5] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1608085
[6] https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780198735410.001.0001/oxfordhb-9780198735410-e-1
[7] https://www.scientificamerican.com/article/what-is-consciousness/
[8] https://www.heise.de/tp/features/Gehirnscanner-oder-Verhalten-3629658.html
[9] https://academic.oup.com/nc/article/2021/2/niab021/6358634
[10] https://www.youtube.com/watch?v=77CUVFnYYK4
[11] https://open.spotify.com/episode/6ws3MXKV2LwlGkootj9tKt
[12] http://scilogs.spektrum.de/menschen-bilder/
Copyright © 2022 Heise Medien