Hirnforschers Traum vom Gedankenlesen
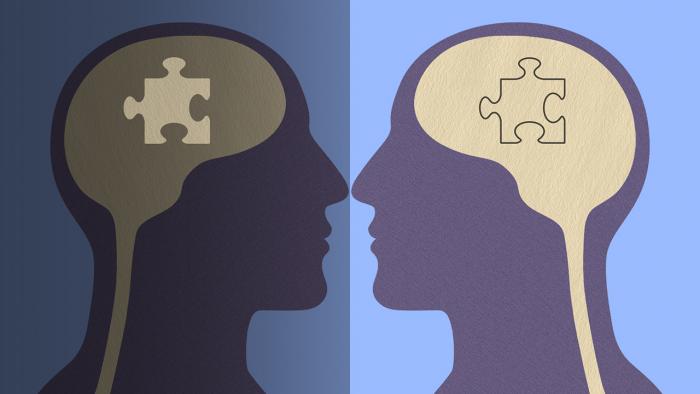
- Hirnforschers Traum vom Gedankenlesen
- Was ist also ein Gedanke?
- Auf einer Seite lesen
Was sind Gedanken, Searles "Chinesisches Zimmer" und Künstliche Intelligenz? – Buchkritik: John-Dylan Haynes' und Matthias Eckoldts "Fenster ins Gehirn" (Teil 2)
Im letzten Teil ging es um die Hirnforschung und den Leib-Seele-Dualismus. Kommen wir jetzt zur Frage, "Was sind Gedanken überhaupt?", der die Autoren Haynes und Eckoldt ein eigenes - jedoch nur fünfseitiges - Kapitel widmen.
Bücher vermitteln Wissen. Anders als in Fachzeitschriften oder populärwissenschaftlichen Medien können Autorinnen und Autoren in Büchern sehr frei schreiben: Es gibt (in der Regel) kaum Einschränkungen zu Inhalt und Umfang. In der "Buchkritik" diskutiere ich ein Kapitel eines Buches, das mich besonders interessiert oder mir zur Rezension angetragen wurde. Wie gewohnt geht es um den Themenbereich Philosophie, Psychologie und Hirnforschung.
Heute steht "Fenster ins Gehirn: Wie unsere Gedanken entstehen und wie man sie lesen kann" (Ullstein Verlag, 2021) von John-Dylan Haynes und Matthias Eckoldt zum zweiten Mal im Rampenlicht. Haynes ist Direktor des Berlin Center for Advanced Neuroimaging und Professor am Bernstein Center for Computational Neuroscience der Charité Berlin. Eckoldt ist erfahrener Wissenschaftsjournalist.
So ein Kapitel ist dringend nötig. Immerhin verspricht das Buch seinen Lesern (und Käufern) eine Antwort auf die Frage, "Wie unsere Gedanken entstehen und wie man sie lesen kann" (Untertitel). Wenn man Gedanken lesen will, dann sollte man schon wissen, was das ist, ein Gedanke. Doch die Autoren relativieren eilig:
Die Neurowissenschaft ist jedoch noch weit davon entfernt, die Sprache der Hirnaktivitätsmuster gänzlich entziffern zu können. Die Hirnmuster sind für uns eher wie rätselhafte Geheimbotschaften, die wir mühsam zu entschlüsseln versuchen. Wir müssen uns also in das Kämmerlein der Gedanken von Probanden quasi erst "einhacken".
Haynes/Eckoldt, Fenster ins Gehirn, S. 53
Um nicht lange um den heißen Brei herumzureden: Die Hauptfrage dieses Kapitels beantworten die Autoren nicht. Das ist auch nicht das einzige Mal. Mich stören solche Bücher, die mehr Fragen aufwerfen als sie - nicht einmal im Ansatz - beantworten. Am Ende dieses Artikels werde ich einen eigenen Vorschlag machen, was Gedanken sind und was es bedeuten könnte, sie zu lesen. Bleiben wir erst noch bei den beiden Autoren.
Das Introspektionsproblem
Diese schreiben dann: "Gedanken entstehen vielmehr durch alle Facetten unseres Erlebens, durch die gesamte Vielfalt unseres Bewusstseinsstroms - und sie äußern sich nicht nur in Sprache" (S. 55). Überhaupt sei es schwierig, Gedanken experimentell dingfest zu machen, denn: "Wer also über seine Gedanken berichtet, verändert diese unweigerlich" (S. 56).
Hier sprechen die Autoren das altbekannte Introspektionsproblem an, ohne es beim Namen zu nennen. In der Philosophiegeschichte und auch der Gründerzeit der akademischen Psychologie (grob um 1900) war man sich des Problems bewusst, dass hier Subjekt und Objekt, Forscher und Forschungsgegenstand zusammenfallen. Menschen kann man nicht wie Atome erforschen. Man muss sie dazu befragen, was in ihnen vorgeht; oder man beobachtet ihr Verhalten und schließt daraus interpretativ auf innere Vorgänge.
Anders als Haynes und Eckoldt schreiben, ist das Kernproblem der Introspektion (wörtlich: Innenschau) nicht, dass der Bericht die Gedanken "unweigerlich" verändert. Hier vergessen sie die zeitliche Dimension: Die Versuchsperson soll ja zum Zeitpunkt t+n berichten, was sie zum Zeitpunkt t (also rückblickend) wahrgenommen oder gedacht hat. Das wirft weniger die Frage auf, ob Aufmerksamkeit die psychischen Vorgänge zum Zeitpunkt t verändert, sondern wie genau die Erinnerung an sie ist.
Wilhelm Wundt (1832-1920), Gründervater der experimentellen Psychologie, bildete deshalb seine Versuchspersonen besonders aus. Diese sollten so spontan und schnell wie möglich einen psychischen Vorgang berichten, damit die Wahrscheinlichkeit einer Verzerrung am geringsten ist. Nur so könne die (Selbst-) Beobachtung wissenschaftlichen Ansprüchen genügen (Wundt, 1888).
Allerdings waren diese Experimente in ihrem Aufbau sehr beschränkt. Häufig sollten die geschulten Versuchspersonen bloß die Wahrnehmungen einfacher Formen oder Lichter berichten. Wundt schloss darum komplexere psychische Vorgänge jedoch nicht aus der Psychologie aus, sondern nur aus dem Bereich der experimentellen Laborwissenschaft. Andere Schulen würden später versuchen, Introspektion auf komplexere Denkvorgänge anzuwenden (nicht zuletzt inspiriert durch die philosophische Phänomenologie).
Behavioristische Entsubjektivierung
Doch dann setzte sich der Behaviorismus durch. Dessen Vorreiter, John B. Watson (1878-1958), verachtete Introspektion als "mentale Gymnastik" (Watson, 1913). Das sei alles zu vage. Überhaupt sollten Psychologen nicht über innere Vorgänge sprechen, auch nicht über Bewusstsein, und sich stattdessen an der Biologie orientieren: Diese untersuchte Tiere über Reiz-Reaktionsmuster, der Form: Stimulus A führt zu Reaktion B.
Der Behaviorismus ging übrigens Hand in Hand mit dem im letzten Teil erwähnten Positivismus: Nur das, was experimentell beobachtbar (positiv gegeben, daher der Name) ist, solle man als existierend ansehen. Bei "internen Vorgängen" oder einem Bewusstseinsstrom läutete der Metaphysikalarm. Das stand im Kontrast zur Ansicht von Watsons Zeitgenossen, Bewusstsein sei das Kernproblem der Psychologie.
Das Fach erholte sich im Laufe des 20. Jahrhunderts zwar vom behavioristischen Trauma. Mit der Introspektion lebt es aber bis heute weitgehend auf gespanntem Fuß - und das haben auch die kognitive Neurowissenschaft und mit ihr die Versuche von John-Dylan Haynes geerbt. Anstatt geschulter Versuchspersonen, untersucht man am liebsten "naive Subjekte", gerne auch die eigenen Studierenden. Die sind mitunter gar zur Teilnahme verpflichtet, um ihre Studienpunkte zu erhalten.
Lücke in westlicher Wissenschaft
Mit der versuchten Entsubjektivierung von Psychologie und Hirnforschung entstand aber eine Lücke und Angriffsfläche, die sich bemerkbar macht, wenn man große Fragen wie: "Was ist ein Gedanke?", oder: "Was ist Bewusstsein?", beantworten will. So schrieb ein bedeutender Vertreter der indischen Philosophie, Swami Veda Bharati (1933-2015), beispielsweise vor ein paar Jahren:
Es ist eine große Schwäche in der Geschichte der westlichen Philosophie, dass die Philosophen, dann die Psychologen und jetzt die Neurowissenschaftler Schwierigkeiten damit haben, zu definieren, was "Geist" [engl. mind] ist. Sie waren nie dazu in der Lage zu unterscheiden, wo die Seele [spirit] aufhört und der Geist anfängt und wo der Geist aufhören mag […] und der Körper (das heißt, Gehirnfunktionen) anfängt.
Swami Veda Bharati
Veda Bharati ist übrigens vor allem für seinen ausführlichen Kommentar der Yogasutras von Patanjali bekannt. Das ist ein wahrscheinlich 1500 bis 2000 Jahre alter Text über den Ablauf psychischer Vorgänge und Meditation, der auch heute noch und weltweit von Studierenden und Lehrenden des Yoga gelesen wird. Es bleibt abzuwarten, ob unsere Lehrbücher von Psychologie und Neurowissenschaft in 1000 Jahren noch jemand ernst nehmen wird.
Die Entsubjektivierung und ihre Folgen treiben wahrscheinlich viele Menschen hier im Westen in Achtsamkeits-, Meditations- oder Yogakurse, weil sie verstehen, dass unsere Psychologie und Hirnforschung lebens-, ja menschenfremd sind. Ein Beispiel hierfür liefert der Religionswissenschaftler und Buddhist sowie studierte Physiker und Philosoph Alan Wallace.
Seit Jahrzehnten kritisiert er den reduktionistischen Ansatz in Philosophie, Psychologie und Hirnforschung. Er bemängelt ein "Tabu der Subjektivität" und arbeitet an einer neuen Wissenschaft des Bewusstseins (z.B. Wallace, 2001). Nach seinem erfolgreichen Santa Barbara Institute for Consciousness Studies eröffnete er kürzlich das zweite Forschungszentrum, das Center for Contemplative Research in Crestone, Colorado (USA). Im Beirat sitzen namhafte Philosophen, Wissenschaftler und Nobelpreisträger Er schreibt über "kontemplative Forschung":
Während man den Geist [engl. mind] beobachtet, kann man inneres Gerede und mentale Vorstellungen in "Echtzeit" wahrnehmen, in genau dem Moment, in dem sie entstehen. […] Man erkennt solche Ereignisse einen Bruchteil einer Sekunde, nachdem sie entstanden, indem man die rückblickende Achtsamkeit [mindfulness] seiner Bewusstseinszustände verwendet. Eine andere Form der rückblickenden Aufmerksamkeit [awareness] ist die Aufmerksamkeit der Aufmerksamkeit selbst, mit der man den unmittelbar vorhergehenden Moment der Aufmerksamkeit feststellt."
Wallace, S. 66; Übers. d. A.
Das hört sich auf den ersten Blick kompliziert an. Tatsächlich steckt dahinter ein intensives Meditationstraining und Studium, das sich hier nicht in ein paar Sätzen einfach erklären lässt. Der Grundgedanke aber ist einfach: Auch Achtsamkeit und Aufmerksamkeit lassen sich trainieren. Dann würde man seine Bewusstseinszustände nicht nur besser feststellen, sondern auch stabiler aufrechterhalten können.
Mustererkennung
Wallace geht also fest davon aus, dass sich mit dem geeigneten Training das Introspektionsproblem beheben oder zumindest beherrschen lässt. Warum ist das nun relevant? Weil Hirnforscher eben nicht den Inhalt von Gedanken auslesen können. Alles was sie - beziehungsweise: ihre Lernalgorithmen - tun können, ist Muster zu vergleichen. Um diesen eine Bedeutung zu geben, braucht es Introspektion oder Umweltwissen.
Nehmen wir ein Beispiel: Man kann verschiedene Steine in einen Teich werfen. Jeder Stein hinterlässt aufgrund seiner Eigenschaften ein bestimmtes Wellenmuster. Wenn man genügend solcher Muster aufgezeichnet hat, kann man den Schluss irgendwann umdrehen: von Welle zu Stein.
Jetzt sieht man nur das Wellenmuster und trifft eine statistische Aussage darüber, wie der Stein wohl beschaffen ist. Manche Eigenschaften (Masse und Form?) lassen sich wahrscheinlich besser rekonstruieren als andere (Material und Reflexionseigenschaften, die wir als Farbe wahrnehmen?). Hierbei wird vereinfachend angenommen, dass die Rahmenbedingungen - Teich und Wurf - immer gleichbleiben, was für Gedanken und Gehirne nicht gilt.
Doch in analoger Weise hängen Wahrnehmungen und andere psychische Vorgänge mit Gehirnvorgängen zusammen. Hat man deren Muster oft genug gemessen, kann man den Schluss umdrehen: von Gehirnaktivität ("Wellen") zu psychischen Vorgängen ("Stein"). Das bezeichnet man heute als wissenschaftliches "Gedankengelesen", obwohl hier gar nichts gelesen, sondern nur verglichen wird.
Das "Chinesische Zimmer"
Zum Verständnis kann man auch John Searles bekanntes "Chinesisches Zimmer" heranziehen: In diesem Gedankenexperiment befindet sich ein Mensch in einem Raum mit einem Computer und zwei Briefschlitzen. Durch den einen Schlitz kommen Zettel mit chinesischen Schriftzeichen herein. Damit sind Fragen formuliert.
Der Mensch spricht zwar kein Chinesisch, kann am Computer aber die Übersetzung der Zeichen-Antwort nachschlagen. Die schreibt er – wieder auf Chinesisch – auf einen neuen Zettel und wirft diesen durch den zweiten Schlitz nach draußen. (Searle entwickelte dies übrigens als Argument gegen den Funktionalismus in der Philosophie des Geistes und die starke KI der 1970er/80er.)
Von außen betrachtet scheint es so, als verstehe das Chinesische Zimmer die Fremdsprache. Dabei vergleicht der Mensch im Inneren nur (für ihn sinnlose) Muster mithilfe eines Computers. Und ebenso wenig verstehen der Computeralgorithmus und die Hirnforscher die Bedeutung der psychischen Vorgänge ihrer Versuchspersonen, sondern vergleichen nur Muster auf ihre Ähnlichkeit.
Daher halte ich es, streng genommen, auch für irreführend, vom "Gedankenlesen" oder "Decodieren" oder "Knacken des Gedankencodes" zu sprechen. Das wäre noch verzeihlich, würde man diesen Sprachgebrauch ausdrücklich als metaphorisch kennzeichnen. Haynes und Eckoldt überziehen hier meiner Meinung nach aber die Aussagekraft der Begriffe. Immerhin klingen sie eindrucksvoll.
