Brasilien: Indigene und Landlose unter Druck
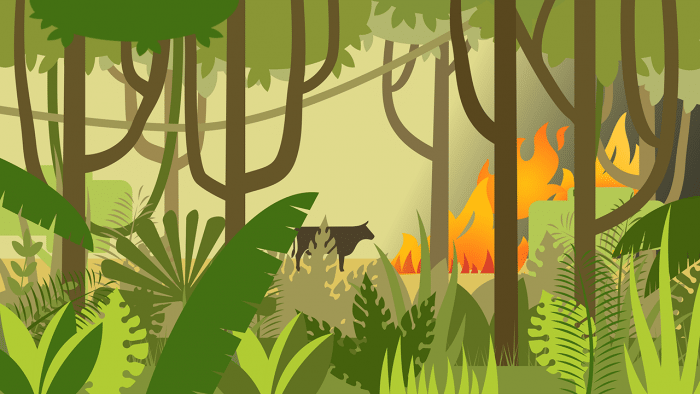
- Brasilien: Indigene und Landlose unter Druck
- Multinationale Konzerne profitieren vom Genozid
- Auf einer Seite lesen
Während in den Metropolen die Zahl der Wohnungslosen steigt, dringen Landräuber immer tiefer in den Regenwald ein. Unterdessen wächst der indigene Widerstand
Nahezu sieben Millionen Familien sind in Brasilien obdachlos. Allein in der Megametropole São Paulo mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern soll die Zahl der Obdachlosen in den letzten drei Jahren um rund 60 Prozent gestiegen sein. Während offizielle Stellen die Zahl der Obdachlosen mit 24.300 angeben, schätzt die Initiative Pop Rua (dt.: Straßenvolk) ihre Zahl auf rund 32.000.
Glaubt man einer Studie von 2018, stehen in ganz Brasilien sechs Millionen Gebäude leer und gibt es 86.000 Brachflächen. Um das Wohnraumproblem zu lösen, fehle der politische Wille, kritisiert Janice Ferreira, genannt Preta. Denn Immobilien sind Spekulationsobjekte. Die bekannte Aktivistin der Obdachlosenbewegung "Movimiento sin Techo" kämpft seit 20 Jahren für mehr Wohnraum. Sie besetzte Flächen, die jahrelang brach lagen, weshalb sie mehr als 100 Tage im Gefängnis verbrachte. In einem Interview mit NPLA bezeichnet sie die Bolsonaro-Regierung als "diktatorisch, totalitär, faschistisch und rassistisch". Sie diene nur den Reichen, nicht aber den Indigenen und Quilombolas (Nachkommen afrikanischer Sklaven).
Tatsächlich haben seit Amtsantritt von Bolsonaro die Konflikte um Land deutlich zugenommen. Die Regierung komme ihrem Schutzauftrag für Indigene und Umweltschützer nicht nach und nehme bei der Corona-Pandemie Opfer in Kauf, heißt es in einem UN-Bericht über eine Untersuchung der aktuellen Menschenrechtssituation in Brasilien von September 2020.
Demzufolge wächst die Zahl der Opfer durch Polizeigewalt nicht nur in den Armenvierteln von Großstädten wie Rio de Janeiro. Auch in ländlichen Gebieten nehmen Angriffe gegen Landlose zu. Rechtsradikale Kräfte und Militärpolizei heizen die aggressive Stimmung weiter an und erzeugen ein Klima der Gewalt. So wurde im August 2020 in Minas Gerais eine Siedlung mit 450 Landarbeiterfamilien ohne gültigen Gerichtsbeschluss von 150 schwer bewaffneten Polizisten geräumt.
Seit mehr als 20 Jahren lebten hier Menschen auf einer ehemaligen Zuckerrohrplantage, auf der sie Mais, Kaffee und andere Lebensmittel produzierten. Auf 40 Hektar bauten sie Gemüse an und pflanzten 60.000 Obstbäume. Ihre Kinder besuchten eigens errichtete Schulen. Mit der Besiedelung setzten die Familien ein Zeichen gegen die ungleichen Eigentumsverhältnisse.
Zwei Monate später wurde im Bundesstaat Paraná ein Koordinator der Landlosenbewegung Movimento dos Sem Terra (MST) entführt und ermordet - nur 50 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem bereits vor vier Jahren zwei MST-Aktivisten durch Polizeigewalt ihr Leben verloren. Der linke Aktivist soll zuvor bedroht worden sein.
Bereits vor Monaten hatte der Präsident angekündigt, wieder "Recht und Ordnung" im Land herstellen zu wollen. Unterdessen formierte sich im Süden des Bundesstaates Bahía die "Forca Nacional" eine dem Justizministerium unterstellte militärische Spezialeinheit. Diese Militäreinheit könnte nun auch gegen die Landlosenbewegung eingesetzt werden, befürchtet Michel Brandt, Bundestagsabgeordneter der Linken.
Überleben zwischen verbrannten Baumstümpfen
Glaubt man Survival International, so wird seit dem Amtsantritt Bolsonaros 2018 pro Minute ein Waldgebiet von der Größe eines Fußballfeldes zerstört. Innerhalb der letzten zehn Jahren wurden rund 300 Menschen wegen Land- und Ressourcenkonflikten getötet. Die im Regenwald lebenden Menschen, die mehr als 300 indigenen - darunter rund100 unkontaktierten - Stämmen angehören, sind für die Regierung nur ein lästiges Hindernis auf dem Weg zum ungebremsten Wirtschaftswachstum. Holzfäller werden bei Rodungsarbeiten kaum noch kontrolliert, vor Gericht müssen sie sich gar nicht mehr verantworten.
Im Bundesstaat Rondonia im Süden lebt das Volk der Karitiana in einem von der Verfassung garantiertem Schutzgebiet. Früher ernährten sich die Menschen vom Fischfang und der Jagd. Nun dringen Invasoren immer aggressiver in ihren Lebensraum ein. Von ihrem Wald ist nicht mehr viel übrig: Nachdem bewaffnete Holzfäller die Bäume rodeten, legten die Großgrundbesitzer Feuer. Die Bewohner leiden unter eindringendem Rauch. Zudem werden Trinkwasser und Fische mit Pestizide vergiftet.
Innerhalb der ersten drei Monaten diesen Jahres rodeten Holzfäller, Rinderzüchter und Sojabauern rund 780 Quadratkilometer Wald, eine Fläche von der Größe New Yorks. Innerhalb der letzten drei Jahre haben sich die entwaldeten Flächen verdoppelt. Illegal gerodete Flächen werden im Nachhinein legalisiert. Dabei steht auch die Existenz der Kleinbauern, die von den Früchten des Regenwaldes leben, auf dem Spiel. Die Sojabauern walzen den Wald nieder und häufen das Holz übereinander auf, um es nachts zu verbrennen, klagt der Armado da Silva, ein einheimischer Kleinbauer. Gegen all das wollen die Ureinwohner nun vor Gericht klagen.
Auch im weiter südlich gelegenen Sojagürtel, wo die Savannen niedergebrannt wurden, schwelen seit Jahrzehnten Konflikte. Denn hier besetzen Indianer das Land ihrer Vorfahren, das ihnen gerichtlich zugesichert wurde. Immer wieder werden sie von benachbarten Sojabauern attackiert. Flugzeuge versprühen Pestizide über Kaiowa- und Guarani-Dörfern. Davon werden die Menschen krank.
Als kürzlich von Indigenen besetzte Sojaplantagen gewaltsam von Sojabauern zurückerobert wurden, schossen sie sechs Menschen an, darunter ein Kind. Ein junger Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Wenige Kilometer weiter, in Mato Grosso do Sul, schossen Landarbeiter auf Kaiowa-Indianer vom Stamme der Guarani. Auch sie hielten Land ihrer Vorfahren besetzt. Die umliegenden Farmer rückten mit schwerem Gerät an, zerstörten die Zelte und schossen auf die Menschen, bis die wenig später eintreffende Bundespolizei die Attacken stoppte.
Unweit davon wurde ein Brandanschlag auf ein Gemeinschaftshaus einer anderen Kaiowa-Gruppe verübt. Derweil profitieren einige Wenige an der Vertreibung und Ermordung unschuldiger Menschen. Am Hafen von Porto Veglio wird tonnenweise Soja nach Asien und Europa verschifft. Der Hafenbesitzer will künftig 100 Millionen Tonnen Soja exportieren, zehn Mal so viel wie heute, wie er stolz verkündet.
Wächter des Waldes auf Patrouille
Die APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, dt: Stimme indigener Völker Brasiliens) kämpft für die Rechte der Indigenen, unterstützt von Survival International, einer internationalen Bewegung, die seit 50 Jahren für den Schutz der indigenen Völker und der Regenwälder kämpft. Längst hat sich der Widerstand auch unter den Ureinwohnern formiert - so wie im Araribóia-Reservat in Maranhão im Nordosten Brasiliens. Das Reservat umfasst rund 4.000 Quadratkilometer und ist damit fast zweimal so groß wie Luxemburg. Wie eine grüne Insel liegt es inmitten gerodeter Amazonas-Wälder.
Seit 2012 durchstreifen freiwillige Wächter vom Stamme der Guajajara den noch intakten Wald, um illegale Eindringlinge aufzuspüren und ihre Camps zu zerstören. Die neun Regionen des Reservates werden von jeweils 15 Wächtern verteidigt. Regelmäßig treffen sich rund 120 Wächter zum Erfahrungsaustausch. Auch Francilene Guajajara, der gemeinsam mit den anderen Stammesführern gegen den Raubbau an der Natur kämpft, will den Wald schützen. Unterdessen eskaliert die Gewalt, und die eindringenden Holzfäller töten immer mehr Menschen. Im November 2019 zum Beispiel wurde Paulo Paulino Guajajara von Holzfällern in einen Hinterhalt gelockt und erschossen.
Auch Jose Amaria Guajajara hat nicht nur den gewaltsamen Tod seines Sohnes, sondern auch den seines Schwagers und seiner Mutter zu beklagen. Die Holzfäller haben Kopfgelder auf die Indianer ausgesetzt. Wer sie findet, darf sie töten. Auch Olimpio Guajajara steht auf der Liste der Killer. Gerüchten zu Folge sind auf seinen Kopf 5000 Dollar ausgesetzt. Als die Holzfäller ihre Morddrohungen offen aussprachen, wandten sich die Guajajara an die Justiz - ohne Erfolg.
Auch sonst ist von den Behörden keine Unterstützung zu erwarten. Seit dem Amtsantrit von Bolsonaro wurden die Mittel der FUNAI, der einzigen Behörde zum Schutz der Indigenen, rigoros zusammengestrichen. Es fehlt an Geld für Schutzausrüstung, Transport und Ausbildung. Bisher durften die Indianer keine eigenen Schusswaffen tragen. Doch nun wollen sie sich selber bewaffnen, damit sie der Gewalt der Holzfäller nicht hilflos ausgeliefert sind.
Unkontaktierte sind besonders gefährdet
Hinter dem Fluss, direkt neben den Guajajara-Dörfern, lebt das Volk der Awá. Eine Videoaufnahme von 2019 zeigt Angehörige des bisher unkontaktierten Stammes. Nur wenn der Wald als Schutzgebiet ausgewiesen wird, haben die Awá eine Chance zu überleben, warnen die Guajajara, die ihre indigenen Nachbarn beschützen wollen. Unterdessen wird der Wald immer trockener, die Brände werden immer heftiger. Wenn im Sommer an den Ufern des Flusses gerodet wird und Feuer ausbrechen, droht der Wasserpegel zu sinken.
Um die Biodiversität zu erhalten, wollen Olimpio Guajajara und seine Männer die Ufer wieder aufforsten. Die Frauen kümmern sich um die Baumpflanzungen, begleiten die Männer aber auch immer öfter bei ihren Patrouillen. Im Kampf gegen die Waldzerstörung fordern sie mehr Mitbestimmungsrechte. Sonja Guajajara, die 2019 mit anderen indigenen Anführern durch Europa tourte, um bei Entscheidungsträgern und Unternehmen über die Zerstörung am Amazonas zu informieren, wurde über die Grenzen ihrer Heimat hinaus bekannt.
Doch im Gegensatz zu ihren Männern wollen die Guajajara-Frauen Waffengewalt möglichst vermeiden. Die größten Feinde sind unter uns, mahnt eine von ihnen und meint Informanten, die die Holzfäller warnen und vom Geschäft mit dem Holz, Alkohol und Drogen profitieren. In der Region Ituna Itatã (dt.: Feuergeruch) im Bundesstaat Pará schreitet die Entwaldung am schnellsten voran.
Als hier im vergangenen Jahr Viehzüchter und andere Landräuber eindrangen, um Feuer zu legen, wurde die Gegend ausschließlich von unkontaktierten Völkern bewohnt. Der größte Teil des Waldes rund um das Reservat der Uru Eu Wau Wau wurde von Viehzüchtern und Holzfällern zerstört, die den Waldbewohnern weitere Brände androhten. So wurden in den ersten vier Monaten diesen Jahres mehr als 1.300 Hektar Wald vernichtet.
Im September 2020 wurde Rieli Franciscato, ein Experte für Naturvölker, an die Grenze des Territoriums gerufen, weil man dort Wochen vorher Unkontaktierte gesehen hatte. Dort wurde er von Männern der Uru Eu Wau Wau angegriffen und getötet. Der tragische Tod des Menschenrechtlers zeige vor allem, unter welchem Druck die Menschen stehen, kommentiert Survival International den Vorfall.