Für eine nachhaltige Entwicklung ist die Auseinandersetzung mit Fehlentwicklungen des modernen globalen Kapitalismus notwendig
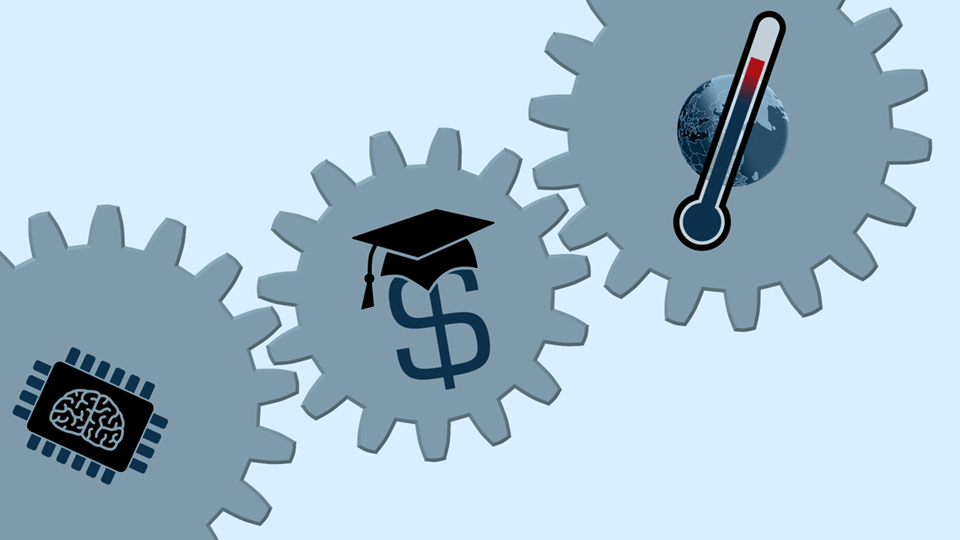
Uwe Schneidwind, Präsident des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie über Klimapolitik, KI, Fridays4Future und Wirtschaftswissenschaften
Seit März 2010 ist der Wirtschaftswissenschaftler Uwe Schneidwind Präsident des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie in der Nachfolge von Peter Hennicke und Ernst Ulrich von Weizsäcker und seit ihrer Gründung im April 2014 auch wissenschaftlicher Vorstand der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft, der neben aktuell 14 anderen außeruniversitären Forschungsinstituten ebenfalls das Wuppertal Institut angehört. Er hat eine Professur "Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit" am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Bergischen Universität Wuppertal und ist zudem Mitglied des WBGU (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen).
In Ihren Funktionen haben Sie nicht nur sehr gute Kontakte in die Politik, sie machen Politik, bzw. beeinflussen deren Randbedingungen. Was sagt Ihnen das Ergebnis der letzten Europawahl?
Uwe Schneidewind: Die Wahlerfolge für die Grünen zeigen, welche Bedeutung starke zivilgesellschaftliche Bewegungen - in diesem Fall insbesondere Greta Thunberg und die Fridays4Future-Bewegung - haben, um ein schon lange virulentes Thema in den Mittelpunkt politischer Entscheidungen zu rücken. Es ist eindrucksvoll zu sehen, wie sich aktuell fast alle Parteien jenseits der AfD mit konstruktiven klimapolitischen Vorschlägen positionieren.
2018 legten Sie mit "Die große Transformation - Eine Einführung in die Kunst des Gesellschaftlichen Wandels" als Präsident des Wuppertal Instituts im Verbund mit 71 Mitarbeiter*innen ein Werk vor, das eine positive Vision für die anstehenden globalen Umbrüche im 21. Jahrhundert präsentieren will.1
Die Messlatte legen Sie sich hoch, der Titel ist bewusst bezogen auf Karl Polanyi und sein "The Great Transformation" aus dem Jahr 1957. Bei ihm bestand die Transformation in der Herausbildung von Marktwirtschaften und Nationalstaaten und ihren Wechselwirkungen, den Marktgesellschaften. Polanyi wird in der letzten Zeit wieder verstärkt im Zuge der Neoliberalismuskritik gelesen. Sie kritisieren die Wegwerfgesellschaft und liefern ein leidenschaftliches Plädoyer für eine Kreislaufwirtschaft.
Inwiefern kann Ihr Werk als eine Fortsetzung, als eine Kritik des Neoliberalismus gelesen werden und wie muss Kapitalismus transformiert werden, resp. sich transformieren, damit Kreislaufwirtschaft eine Chance hat, zu funktionieren?
Uwe Schneidewind: Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) hat ja schon in seinem 2011 erschienenen Hauptgutachten unter Rückgriff auf Karl Polanyi den Begriff der "Großen Transformation" verwendet, um damit für die Größe der Veränderungen zu sensibilisieren, die der Weg zu einer klimaneutralen Welt bedeutet. In unserem Buch greifen wir diese Perspektive des WBGU auf. Der Bezug zur ursprünglichen Analyse von Polanyi ist uns aber sehr wichtig. Wir machen deutlich, dass der Weg zu einer Nachhaltigen Entwicklung unbedingt die Auseinandersetzung mit Fehlentwicklungen des modernen globalen Kapitalismus benötigt.
"Wir überlassen die Zukunftsgestaltung Konzernen"
In ihrem Beitrag am 06.05.2019 auf der re;publica 2019 - "Digitalisierung und Nachhaltigkeit zwischen Utopie und Dystopie" - zusammen mit MdB Dieter Janecek (Bündnis90/Die Grünen), diagnostizieren Sie, dass sowohl unsere Gesellschaft als auch unsere Medienlandschaft eine "sehr starke Ausprägung" an den Polen der Debatten besitzt, die auf der einen Seite in einem nahezu grenzenlosen Optimismus der Digitalwirtschaft und auf der anderen in nicht weniger starken Ängsten und Skeptizismus ihre Ausdrücke findet. Die politische Kultur, so führten Sie aus, funktioniere jedoch eher über Zuspitzung und Extreme. Welche Möglichkeiten für einen konstruktiven Diskurs - jenseits des Gegensatzes von Hype und Horror -, der der Komplexität der Themen gerecht wird, sehen Sie und was kann getan werden, um diesen zu befördern?
Uwe Schneidewind: Unsere These ist: Nur wenn man eine Vorstellung einer wünschenswerten Gesellschaft im 21. Jahrhundert hat, kann gesellschaftlich und politisch darüber diskutiert werden, welche Formen der Digitalisierung dafür dienlich sind: In was für Städten wollen wir in 30 Jahren leben? Wie wollen wir uns nachhaltig und sicher fortbewegen? Wie wollen wir arbeiten? Die Antworten darauf bestimmen letztlich, was "Smart Cities", "Smart Mobility" oder "New Work" sind. Digitalisierung ist dann in einigen Fällen Mittel, um diese Visionen zu erreichen. Einige der Visionen - wie z.B. fußgänger- und radfreundliche Städte - kommen dabei mit sehr wenig Digitalisierung aus.
Heute zäumen wir das Pferd von hinten auf: Wir überlassen die Zukunftsgestaltung Konzernen, die klare Vorstellungen von erfolgreichen Geschäftsmodellen auf der Basis von Digitalisierung haben und versuchen dann den gesellschaftlichen Schaden dieser Geschäftsmodelle zu minimieren. Daher gilt: Societal Purpose first, Digital Means second.
Konkret auf das Thema "Künstliche Intelligenz" bezogen ist in Deutschland der eine Pol durch einen Alarmismus besetzt, in dem sich Ängste des technologisch-wirtschaftlichen Ins-Hintertreffen-Geratens auf seltsame Weise mit der Angst vor der Beherrschung durch künstliche Intelligenz zu verbinden scheinen, wie zuletzt im von Wolf Reiser geführten Interview mit Gernot Brauer hier auf Telepolis: "Etwa in einer Generation könnten Maschinen so intelligent und selbstständig werden, dass sie in die Lage kämen, sich dann die Menschen zu halten wie wir unsere Haustiere."
Brauer benennt aber ebenso ein "KI-Phlegma" der deutschen Politik. Als Vorstandsmitglied der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft, die sich "Gesellschaft & Digitalisierung" als eines von vier Leitthemen auserkoren hat, was antworten Sie auf diese Einschätzungen oder welche Argumente setzen Sie diesen entgegen?
Uwe Schneidewind: Die Künstliche Intelligenz bringt ganz neue Gestaltungspotenziale in unsere Gesellschaft. Sie wird massive Auswirkungen darauf haben, wie wir künftig unsere Arbeit organisieren, wie wir uns fortbewegen und wie wir komplexe Herausforderungen wie den Klimawandel bearbeiten. Aber auch hier gilt: Letztlich ist die KI ein Instrument. Je klarer unsere Vorstellungen von einer künftigen humanistischen Gesellschaft sind, desto besser wird es uns gelingen, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich die Produktivkraft künstlicher Intelligenz positiv entfalten kann.
Es gibt einen bestimmten Technologieskeptizismus linker Provenienz, der die Machtverhältnisse als grundsätzlich in die jeweilige Technologie eingeschrieben sieht. Ein recht bekanntes Beispiel ist die technisch bedingte Client-Server-Architektur des Internet, die von linken Kritikern gern auf Hegels Dialektik von Herr und Knecht abgebildet wird. Von da aus ist es dann nur ein kleiner Schritt bis zur - sicherlich richtigen und notwendigen - Kritik des Plattformkapitalismus.
Auf der anderen Seite gibt es das Beispiel des Kinderarbeit leistenden Humphrey Potter, eines Jungen aus dem frühindustriellen England, der - etwa um 1712 - die von Hand zu bedienenden Einlasshähne einer Newcomen-Dampfmaschine über Schnüre mit dem Balancierbalken verband und so die Maschine sich selbst überlassen konnte, um mit einem Freund Spielen zu gehen. Potter ist somit wohl der unbeabsichtigte Erfinder der kybernetischen Rückkopplung 1. Ordnung.2 Zwecks des Gewinnens politischer Mehrheiten für konstruktive Ansätze, sehen Sie Möglichkeiten, unsere linken Freundinnen und Freunde aus dieser Denkfalle des festgeschriebenen Verhältnisses von Technologie und Macht gewissermaßen zu befreien?
Uwe Schneidewind: Technologie und deren Beherrschung ist immer auch ein gesellschaftlicher Machtfaktor. Das spüren wir derzeit auch bei der Nutzung der neuen digitalen Möglichkeiten, sei es durch die großen Internetkonzerne oder durch autoritäre Regime. Deswegen ist es so wichtig, technologische Gestaltungsmöglichkeiten in einem "Democracy First" zu unterwerfen. Gesellschaften müssen sich über wünschenswerte Zukünfte verständigen. Darin muss sich Technologie einbetten. Demokratische Prozesse brauchen Zeit. Deswegen können durchaus auch Moratorien für die Entwicklung und den Einsatz bestimmter Technologien eine Option für eine demokratische Technikgestaltung sein.
Mit dem Vormarsch rechter Kräfte in einigen westlichen Nationen und autokratisch agierenden Regierungschefs in den USA und Brasilien erfährt die politische Sprache im Westen neben der Polarisierung auch eine gewisse Barbarisierung. Die Digitalisierung wirkt dabei über sogenannte soziale Netzwerke als Katalysator. Das Einparteienregime Chinas, für das der Klimawandel eine Tatsache ist, agiert demgegenüber eher leise, aber auch ökologisch fortschrittlich und sinnvoll. Auf der anderen Seite wird der staatliche Überwachungsapparat in atemberaubendem Tempo ausgebaut. Welche Rolle(n) Chinas sehen Sie und welche Hoffnungen oder Befürchtungen verbinden Sie mit der ökonomischen Supermacht?
Uwe Schneidewind: Die Entwicklungen in China sind durchaus äußerst ambivalent. Da China derzeit nicht nur der größte Emittent von Treibhausgasen ist, sondern gleichzeitig auch das Land, das mit am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen ist, kann man davon ausgehen, dass China seine Anstrengungen zum Klimaschutz weiter verstärken wird. Politisch und gesellschaftlich macht China seinen globalen Hegemonieanspruch sehr deutlich und untermauert ihn sowohl ökonomisch - wie z.B. durch Projekte wie die Neue Seidenstraße oder sein massives Engagement in Afrika - als auch militärisch. Eine Demokratisierung der Gesellschaft wird für dieses Projekt nicht als Nutzen, sondern als Gefahr gesehen.
Alle Erfahrung zeigt, dass mit wachsendem Wohlstand die Einforderung bürgerlicher Freiheitsrechte an Bedeutung gewinnt. Die Kraft der Proteste in Hongkong verdeutlicht den damit verbundenen Sprengstoff. Die Möglichkeiten der Digitalisierung erweitern die Möglichkeiten staatlicher Kontrolle und Machtausübung, werden aber vermutlich die Kraft einer nach mehr Freiheitsrechten strebenden Gesellschaft nicht aufhalten können.
Das Bestechendste an der Fridays-for-Future-Bewegung ist sicher die Tatsache, dass die jungen Mitmenschen emotional und lautstark einfordern, auf die Wissenschaften zu hören und rational zu agieren. Die Forderung "Unite Behind the Science" steht auf einem Segel der Yacht, mit der die Aktivistin Greta Thunberg öffentlichkeitswirksam zum Klimagipfel nach New York aufbrach. Neben FDP-Chef Lindners Bemerkung vom März 2019, dass Klimaschutz und globale Zusammenhänge eher eine Sache für Profis seien und die Jugendlichen doch besser zur Schule gehen sollten, äußert sich nun auch die neoliberale Initiative neue soziale Marktwirtschaft INSM mit Kampagnenpower zum Thema Klima und Schülerstreiks. Wofür kann das Ihrer Sichtweise nach ein Zeichen sein? Und was bedeutet das möglicherweise für zukünftige politische Auseinandersetzungen?
Uwe Schneidewind: Die Fridays4Future-Bewegung hat deswegen eine solche politische und gesellschaftliche Kraft, weil hier junge Menschen um die Bedingungen einer Welt kämpfen, die sie noch selber erleben werden. Viele der heutigen Entscheidungsträger werden die Folgen ihrer heutigen Entscheidungen dagegen nicht mehr ertragen müssen. Das gibt der Bewegung eine solche Authentizität.
Dass die Diskreditierung der jungen Aktivisten im wesentlichen auf der Ebene ihrer persönlichen Lebensstile oder ihrer vermeintlich mangelnden Kompetenz verläuft, ist ein Ausdruck davon, dass man den eigentlichen Argumenten der Bewegung nicht wirklich etwas entgegenzusetzen hat.
"In Zeiten des Umbruchs wären gerade die Wirtschaftswissenschaften als eine "Möglichkeitswissenschaft" gefordert"
An den Universitäten in vielen europäischen Nationen haben heute die Vertreter der neoklassischen Theorie das Sagen und bestimmen die volkswirtschaftliche Modellarithmetik. Kritiker, insbesondere aus den Reihen der sogenannten heterodoxen Ökonomie, schimpfen auf den Mangel an Pluralität an universitären Lehrstühlen. Gibt es für Sie eine praktische Politik, die von einer größeren Modell- und Theorievielfalt in der Volkswirtschaftslehre überhaupt profitieren kann? Sollten die Hochschulpolitiken der Bundesländer dies aktiv fördern oder wäre das ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit?
Uwe Schneidewind: Der Zustand der aktuellen (Wirtschafts)wissenschaften beschäftigt mich ja in vielen meiner Arbeiten. Gerade in Zeiten des Umbruchs, in der die Dysfunktionalitäten der bestehenden Ökkonomie immer deutlicher werden, wären gerade die Wirtschaftswissenschaften als eine "Möglichkeitswissenschaft" gefordert. Damit ist eine Wissenschaft gemeint, die Perspektiven für eine Weiterentwicklung einer ökologisch und sozial gerechten Wirtschaft aufzeigen. An diesen Alternativen wird an den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten viel zu wenig gearbeitet - obwohl immer mehr Studierende genau das einfordern.
Wissenschaft funktioniert leider äußerst selbstreferentiell, auch in der Rekrutierung ihres Nachwuchses. Neue und heterodoxe Ansätze haben es daher äußerst schwer. Der vielversprechendste Weg wäre in meinen Augen, gezielt einige neue Fakultäten oder sogar Universitäten zu gründen, die kritische Köpfe in ausreichender Zahl konzentrieren. Auf diese Weise könnten Zentren entstehen, die für mehr Pluralismus in der Wirtschaftswissenschaft insgesamt sorgen.
Bleiben wir mal bei ökonomischen Modellen. Wichtige Vorreiter der Postwachstumskonzepte sind sicherlich Nicholas Georgescu-Roegen und Herman Daly, die versucht haben, erste Brücken zu schlagen und Synthesen zu bilden zwischen ökonomischen und naturwissenschaftlichen, insbes. thermodynamischen Modellansätzen. Viele Publikationen zum Thema nehmen Bezug auf die beiden Ökonomen, auch aus dem Wuppertal Institut. Können Sie vermelden, ob es gelungen ist, diese Ideen maßgeblich weiterzuentwickeln? Oder steht möglicherweise eine Art Durchbruch bevor?
Uwe Schneidewind: Dies ist ein Ausschnitt von alternativen ökonomischen Ansätzen. Sie sind sehr gut entwickelt und machen deutlich, dass jede Ökonomie immer in ihren ökologischen und nicht reproduzierbaren Grenzen verstanden werden muss. Für die Gestaltung zukünftiger ökonomischer Prozesse sind sie aber nur ein Baustein.
"Ein Teil der proprietären IT-Strukturen in der Hand der BigFive muss zum öffentlichen Gut werden"
U.a. die Beobachtungen Ihres Vorgängers am Wuppertal-Institut, Peter Hennicke, zur kleinteiligen dezentralen Energieversorgungsstruktur in Dänemark sind weit mehr als eine Andeutung, dass Dezentralität generell ein wesentliches strukturelles Merkmal im Hinblick auf anzustrebende Nachhaltigkeit sein kann. Im Bereich Digitalisierung haben wir zur Zeit einen völlig gegenläufigen Trend hin zu nahezu globaler Zentralisierung und Monopolbildung. Hierfür stehen die Big Five, Amazon, Apple, Google/Alphabet, Facebook und Microsoft. Wie ist das zu interpretieren? Kann das auf Dauer gut gehen? Welche politischen Optionen sehen Sie, in ökonomische Strukturbildungsprozesse direkt einzugreifen?
Uwe Schneidewind: In der Dezentralisierung liegt eine besondere Chance der Digitalisierung. Dezentrale Strukturen bauen auf globalen Standards, Infrastrukturen und Services auf. Es braucht daher eine intensive Diskussion darüber, welche öffentlichen digitalen Infrastrukturen geschaffen werden müssen. Ein Teil der proprietären IT-Strukturen in der Hand der BigFive muss perspektivisch zum öffentlichen Gut und demokratisiert werden.
Neuere Simulationen zur Klimaentwicklung und zur globalen Erwärmung sagen, dass wir schon bis zu 90 Jahre weiter sind, als in bisherigen Simulationen errechnet wurde. Die Brände und das teilweise Auftauen der Permafrostböden in Russland und Kanada sprechen dafür. Politische Entscheidungen müssten sich also beeilen. Welche Möglichkeiten sehen Sie - insbesondere für Nationen, für die der Anspruch erhoben wird, demokratisch zu sein?
Uwe Schneidewind: Gesellschaftliche Entwicklungen laufen selten linear. Gerade die schon fast perverse Verleugnung der ökologischen Menschheitsherausforderungen, wie sie aktuell von den Regierungen in den USA und Brasiliens erfolgt, kann eventuell der Keim für eine kraftvolle globale Gegenbewegung sein. Angesichts der Rasanz der Entwicklungen ist zu hoffen, dass das schnell passiert.
In einem Interview hier auf Telepolis spricht der Soziologe Dirk Baecker von einem durch die Auflösung fachlicher Bezüge bedingten Krisenphänomen, das auf die strukturelle Organisation von Wissenschaft übergreift und dort Beharrungskräfte hervorruft: "In der Wissenschaft, die man mit der Universität nicht identisch setzen darf, haben wir es mit breiten, von den Kognitionswissenschaften, der Mathematik und Informatik ausgelösten Auflösungstendenzen fachwissenschaftlicher Bezüge zu tun, gegen die sich die Universitäten wehren, weil sie in Fakultäten und entsprechenden Lehrstuhlzuordnungen organisiert sind, und gegen die sich auch die Studenten wehren, weil sie wissen wollen, mit welchen Berufsbildern sie aus dem Studium entlassen werden." Auch vor dem Hintergrund des Klimawandels, müssen wir vielleicht über völlig neue Organisationsformen von Wissenschaft nachdenken?
Uwe Schneidewind: Hier ist Dirk Baecker absolut zuzustimmen. Aus meiner Sicht brauchen wir künftig vermehrt Universitäten, die wir nicht um Fakultäten, sondern um gesellschaftliche Herausforderungen oder z.B. um ein urbanes Reallabor herum konzipieren. Dann steht der Problembezug im Zentrum und von dort werden die Bezüge zu unterschiedlichen fachlichen und methodischen Zugängen geschlagen.
Einmal abgesehen von organisierter Wissenschaft, die Wissenschaftsgeschichte kennt bis in die Gegenwart das gar nicht so seltene Phänomen des genialen, oft renitenten Einzelgängers, teilweise außerhalb wissenschaftlicher Institutionen, der oder die sich einen Teufel um Organisation schert, sondern einfach "macht". Halbwegs aktuelle Beispiele sind sicher der russische Mathematiker Grigori Perelman oder der deutsche Festkörperphysiker Peter Grünberg. Möglicherweise sind wir mit unseren Problemen in Zukunft sehr angewiesen auf diese Renitent-Genialen. Wo sehen Sie für diese Geister entsprechende Biotope, gewissermaßen unorganisierte Plätze in der Organisation?
Uwe Schneidewind: Einzelne geniale Köpfe werden vermutlich immer wieder auch Wirkräume finden. Wichtig ist es aber, Räume zu haben, in denen gerade junge Menschen an heterodoxes und kritisches Denken herangeführt werden. Diese Freiräume strukturell und institutionell zu erhalten, ist viel herausfordernder.
Das Interview wurde für Telepolis von Dr. Joachim Paul geführt. In der 16. Legislaturperiode von 2012 bis 2017 war er Abgeordneter der Piratenfraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen und dort von 2012 bis 2015 Fraktionsvorsitzender sowie u.a. wissenschaftspolitischer und von 2015 bis 2017 auch wirtschaftspolitischer Sprecher der Piratenfraktion.
