"Ganz schön großartig"
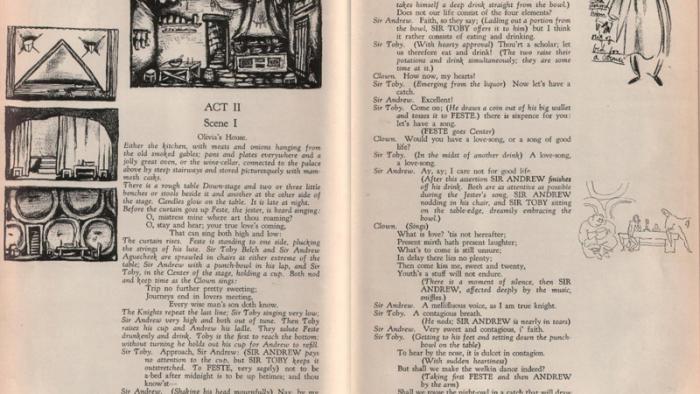
Die amerikanische Kultur und der New Deal
Von Barack Obama wird eine Neuauflage des New Deal erwartet, und er selbst will in die Fußstapfen von Abraham Lincoln treten. Der neue US-Präsident sollte auch einen Blick auf die Kulturpolitik von Franklin D. Roosevelt werfen, wenn er wirklich etwas bewegen will.
Wie ist das, wenn man am „Bildungsstandort Deutschland“ arbeitslos wird? In meinem Fall war es so: Ich hatte Geisteswissenschaften studiert, auch im Ausland (mit einem vom deutschen Steuerzahler finanzierten Stipendium), für zwei Forschungsprojekte gearbeitet und über ein Dutzend Seminare geleitet, als ich plötzlich ohne Anstellung dastand, weil die wenigen festen Stellen langfristig besetzt waren und es kein Geld für neue gab. Meine im Laufe der Jahre gesammelten Urkunden erwähne ich hier nicht, um anzugeben. Ich erwähne sie, weil es mich zu dem bringt, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist.
Lang lebe der Computerkurs
Die jetzt wieder gern gehaltenen Fensterreden über die Bildung als unserem wichtigsten „Rohstoff“ gibt es schon seit Jahren. Nur das Vokabular ist martialischer geworden (das Gerede von der „Bildungsoffensive“ ist relativ neu). Ich glaubte, das mit den Ressourcen verstanden zu haben. Als naiver Mensch ging ich deshalb in der Erwartung zum Arbeitsamt, dass man sich für meine Qualifikationen interessieren würde. Der „Bildungsstandort Deutschland“ hatte mir eine Ausbildung und sogar ein sauteures Auslandsstudium ermöglicht und musste jetzt eigentlich ein Interesse daran haben, etwas zurückzubekommen. Scheinbar nicht. Ich galt als „überqualifiziert“. Damit war dieser Punkt abgehakt. Leider hatte ich das Falsche studiert und aus. Weil ich überqualifiziert war, musste man sich nicht mit der Frage aufhalten, wofür ich qualifiziert gewesen wäre. Ich wundere mich noch heute darüber, dass nie jemand mit mir darüber sprach, was ich konnte und was ich gelernt hatte.
Der für mich und andere Akademiker zuständige Herr im Arbeitsamt hatte sich in den Jahren seiner Tätigkeit ein mitleidiges Dauerlächeln antrainiert, das in etwa zu bedeuten hatte: „Du armer Tropf. Bei uns bist du hier fehl am Platze.“ Wenn das Ziel gewesen sein sollte, mich dazu zu bringen, mir selbst zu helfen, wurde es erreicht. Mein Berater oder mein Betreuer oder wie immer das hieß, als man noch nicht „Kunde“ einer „Agentur“ war, wollte erst wieder mit mir reden, als ich längst keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld mehr hatte. Weil ich nie Arbeitslosenhilfe beantragt hatte, konnte er mich wenigstens nicht zwingen, zur „Weiterqualifizierung“ einen Computerkurs zu besuchen (eigentlich ein komischer Gedanke, da ich doch schon überqualifiziert war).
Meine Geschichte ist kein Einzelfall, und sie ist auch nicht überholt. Von Betroffenen weiß ich, dass einem heutzutage dieser Computerkurs nur schneller aufs Auge gedrückt wird als damals. Wenn man Glück hat, landet man nach abgeschlossenem Universitätsstudium wenigstens nicht im Kurs für Anfänger, in dem man erst mal lernt, wie man den Computer einschaltet. Und wenn man Pech hat, landet man hinterher im Callcenter irgendeiner an der Grenze der Legalität operierenden Firma und verkauft alten Omas einen Staubsauger oder einen Telefonanschluss. Da weiß man dann, dass man sich an einem Bildungsstandort befindet.
Generosität des Geistes
Früher war auch nicht alles besser, aber manchmal eben doch. Die Rede ist von Franklin D. Roosevelt und seinem New Deal, an den jetzt oft erinnert wird, weil man von Barack Obama eine Neuauflage erwartet. Nach einer kurzen Phase der Verklärung, in der man sich erst einmal darauf besinnen musste, was das war, der New Deal, marschieren vermehrt die Wirtschaftsforscher auf, die uns erklären, dass Roosevelt ein Populist war, der im Grunde alles falsch gemacht hat. Aber wenn man die Aussagen dieser Experten von vor einem oder zwei Jahren mit dem vergleicht, was dann eingetreten ist, fühlt man sich an die Damen und Herren vom Wetterbericht erinnert, die für übermorgen Sonnenschein ankündigen und zwei Tage später, nach Dauerregen, ungerührt das Wetter der nächsten Woche vorhersagen. Also sollen wenigstens hier, für die Dauer dieses Artikels, die Wirtschaftsforscher zum Mundhalten verdonnert werden. Es soll hier um einen Bereich gehen, über den man von Obama bisher wenig gehört hat und der uns in einer Weise bereichert hat, die sich nicht in Dollar oder Euro ausdrücken lässt: über den New Deal und die Kultur. Oder, mit den Worten des Schauspielers und Theatermanns Simon Callow, über „einen Kreuzzug, der so reich an Generosität des Geistes und Bandbreite der Absichten war, dass er auch heute noch die Kraft hat, uns zu bewegen.“
Man lernt viel über eine Gesellschaft anhand der Jahrestage, die sie begeht und noch mehr anhand der Jahrestage, an die sie sich nur widerwillig erinnert. Nicht nur wegen der aktuellen Wirtschaftskrise immer wieder gern genommen wird der Börsencrash von 1929. Bei uns wie in den USA wird dann vom Zusammenbruch des Wirtschaftssystems erzählt, von Bankern, die von ihren Hochhäusern gesprungen sind und von der Massenarbeitslosigkeit. An die arbeitende Bevölkerung erinnert man sich überhaupt besonders gern, wenn sie wieder mal passives Opfer einer Krise ist. Dabei gäbe es auch andere Gedenktage. In den USA zum Beispiel könnte man sich in diesem Sommer, zum 75. Jahrestag, an den Juli 1934 erinnern. Dieser Gedenktag hängt eng mit Roosevelts National Industrial Recovery Act von 1933 zusammen, in dem den Arbeitnehmern ausdrücklich das Recht zugesichert wurde, von Repräsentanten ihrer Wahl vertreten zu werden und nicht von Leuten, die der Einfachheit halber von den Arbeitgebern bestimmt wurden, die sich ihre eigenen Arbeitnehmervertretungen hielten (erinnert uns das an was?).
Vom Schwarzen Freitag zum Blutigen Donnerstag
Die schon erwähnten Experten machen Roosevelts Gesetz dafür verantwortlich, dass die Gewerkschaften nun ihre Muskeln spielen ließen, was dann ganz schlecht für die Wirtschaft war. Konkret sah das so aus, dass sich im Frühjahr 1934 die Hafenarbeiter von San Francisco zum Streik entschlossen, weil die Arbeitgeber ihre Gewerkschaft nicht anerkennen wollten. Gekämpft wurde mit harten Bandagen, auch und vor allem von den Arbeitgebern. Am 5. Juli, dem „Bloody Thursday“, versuchten die Schiffseigner, die bestreikten Docks gewaltsam zu öffnen. Dabei wurden zwei Arbeiter getötet, 30 mussten wegen Schusswunden behandelt werden, eine unbekannte Zahl litt an den Folgen von Knüppelschlägen, Tränengas und geworfenen Steinen. Der beste Bericht über den Arbeitskampf ist „Thousand-Dollar Vagrant“ von Tillie Lerner (später Olsen).
Amerikanische Arbeitgeber setzten oft Detektive der Pinkerton-Agentur als Streikbrecher ein (der beste Roman dazu ist Red Harvest von Dashiell Hammett). Behilflich war auch die Polizei. Tillie Lerner wurde unter dem Vorwand der Landstreicherei ins Gefängnis geworfen. Ihr Fall macht allerdings auch deutlich, dass die Dinge nicht mehr ganz so einfach waren wie noch in den 20ern. Lerners Festnahme sorgte landesweit für Empörung, weil sie mit „The Iron Throat“ eine vielbeachtete Kurzgeschichte über ein Bergarbeiterlager veröffentlicht hatte. (Den Plan, einen Roman über die 30er Jahre zu schreiben, konnte Lerner nur teilweise verwirklichen. Die Manuskripte veröffentlichte sie erst 1974 unter dem Titel Yonnondio: From the Thirties. Es ist eins von den Büchern, die man mal gelesen haben sollte.)
Bei der Empörung blieb es nicht. In der Woche nach dem Blutigen Donnerstag wurde in San Francisco der Generalstreik ausgerufen. Er markiert den Beginn der Volksfront in Amerika, also eines Zusammenschlusses von irgendwie „linken“ Gruppen aller Art. Militante Gewerkschaftler fanden sich dort ebenso wieder wie Kommunisten, antifaschistische Gruppen, die Solidarität mit Spanien, Äthiopien und China einforderten, vor den Nazis geflohene Europäer und der linke Flügel des New Deal. Angestrebt wurde eine grundlegende Veränderung der kapitalistischen Gesellschaft. Gelenkt wurde das alles von den Kommunisten in Moskau, oder zumindest behaupten das die Gegner der Volksfront. Tatsächlich spielten die Kommunistische Partei und ihr nahestehende Organisationen eine nicht unbedeutende Rolle. Der New Deal baute auf dem auf, was bereits vorhanden war und ist schon deshalb nicht immer klar von der Volksfrontbewegung zu trennen, weil viele der Aktivisten später in staatlichen Förderprogrammen arbeiteten. Es ist daher auch nicht schwer, ein Sammelsurium von Belegen beizubringen, die angeblich beweisen, dass die New Dealer verkappte Kommunisten, rote Agenten oder bestenfalls Moskaus nützliche Idioten waren. Von den Republikanern werden wir noch viel darüber hören, falls Obama wirklich Programme auflegen sollte, die sich mit denen der Roosevelt-Ära vergleichen lassen.
Aufbruchsstimmung
Das Jahr 1934 steht in der amerikanischen Geschichte ebenso emblematisch für Revolte, soziale Umwälzungen und die Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft wie das Jahr 1968. Der Maler Stuart Davis erzählte 50 Jahre danach einem Reporter, wie das damals war:
„Ich weiß noch, dass ich am 1. Mai aus dem Bett aufstand, weil es zu der Zeit noch eine Maidemonstration gab. Ich dachte eigentlich nie an eine Demonstration zum 1. Mai, oder überhaupt an irgendeine Demonstration, aber sie kam direkt bei mir am Haus vorbei. Ich ging also um die Mittagszeit halb betäubt nach unten, frisch aus dem Bett, und da war gerade diese riesengroße Demo im Gange. Das muss 1934 gewesen sein, und im nächsten Jahr marschierte ich dann mit.“
Nach Jahren der Lähmung und der Depression herrschte eine Aufbruchsstimmung, der sich auch viele von denen nicht entziehen konnten, die unpolitisch waren oder sich wenigstens dafür hielten. Der Satz „Das Herz schlägt links“ hatte damals eine Bedeutung und beschreibt ganz besonders das Lebensgefühl von Leuten wie dem Maler Stuart Davis. Das war kein Zufall. In einem puritanisch geprägten Land wie den USA, das den Künsten gegenüber traditionell sehr misstrauisch war, waren die Künstler noch früher und härter von der Wirtschaftskrise betroffen als andere Berufsgruppen. Wenn sie überhaupt eine Möglichkeit hatten, Geld zu verdienen oder ein Publikum zu finden, verdankten sie das zumeist linken Gruppierungen.
John Reed kennen wir heute als den Mann, der – in Gestalt von Warren Beatty – im Takt der Oktoberrevolution mit Diane Keaton zum Orgasmus kommt (im Film Reds). Reed war aber auch ein bedeutender Journalist, der Augenzeuge der Revolution von Pancho Villa in Mexiko sowie der russischen Revolution wurde und darüber zwei lesenswerte Bücher geschrieben hat, Insurgent Mexico und, mit einem Vorwort von Lenin, 10 Days That Shook the World. Nach ihm wurden die John Reed Clubs benannt. Der erste wurde 1929 in New York gegründet und blieb zunächst der einzige. Aber 1932 gab es überall im Land solche Clubs. Je nachdem, woher man seine Informationen bezieht, waren die Mitglieder entweder Intellektuelle aus dem Bürgertum, oder es waren radikale Kommunisten. Tatsächlich waren es meistens eher informelle, von diesen selbst organisierte Gruppen junger Leute aus der Arbeiterschicht, die oft einen High School-Abschluss besaßen, arbeitslos waren, noch nichts veröffentlicht hatten und hofften, Autor oder Journalist werden zu können. Die Clubs hatten viele kommunistische Mitglieder und wurden von der KP unterstützt, von dieser aber auch argwöhnisch beobachtet. Von den John Reed Clubs und ihren Sprösslingen aus organisierten sich Lyriker, Romanautoren, Maler, Bildhauer, Schauspieler, Photographen, Filmemacher, Tänzer, Komponisten, Musiker.
Junge, unbekannte Autoren hatten es viel schwerer als die Generationen vor und nach ihnen. Von 1929 bis 1932 ging der Umsatz der amerikanischen Buchverlage um 60 Prozent zurück. Es wurden keine Vorschüsse mehr gezahlt (oft die Voraussetzung dafür, dass ein Buch überhaupt fertiggestellt werden kann). Angehende Journalisten hatten es auch nicht leichter, denn es gab eine Zeitungskrise. Die Reed Clubs gründeten eine Vielzahl von Zeitschriften, die dem Nachwuchs eine Veröffentlichungsmöglichkeit boten und organisierten kulturelle Veranstaltungen, von Vorträgen über Kunstausstellungen bis zu Tanzaufführungen. Zu den hektographierten Zeitschriften der Clubs kamen die mushroom mags hinzu, die so heißen, weil sie Anfang der 30er überall wie Pilze aus dem Boden schossen (und oft sehr schnell wieder verschwanden). Viele der Autoren und Leser dieser primär literarischen Magazine, in denen auch Annoncen für ähnliche Zeitschriften in anderen Städten erschienen, standen im regen Briefkontakt miteinander. So entwickelten sich Netzwerke und eine alternative intellektuelle Welt.
Geprägt wurde diese Welt von den New Americans, die gebildeter waren als frühere Generationen mit vergleichbarem sozialen Hintergrund. 1930 waren zwei Drittel der Bevölkerung der großen amerikanischen Städte im Ausland geboren worden oder die Kinder im Ausland geborener Eltern. Viele der Kinder von Einwanderern aus der Arbeiterschicht profitierten davon, dass Anfang des 20. Jahrhunderts vermehrt öffentliche Bibliotheken eröffnet wurden und Arbeiterkinder mehr Chancen bekamen, weiterführende Schulen besuchen zu können. Eine nicht untypische Karriere ist die von Philip Rahv. Geboren als Ivan Grünberg in der Ukraine, kam er mit 14 in die Vereinigten Staaten. Die High School brach er ab. Er arbeitete für eine Werbefirma, wurde Hebräischlehrer, trat 1932 dem John Reed Club in New York bei, gab dessen Zeitschrift Partisan Review heraus (wo Tillie Olsen ihre Bergarbeitergeschichte veröffentlichte) und war dann für eines der Kulturprogramme des New Deal tätig. In den 50ern war er ein bekannter Kritiker und ein führender Intellektueller, wurde Professor an der angesehenen Brandeis University. Ohne Roosevelts Kulturprogramm, sagte er später, hätte er das nicht geschafft. Das gilt für viele solcher Karrieren von Künstlern, Schriftstellern und Intellektuellen.
Der New Deal
Politisch wurden die USA von 1896 bis 1932 von der Republikanischen Partei dominiert, mit einer kurzen Unterbrechung durch Woodrow Wilson. Diese Hegemonie der Republikaner geriet ins Wanken, weil sich nach dem Börsencrash von 1929 die traditionellen Wählerbindungen aufzulösen begannen, es immer weniger Stammwähler gab. Der Versuch Roosevelts, nach jahrzehntelanger Vorherrschaft der Republikaner für die Demokraten ins Weiße Haus einzuziehen, war vielleicht nicht so epochal wie die Wahl des ersten schwarzen US-Präsidenten, aber ein Unternehmen von historischer Dimension war es doch auch. Um das deutlich zu machen, versprach Roosevelt auf dem Nominierungsparteitag der Demokraten im Sommer 1932 den Amerikanern einen neuen Vertrag zwischen Staat und Volk. Den Begriff dafür übernahm er vom Publizisten Stuart Chase, der Anfang des Jahres ein Buch mit dem Titel A New Deal veröffentlicht hatte:
Überall im Land schauen die Männer und die Frauen auf uns, die in der politischen Philosophie der Regierung vergessen wurden, sie schauen auf uns und erwarten sich Führung und eine gerechtere Chance, am nationalen Wohlstand teilhaben zu können. […] Ich verspreche dem amerikanischen Volk ein neues Abkommen („a new deal“). Das ist mehr als ein Wahlkampf. Es ist ein Ruf zu den Waffen.
Der „erste New Deal“ (1933-1935) beinhaltete die unterschiedlichsten Hilfsprogramme, die darauf abzielten, möglichst schnell möglichst vielen Arbeitslosen eine Beschäftigung zu sichern (in neun Wochen wurden 4,2 Millionen Jobs geschaffen). Im Rahmen der Civil Works Administration wurden Straßen, Brücken, Dämme, Deiche und Abwasserkanäle gebaut, was einer infrastrukturellen Revolution gleichkam und deshalb auch wirtschaftlich eine langfristige Wirkung entfaltete. Wenn heute in den USA eine Brücke zusammenbricht, stammt sie meistens aus der Roosevelt-Zeit. Der Einsturz liegt nicht daran, dass damals schlecht gebaut wurde, sondern daran, dass es nie wieder etwas Vergleichbares gegeben hat, also in den Jahren der Deregulierung nicht erneuert und nicht ausreichend gewartet wurde. Gebaut wurden von den New Dealern auch Schulen, Sportplätze und – dies allerdings zunächst nur zögerlich, weil es dagegen noch stärkere ideologische Vorbehalte gab als gegen vieles andere – Kindergärten. Im Rahmen des „zweiten New Deal“ (1935-1939) wurden dann Kindertagesstätten eingerichtet, um Arbeitsplätze für Erzieher, Kindermädchen und Ernährungsexperten zu schaffen. Für die USA war das etwas ganz Neues: das erste staatlich finanzierte und organisierte Programm zur Kinderbetreuung. Es war heftig umkämpft, weil es das traditionelle Frauenbild in Frage stellte und die Konservativen darin einen Vorboten des Kommunismus sahen.
Produktivität und Selbstachtung
Im zweiten New Deal enthalten war auch die von Harry Hopkins geleitete Works Progress Administration (WPA). Die WPA war von dem Gedanken getragen, dass Menschen nicht nur irgendwie in Arbeit gebracht werden sollten, sondern auf möglichst produktive Weise. „Zum ersten Mal wurden die Fertigkeiten des Arbeiters und seine Selbstachtung zur Grundlage eines Hilfsprogramms“, schreiben die Historiker John O’Connor und Lorraine Brown in Free, Adult, and Uncensored (1978), einer lesenswerten Studie über die WPA. Hallie Flanagan formuliert es in ihrem Buch Arena so:
Dieser Schwerpunkt der Works Progress Administration auf den sowohl sozialen wie auch humanen Werten bedeutete, dass zum ersten Mal bei den Hilfsexperimenten in diesem Land die Bewahrung der Fertigkeiten eines Arbeiters und somit die Bewahrung seiner Selbstachtung wichtig wurde. Zuvor waren Menschen in riesiger Zahl von der Regierung in Arbeit gebracht worden; jetzt bestand das Problem darin, sie auseinander zu sortieren, sie in ihrem Beruf arbeiten zu lassen und darauf zu bestehen, dass die von ihnen geleistete Arbeit einem Standard entsprach, der mit den von der Regierung geleisteten Zahlungen in Einklang war.
Mit dem letzten Halbsatz ist gemeint, dass Leute nur dann in ein Projekt aufgenommen werden sollten, wenn sie die dafür nötigen Fertigkeiten besaßen, wenn sie also das, was sie tun wollten, auch tun konnten, weil sie es gelernt hatten. Die Idee war, dass der Staat arbeitslosen Menschen dafür einen Lohn bezahlte, dass sie im Gegenzug dabei halfen, Amerika umzubauen und voranzubringen (womit viel mehr gemeint war als das Anlegen von Autobahnen). Wie revolutionär das war, zeigt der Vergleich mit Großbritannien. Dort wurde zur selben Zeit darüber diskutiert, ob man Brettspiele an Wärmestuben verteilen solle, damit die dort herumsitzenden Arbeitslosen eine Beschäftigung hatten (als Vorläufer von Jodeldiplom und Computerkurs).
Arbeitslose aus den Bereichen Kunst und Kultur sollten nicht mehr Löcher graben, Straßen bauen oder im Park das Gras mähen – nicht, weil sie „etwas Besseres“ waren, sondern weil andere das besser konnten und man sich mehr davon versprach, wenn sie in ihrem Bereich zum Einsatz kamen. Für die Betroffenen war es nicht immer ganz leicht, den Nachweis zu erbringen, dass sie tatsächlich Künstler, Schriftsteller, Schauspieler oder Musiker waren. Sehr günstig war es, wenn man in einer der vielen kleinen Zeitschriften der Kulturvereine veröffentlicht hatte, wenn man bei einer von diesen Vereinen organisierten Veranstaltung aufgetreten war oder Werke in einer Kunstausstellung gezeigt worden waren, auch wenn man nichts verkauft hatte. Weil sich sehr viele dieser kulturellen Aktivitäten mit den von der KP finanziell unterstützen John Reed Clubs in Verbindung bringen ließen, galt die gesamte WPA ihren Gegnern als kommunistisch unterwandert. In der Tat tendierten die von der WPA beschäftigten Menschen insgesamt eher nach links. Wenn man bedenkt, dass es sich um die vom Kapitalismus maßlos enttäuschten Opfer einer Wirtschaftskrise handelte, ist das auch kein Wunder. Die kommunistische Weltverschwörung muss man dafür nicht bemühen.
Der New Deal hatte einen, wie man heute sagen würde, ganzheitlichen Ansatz. So ergab sich für die Kulturschaffenden zum Beispiel eine Aufgabe daraus, dass der soziale Wohnungsbau angekurbelt wurde. Noch einmal Hallie Flanagan, in der für den New Deal typischen Rhetorik:
Welche Rolle konnten die Künste in diesem Programm spielen? Konnten wir, durch die Kraft des Theaters, ein Schlaglicht auf die Slums und Mietkasernen werfen und so bei dem Plan mithelfen, für alle Menschen anständige Wohnungen zu bauen? Konnten wir, durch Schauspieler und Künstler, die die Armut am eigenen Leib erfahren hatten, Musik und Theater zu den Kindern in den Stadtparks bringen, und Kunstgalerien in die Kleinstädte? Waren nicht Menschen, die mit ihrer Arbeit glücklich waren, das stärkste Bollwerk der Demokratie? […] Der Glaube an die Theorie, dass die Arbeit des Künstlers ein Teil des nationalen Reichtums war, den zu verlieren sich Amerika nicht leisten konnte, der Glaube an ein neues Muster des Lebens, das diese Arbeit für viele Menschen schaffen konnte – das waren die leidenschaftlichen Beteuerungen, die der sich abwechselnden Verzweiflung und dem Gelächter dieser so außergewöhnlichen Zeit zugrunde lagen.
Kein Leben ohne Kunst
Auch wenn wir es, geschädigt durch die Sprechblasen unserer Politiker, für leeres Gerede halten mögen: Für Harry Hopkins und viele seiner leitenden Mitarbeiter war die Kunst kein in Krisenzeiten leicht verzichtbarer Luxus, sondern ein lebensnotwendiges Gut. Die WPA beschäftigte etwa 40 000 Menschen aus Kunst und Kultur. In der Privatwirtschaft ist man bestrebt, Personal und Lohnkosten möglichst gering zu halten. Für die von der WPA finanzierten Projekte galt das Gegenteil. Höchstens zehn Prozent der jeweils bewilligten Mittel sollten für anderes als für die Personalkosten aufgewendet werden. Diese ungewöhnliche Verteilung zwang in vielen Fällen dazu, neue Wege zu beschreiten, brachte die Verpflichtung zur Innovation mit sich. Von den vier Milliarden Dollar, die 1935 für staatliche Hilfsprogramme bewilligt wurden, waren 27 Millionen für arbeitslose Künstler, Musiker, Schauspieler und Schriftsteller vorgesehen. Gemessen am Gesamtvolumen ist das eine verschwindend geringe Summe. Das Resultat war enorm, die Folgen sind noch heute spürbar. Aufgebaut wurde auch ein Kulturapparat, von dem große Teile weiter fortwirkten, nachdem die WPA längst abgeschafft war. Die Nachkriegszeit erlebte, obwohl die Demokraten im Weißen Haus wieder durch Republikaner abgelöst wurden, eine starke Ausdehnung staatlicher Kulturprogramme (Kunstausstellungen, Konzerte), zu denen man, wenn man so will, auch die heimliche Finanzierung der Zeitschrift Encounter durch die CIA rechnen kann.
Viele Autoren, die heute aus keiner amerikanischen Literaturgeschichte mehr wegzudenken sind, arbeiteten im Federal Writers Project, fanden dort ihre politische und ihre künstlerische Stimme: Margaret Walker, Arna Bontemps, Chester Himes, Nelson Algren, Richard Wright, Meridel Le Sueur, Ralph Ellison, Jerre Mangione (Mangione schrieb ein Buch darüber, The Dream and the Deal). Im Rahmen des Writers Project entstand die berühmte American Guide-Reihe, Reiseführer für einzelne US-Bundesstaaten oder Regionen, deren Autoren auch vor schwierigen Themen nicht zurückschreckten und nichts von Beschönigung hielten (einige Texte wurden allerdings nur in zensierter Form oder gar nicht aufgenommen). Für viele waren die Projekte der WPA eine Durchgangsstation auf dem Weg zu einer Karriere in der Kulturbürokratie, im Universitätssystem oder in der Kulturindustrie. Durch die WPA wurde es möglich, als Autor, Komponist, Darsteller, Musiker, Designer oder Künstler seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die vielen Kunstwerke, Bücher, Aufführungen usw., die durch die Projekte entstanden, waren das eine; das andere, vielleicht noch wichtigere, war, dass die Projekte zu einer Professionalisierung der Künste beitrugen.
Mitarbeiter des Industrial Folklore Project sprachen mit Bergarbeitern, Fabrikarbeitern und Eisenbahnern und schrieben die in diesen Kreisen erzählten Geschichten auf (einige davon kann man in dem sehr erfolgreichen, von Benjamin A. Botkin 1944 veröffentlichten Sammelband A Treasury of American Folklore nachlesen). Als das Folklore Project 1939 beendet wurde, kamen einige der Mitarbeiter in der Gruppe der Tänzerin und Anthropologin Katherine Dunham unter (die Gruppe arbeitete an einer Bestandsaufnahme afroamerikanischer Religionen) und dann bei Horace Cayton. Aus dessen Forschungen gingen zwei bedeutende, 1945 veröffentlichte Untersuchungen zur afroamerikanischen Migration hervor: Caytons und St. Clair Drakes Black Metropolis sowie They Seek a City von Jack Conroy und Arna Bontemps; Conroy schrieb außerdem einen vielgelesenen Roman, The Disinherited.
Kultur und Landwirtschaft
Eine kulturell sehr wichtige Rolle spielte ein Haus, von dem man so etwas vermutlich zuallerletzt erwarten würde, wenn man an deutsche Verhältnisse denkt: das Landwirtschaftsministerium. Ein Referat dieses Ministeriums, die Resettlement Administration (kurz RA, später umbenannt in Farm Security Administration), versuchte, die Armut auf dem Land dadurch zu bekämpfen, dass sie experimentelle landwirtschaftliche Genossenschaften aufbaute, im Grüngürtel um die Städte Mustersiedlungen für Arbeitslose anlegte und Wohnhäuser für Landarbeiter errichtete, die durch die Dürrekatastrophe im Mittleren Westen zur Auswanderung in andere Landesteile gezwungen wurden, vor allem nach Kalifornien (Hintergrund von John Steinbecks Roman The Grapes of Wrath). Die RA leistete sich eine historische Abteilung, die Photographen, Filmemacher, Künstler und Musiker beauftragte, diese Projekte (und die bäuerliche, starken Veränderungen unterworfene Kultur generell) zu dokumentieren.
So entstand ein riesiges, durch nichts zu ersetzendes Archiv mit Bildern von Dorothea Lange, Walker Evans, Marion Post Walcott und Gordon Parks, um nur einige der berühmtesten Photographen zu nennen. Der Kritiker Pare Lorentz drehte zwei mit neuen Techniken experimentierende Dokumentarfilme, The Plow That Broke the Plains und The River. Die neuen Siedlungen erhielten Skulpturen und Wandgemälde, etwa von Ben Shahn. Mit Hilfe eines Kulturprogramms sollte ein Gemeinschaftsgefühl entstehen. Der Musikwissenschaftler Charles Seeger veranstaltete Konzerte. Nicholas Ray sorgte für die Aufführung von Theaterstücken und Historienspielen, organisierte Umzüge, half Seeger dabei, die Musik der Landbevölkerung für die Nachwelt festzuhalten und leitete dann auch Radioprogramme mit Folkmusik, in denen Woody Guthrie, Josh White und Leadbelly auftraten. Das Archive of American Folk Song der Library of Congress gäbe es auch ohne die historische Abteilung der RA, aber es wäre um vieles ärmer. Pete Seeger führte die Arbeit seines Vaters Charles fort. Seine Folkways-Aufnahmen kann man kaum mehr zählen, seine Banjo- und Twelve-String Guitar-Lehrbücher sind Pionierleistungen, und er ist das Bindeglied zwischen Woody Guthrie und Bob Dylan.
Bevor man loslegen konnte, musste man einen Antrag mit fünf Durchschlägen einreichen (in verschiedenen Farben). Roosevelts WPA wird oft als Bürokratiemonster bezeichnet, das Kreativität und künstlerische Freiheit erstickte. So schlimm war es nicht. Die meisten der Künstler hatten kaum mehr etwas mit Bürokraten zu tun, wenn der – in der Regel sehr allgemein gehaltene – Antrag erst einmal genehmigt war. „Die Planung war nicht formell“, erinnert sich die für die RA als Bildhauerin tätige Lenore Thomas:
Jeder von uns entschied sich, was er tun wollte, und dann tat er es. Charles Seeger reiste durch das Land, machte Tonaufnahmen und studierte Folk Songs, Ben Shahn reiste mit der Kamera durchs Land und malte Fresken in bestimmten Siedlungen, ich schuf Skulpturen für verschiedene Siedlungen, und in einer davon, in Tennessee, lebte ich mehrere Monate lang. Das erweckt den Eindruck, als ob es ein Paradies für Künstler gewesen wäre, und ich denke, das war es auch.
Das große Interesse der für die WPA arbeitenden Künstler, Schriftsteller und Wissenschaftler an allen Formen der amerikanischen Kultur (angestoßen von der WPA entstand auch eine ganze Reihe von Werken über die amerikanische Kultur-, Literatur- und Wirtschaftsgeschichte, die Geschichte des Jazz, der Index of American Design usw.) sorgte für ein neues Nationalbewusstsein und die Herausbildung eines Studienfaches, das bisher – wenn überhaupt – eher eine Mauerblümchenexistenz geführt hatte: die „American Studies“. 1941 wurde die historische Abteilung der RA in das Office of War Information eingegliedert. Auch andere ehemalige Beschäftigte der WPA wurden Teil der Propagandabemühungen der Regierung, die darauf abzielten, den Rest der Welt von den besonderen Qualitäten Amerikas zu überzeugen. Nicht immer war deren Tätigkeit im Sinne des Auftraggebers. Ben Shahn entwarf Plakate, von denen nur einige wenige gedruckt wurden. Dorothea Lange dokumentierte die Internierung japanischstämmiger US-Bürger. John Houseman, ehemals beim Federal Theatre, war Mitbegründer des Radiosenders „Voice of America“ und handelte sich regelmäßig Ärger ein, weil er dort „Radikale“ zu Wort kommen ließ, vom Sänger Woody Guthrie über den japanisch-amerikanischen Autor Ayako Ishigaki bis zu Bert Brecht. Bei uns in Deutschland wurden nach dem Krieg die Amerikahäuser eröffnet, und an einigen Universitäten wurde der Studiengang „Amerikanistik“ eingerichtet. Beides verdankten wir der „Entdeckung“ der amerikanischen Kultur in den 30ern. Was daraus geworden ist, ist allerdings eher kläglich. Das ist nicht zuletzt die Schuld unserer Kulturpolitik und – was die Amerikahäuser angeht – der Regierung von Bill Clinton. Man kann nur hoffen, dass Hillary daraus gelernt hat, auch wenn sie gerade die Gesichter von damals zu sich ins Außenministerium holt.
Grotesker Realismus
Aus den Projekten der RA ging das Buch hervor, das heute – zusammen mit Steinbecks Früchte des Zorns – als das große, repräsentative Werk der 1930er Jahre und der Depressionszeit gilt: Let Us Now Praise Famous Men von James Agee und Walker Evans. Beide Bücher haben nicht nur Fans. Viele Verächter mögen sie trotzdem, weil sie glauben, mit ihnen belegen zu können, dass die radikalen 30er künstlerisch eine im Grunde unbedeutende und folgenlose Dekade waren. In historischen Darstellungen werden die 30er gern auf eine zwischen Moderne und Postmoderne in der Luft hängende Verirrung reduziert, auf eine Phase, die sich am überkommenen Naturalismus des 19. Jahrhunderts orientierte, sich ganz dem dokumentarischen Impuls auslieferte und die man deshalb getrost vergessen kann. Das täuscht. Let Us Now Praise Famous Men sagt mehr über die Begeisterung der 1960er (in denen es wiederentdeckt wurde) für eine dokumentarische Form von Authentizität aus als über die 1930er. Das zeigt sich schon an den verschiedenen Formen von Realismus, mit denen damals experimentiert wurde und die alle etwas ganz anderes meinen: „new realism“, „dynamic realism“, „magic realism“, „social surrealism“, „proletarian surrealism“.
Der „Schwarze Freitag“ des Jahres 1929 scheint eine ganz andere Erfahrung gewesen zu sein als das, was wir gerade – bisher erstaunlich unaufgeregt – als Finanz- und Wirtschaftskrise erleben. „Der Börsencrash“, schreibt Edmund Wilson in The Shores of Light: A Literary Chronicle of the 1920s and 1930s, “war für uns fast so, als ob die Erde aufgerissen worden wäre, als Vorbereitung auf den Tag des Jüngsten Gerichts.“ In der Literatur der Zeit spiegelt sich das wider. Statt von Realismus sollte man daher vielleicht besser von einer Form des Grotesken sprechen, das sich der beruhigenden Ästhetisierung entzieht. An der Beschreibung der Bergwerksexplosion in Tillie Olsens „The Iron Throat“ kann man das genauso ablesen wie am Textteil von Let Us Now Praise Famous Men, in dem James Agee jede Form von Ästhetisierung des Lebens der von Walker Evans photographierten Menschen ablehnt, an Billie Holidays Lied „Strange Fruit“ (die Beschreibung eines gelynchten Körpers als ein Stück grotesk verformtes Obst) oder an dem, was bei Nathanael West (Day of the Locust; A Cool Million) mit menschlichen Körpern geschieht. Quentin Tarantino sagt gern, dass seine Filme von denen des italienischen Regisseurs Mario Bava inspiriert sind. Der sehr belesene Bava war, seiner eigenen Aussage nach, unter anderem von der amerikanischen Literatur der 30er beeinflusst (was man nur versteht, wenn man sich von den gängigen Realismus-Klischees verabschiedet). Man könnte da interessante Vergleiche anstellen.
Die Lincoln Republic
Weil seine Siegesrede nach der Wahl versöhnlich sein und Gräben überwinden sollte, baute Barack Obama eine Stelle aus Lincolns erster Amtseinführungsrede ein („We are not enemies, but friends … Though passion may have strained, it must not break our bonds of affection.”). Als er in einem Fernsehinterview gefragt wurde, welches Buch er – außer der Bibel – als für ihn essentiell mit ins Weiße Haus nehmen werde, nannte er Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln von Doris Kearns Goodwin (in dem Buch wird geschildert, wie Lincoln sich mit starken, erfahrenen Persönlichkeiten aus verschiedenen Lagern umgibt, die sich selbst für befähigter halten als ihn – Hillary Clinton liest es inzwischen auch). Obama hat sich entschlossen, für seine Amtseinführung die Bibel aus der Kongressbibliothek holen zu lassen, auf die vor ihm schon Abraham Lincoln die Hand gelegt hat, um den Amtseid zu leisten. Offensichtlich lässt er sich gern mit dem Mann vergleichen, der bestrebt war, die Nation zu einen, um gemeinsam eine schwere Krise zu bestehen. Aber die mitunter etwas dick aufgetragenen Lincoln-Bezüge führen uns nicht nur in die Zeit nach dem Bürgerkrieg, sondern zurück in die 30er Jahre. Auch damals begegnete man überall Anspielungen auf Abraham Lincoln – allerdings in einem radikaleren, weniger versöhnlichen Kontext, als das Obama, dem Mann des Ausgleichs, lieb sein kann.
„Das lässt mich an einen alten Mann denken, den ich mal gekannt habe“, endet einer von den Texten in William Carlos Williams’ The Farmers’ Daughters. „Als sie ihn fragten, wie weit er sich zurückerinnern könne sagte er, Ich kann mich an die Zeit zurückerinnern, als die Vereinigten Staaten eine Republik waren.“ Das ist der Ausgangspunkt für vieles von dem, was in den 30ern geschrieben, gemalt, photographiert und gesungen wurde. Wir alle kennen die Geschichte vom alten Süden, der den Bürgerkrieg verliert und untergeht. Wir haben sie oft genug in Romanen gelesen und in Filmen gesehen (Gone With the Wind). Weniger bekannt ist die Geschichte vom Norden, der den Krieg gewann und dann doch der Verlierer war. Richtig erzählt werden kann sie erst seit dem Börsencrash von 1929, weil sie seit damals einen Schluss hat. Es ist die Geschichte vom Niedergang der „Lincoln Republic“ (eines wieder vereinten, von den Sünden der Sklaverei gereinigten Landes), die Geschichte von vertanen Gelegenheiten und vom Sieg des großen Geldes, von der Transformation einer Republik in ein Imperium. Ihr sind gleich mehrere große Trilogien gewidmet: John Dos Passos’ U.S.A., Josephine Herbsts Trexler-Trilogie, die Mercury-Trilogie von Orson Welles (Citizen Kane, The Magnificent Ambersons, The Stranger). Vom Börsenkrach und vom Trauma der Wirtschaftskrise aus eröffnete sich eine neue Möglichkeit, die amerikanische Geschichte und die amerikanische Gesellschaft zu verstehen und darzustellen (in Citizen Kane wird der Aufstieg und Fall eines Jungen erzählt, dessen Erziehung eine Bank übernimmt).
Zur Geschichte vom Verrat und Niedergang der Lincoln Republic gehören die überlebensgroßen Schurken, die Wirtschaftsbosse und Medienzaren. Matthew Josephson hatte in den 20ern für eine Börsenfirma gearbeitet, gab in den frühen 30ern die mushroom mags Broom und Secession heraus und beschloss dann, über die „Männer des großen Geldes“ zu schreiben und über „die Ära nach dem Bürgerkrieg, in der sich ihre Geschäfte so prächtig entwickelten, als Amerika das Paradies des freibeuterischen Unternehmertums war“. Sein Buch The Robber Barons: The Great American Capitalists, 1861-1901 (über Rockefeller, Carnegie und Morgan) wurde ebenso ein Bestseller wie Ferdinand Lundbergs Imperial Hearst. Der „Räuberbaron“ ist eine der eindrücklichsten Figuren der 30er Jahre (der Begriff stammt ursprünglich aus einem 1880 erschienenen Pamphlet von Farmern aus Kansas gegen Monopole in der Landwirtschaft). William Randolph Hearst, Minenbesitzer und König der Boulevardblätter, tritt in Dos Passos’ U.S.A. auf und ist eines der Vorbilder für Kane in Welles’ Citizen Kane (Henry Luce, Gründer der Magazine Time und Life, ist das andere).
Die Works Progress Administration betrieb Theater, Kulturzentren und Orchester, produzierte Tausende von Wandgemälden und Radiosendungen und mehr als 800 Theaterstücke. Auch wenn man es sich heute kaum noch vorstellen kann: Mexikanische Revolutionsmaler (José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros) schufen Wandgemälde (murals) für öffentliche Gebäude in den USA. Das sorgte für heftige Auseinandersetzungen (1933 löste das Überpinseln von Riveras Wandgemälde im Rockefeller Center eine der großen politischen Kontroversen des Jahres aus). Damals entstand viel unpolitische und traditionelle Historienmalerei, aber man konnte auch jederzeit damit rechnen, dass wieder in irgendeinem Postamt ein avantgardistisches und/oder antikapitalistisches, vom Federal Arts Project (FAP) finanziertes Wandgemälde (mit oder ohne Räuberbarone) enthüllt wurde. Die muralists hatten großen Einfluss auf die amerikanische Kunst. Man kann das zum Beispiel am Werk von Jackson Pollock sehen, der sowohl für das FAP wie für das Landwirtschaftsministerium arbeitete, bevor er als Sympathisant der Kommunisten gefeuert wurde.
Streik bei der Mickey-Maus
Dieser Einfluss machte sich auch da bemerkbar, wo man eher nicht damit rechnen würde. Als Walt Disney expandierte (von 200 Beschäftigten im Jahr 1935 auf 1100 im Jahr 1940), kam eine neue, politischer denkende Generation von Cartoonisten aus dem Umfeld des Federal Arts Project in sein Trickfilm-Studio. Diese Generation trug den neunwöchigen Streik des Jahres 1941, der das Unternehmen in zwei Teile spaltete und noch weitreichende Folgen haben sollte, weil er zur Bildung der den McCarthyismus befördernden Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals führte (Walt Disney war Gründungsmitglied und erster Vizepräsident). Aus Sicht des Chefs war die Sache klar: Den Streik hatten kommunistische Agitatoren angezettelt, die aus Sozialneid seine heile Welt in Unordnung bringen wollten. Einige der Streikbrecher unter den Cartoonisten sollen die Streikenden, ganz im Sinne Walts, in Form der Clowns karikiert haben, die in Dumbo das Lied „We’re Gonna Hit the Big Boss for a Raise“ singen. Es ging aber nicht nur um mehr Geld.
Man muss kein Kommunist sein, um den Unmut der Streikenden zu verstehen. Disney führte sein Studio paternalistisch bis diktatorisch. Er bestimmte alles, das Finanzielle ebenso wie das Künstlerische. Es gab eine undurchsichtige, ungerechte und von den Launen des Chefs abhängige Gehaltsstruktur. Disney setzte seinen Namen über das, was andere geschaffen hatten. Verhandeln wollte er nur mit einer von ihm kontrollierten Vertretung der Angestellten, nicht mit einer unabhängigen Gewerkschaft. Weil Disney strikt dagegen war, dass Frauen zusammen mit Männern arbeiteten, waren die weiblichen Beschäftigten in einem eigenen Gebäude untergebracht. Die Frauen standen ganz unten in der Hierarchie, wurden oft mit Hungerlöhnen abgespeist und waren so eingeschüchtert, dass sich nur wenige am Streik beteiligten. Wer ganz normale Arbeit leistete, offiziell aber noch zum Cartoonisten ausgebildet wurde, erhielt ein Praktikantengehalt.
Zwischen Disney und einem Teil der Streikenden gab es auch künstlerische Differenzen. Die junge Generation um John Hubley, Phil Eastman, Bill Hurtz, Willis Pyle und David Hilberman wollte mehr Sozialkritik und weg von der Illusion einer dreidimensionalen, mit Hasen, Schweinen und Mäusen bevölkerten Welt. Wie die Maler des New Deal orientierten sie sich am europäischen Modernismus, an Picasso, Dufy und Matisse. Sie wollten mit minimalistischen, zweidimensionalen Hintergründen, stilisierten Charakteren und Abstraktionen experimentieren, was Disney ablehnte. Eastman ging dann zu Warner Brothers, wo er einige seiner Ideen in den von ihm geschriebenen Cartoons um Private Snafu umsetzte; Hubley, Hurtz und Pyle gingen zur Filmeinheit der Armee und schufen dort die sehr innovativen Trigger Joe-Cartoons. Einige von denen, die Disney bestreikt hatten, gründeten die United Productions of America (UPA), deren The Brotherhood of Man ebenso ein Meilenstein in der Geschichte des Trickfilms ist wie Disneys Snow White. Die UPA setzte neue Standards und karikierte lieber Menschen als Tiere. John Hubley ist einer der Schöpfer von Mr. Magoo und Gerald McBoing Boing – zwei völlig undisneyeske Charaktere, die eher auf der dunklen Seite des American Dream unterwegs sind.
Schwarzes Theater und populäre Klassiker
Mittlerweile ist es ein Gemeinplatz, darauf hinzuweisen, dass Barack Obama, der erste schwarze US-Präsident, in Filmen und Fernsehserien vorweggenommen wurde und diese als eine Art Wegbereiter wirkten. Aber bevor Dennis Haysbert in 24 einen Präsidenten spielen konnte, mussten schwarze Darsteller überhaupt erst die Möglichkeit bekommen, ernsthafte Rollen zu spielen. Im Hollywood-Film wurden sie lange Zeit nur als komische Figuren eingesetzt. Das war auch in den 30ern so, mit ganz wenigen Ausnahmen wie Paul Robeson in Show Boat von James Whale (nicht zu verwechseln mit dem Musical der 50er) und King Vidors Hallelujah!. Das Theater des New Deal leistete einen wichtigen Beitrag dazu, dass sich das änderte.
Harry Hopkins, der Chef der WPA, hatte eine Eingebung, als er Hallie Flanagan zur Leiterin des Federal Theatre Project (FTP) machte. Flanagan war Akademikerin und Regisseurin, leitete das experimentelle Theater des Vassar Women’s College und hatte Shifting Scenes geschrieben, eine Darstellung der europäischen Theaterrevolution in den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts. Von ihr stammt auch der beste Einstieg in die Geschichte des Federal Theatre, das 1940 erschienene Buch Arena. Auch wenn die Kunstprojekte eingerichtet wurden, um etwas „gegen das körperliche Hungern“ zu unternehmen, schreibt sie dort, „gab es da nicht noch eine andere Art von Hunger, um den wir uns mit vollem Recht kümmern sollten, dem Hunger von Millionen von Amerikanern nach Musik, Theaterstücken, Bildern und Büchern?“ Unter Flanagans Leitung etablierte das FTP im ganzen Land ein Netzwerk von Theatern ohne die üblichen Zugangshürden, oft an Orten, an denen es noch nie eines gegeben hatte, für Leute, die noch nie im Theater gewesen waren, bei freiem oder sehr geringem Eintritt.
Es gab nichts, was es beim Federal Theatre nicht gab. Das FTP hatte eine eigene Marionettenabteilung, organisierte Zirkus-, Vaudeville- und Varieté-Veranstaltungen, führte Opern und Singspiele auf, gründete ein Blindentheater, gab Dramen über die Geschichte der Syphilis, die Lage der Landarbeiter, den sozialen Wohnungsbau und staatlich betriebene Versorgungsunternehmen in Auftrag. Einige wenige bereits existierende, und immer kurz vor der Pleite stehende schwarze Theatertruppen gingen in der Negro Theatre Unit auf. Die maximal zehn Prozent der Kosten, die nicht für die Bezahlung von Arbeitslosen aufgewendet werden mussten, waren frei verfügbar. Das machte es möglich, auch Leute zu beschäftigen, die Arbeit hatten, zu denselben finanziellen Konditionen (jeder beim Federal Theatre bekam $23,85 die Woche). Flanagan engagierte den Weißen John Houseman als Leiter des Negro Theatre. Das brachte ihr viele Vorwürfe ein, hatte aber wohl weniger mit Bevormundung als damit zu tun, dass sie das schwarze Theater aus seiner Ghettoexistenz herausführen wollte.
Houseman umgab sich mit den besten schwarzen Talenten, die er finden konnte (darunter die Autorin Zora Neale Hurston, später durch Their Eyes Were Watching God bekannt geworden) und holte den jungen Orson Welles. Welles inszenierte die berühmteste aller Produktionen des Negro Theatre, den „Voodoo Macbeth“ (Shakespeares Stück von Schottland in das revolutionäre Haiti verlegt). Die Aufführung war eine Sensation, zog weiße Zuschauer genauso an wie schwarze. Housemans Ziel war es, die Stücke ausschließlich mit schwarzen Darstellern zu besetzen, ohne Bezugnahme auf die Hautfarbe und ohne die bekannten Stereotypen. Das Negro Theatre half dabei, dass schwarze Bühnenkünstler allmählich anders und weniger rassistisch wahrgenommen wurden, auch wenn Canada Lee, der Hauptdarsteller in Macbeth, mit den üblichen Chargenrollen abgefunden wurde, als er nach Hollywood ging.
Als das Federal Theatre Project beendet wurde, gründeten einige von denen, die dort gelernt und praktische Erfahrung gesammelt hatten, neue schwarze Theater. Das erfolgreichste war das American Negro Theatre von Abraham Hill und Frederick O’Neal, die von 1940 bis 1945 neue Stücke schwarzer Autoren aufführten und den Nachwuchs in einer Gesangs- und Schauspielschule ausbildeten. Dort lernten Harry Belafonte und Sidney Poitier ihr Handwerk. Poitier feierte 1946 sein Bühnendebut in einer nur mit Schwarzen besetzten Aufführung von Lysistrata. Später übernahm er Hauptrollen in Hollywood-Produktionen. Poitier war der erste Afroamerikaner, der einen Oscar als bester Hauptdarsteller erhielt. Damit ebnete er den Weg für andere schwarze Schauspieler. Als Halle Berry den ersten Oscar für eine schwarze Hauptdarstellerin in Empfang nahm, war das auch ein später Triumph des Federal Theatre.
Houseman und Welles übernahmen nach ihrem Voodoo Macbeth die „Klassiker-Abteilung“ des FTP. Mit seiner Inszenierung von Christopher Marlowes Doctor Faustus setzte Welles seine Versuche der Popularisierung des Elisabethanischen Theaters fort, die mit seinem Everybody’s Shakespeare begonnen hatten: Gekürzte, so bearbeitete Fassungen einiger Shakespeare-Stücke, dass sie in Schulen aufgeführt werden können, mit Regievorschlägen und von Welles’ angefertigten Zeichnungen, die ebenso als Anregungen für die Inszenierung dienen können wie als Illustrationen, als Comics, die dabei helfen sollen, die vor der Hochkultur aufgebauten Hürden zu überwinden. Nach knapp fünf Jahren, als das Federal Theatre Project eingestellt wurde, konnte Hallie Flanagan stolz berichten, dass ihre Leute vor 25 Millionen Menschen gespielt hatten, einem Fünftel der Gesamtbevölkerung. Die WPA brachte das Theater einem Publikum nahe, das so vielschichtig und so groß war wie nie zuvor. In ähnlicher Weise galt das auch für die anderen Kunstprojekte.
Antikapitalismus auf Staatskosten
Die letzte FTP-Aufführung des Duos Welles/Houseman war The Cradle Will Rock des Komponisten Marc Blitzstein, das als „Agitprop-Oper“ nur unzureichend beschrieben wäre (es geht um das Organisieren einer Gewerkschaft in einer Stahlarbeiterstadt), weil es Opernarien mit Balladen, Polkas, Stepptanznummern und Chorälen mischt und im Grunde seine Wurzeln im avantgardistischen Musiktheater von Bert Brecht und Kurt Weill hat, mit Einflüssen von Hanns Eisler und Johann Sebastian Bach. The Cradle Will Rock hat genauso ein eigenes Kapitel in der amerikanischen Theatergeschichte verdient wie der Voodoo Macbeth. Weil als zu kontrovers eingestuft, wurde die Uraufführung untersagt. Welles und Houseman wollten sich nicht beugen. Als sie das Theater verschlossen fanden, unterhielten die Schauspieler Will Geer und Howard da Silva das Publikum (beide landeten später auf Hollywoods Schwarzer Liste), während Welles und Houseman ein anderes Theater und ein Klavier mieteten. Dann zog man gemeinsam zum 21 Straßen entfernten Venice Theatre. Dort wurde das Stück ohne Kostüme, Bühnenbild und Orchester aufgeführt, mit Blitzstein am Klavier. Um nicht gegen Gewerkschaftsregeln zu verstoßen, sprachen und sangen die Schauspieler ihre Texte vom Zuschauerraum aus. The Cradle Will Rock war eines der großen Broadway-Ereignisse der 1930er.
Weil sich das Federal Theatre von kommerziellen Bühnen unterscheiden und nicht mit diesen konkurrieren sollte, hatte es die Lizenz zur Innovation. Experimente waren nicht nur erlaubt, sondern erbeten. Davon profitierte dann das kommerzielle Theater, dem das FTP neue Techniken und ästhetische Möglichkeiten, ein hervorragend geschultes Personal und ein Publikum hinterließ, das bereit war, sich auf Experimente und Avantgardistisches einzulassen. Auch Hollywood verdankt der WPA und den daraus hervorgegangenen Künstlergruppen (Welles’ Mercury Theatre) einen Entwicklungsschub. Orson Welles wurde ebenso Filmregisseur wie Joseph Losey und Nicholas Ray, die einige der Living Newspapers der FTP inszenierten. Living Newspapers waren auf der Bühne aufgeführte Themenabende, die einen dokumentarischen Charakter hatten, weil sie von arbeitslosen Journalisten zuvor möglichst genau recherchiert worden waren, aber genauso mit den Möglichkeiten des Theaters als Illusionsmaschine experimentierten wie Orson Welles. Es gab innovative, vom Film beeinflusste Beleuchtungstechniken, das Aufbrechen der alten Guckkastenbühne, dramatische Szenen, vorab im Stil der Wochenschau gefilmte Projektionen und meistens viel Musik, weil das Federal Theatre auch möglichst viele Musiker unterbringen wollte.
Die Living Newspapers sorgten für ähnliche Kontroversen wie The Cradle Will Rock. Besonderen Ärger bekam Hallie Flanagan mit den von Losey inszenierten Produktionen Triple-A Plowed Under (die Geschichte der amerikanischen Landwirtschaftspolitik vom Bürgerkrieg bis zur Gegenwart in 20 Tableaus) und Injunction Granted (die von 38 Journalisten recherchierte und 15 Autoren geschriebene Geschichte der Gewerkschaftsbewegung in Form von arbeitnehmerfeindlichen Gerichtsbeschlüssen). Das Federal Theatre geriet zunehmend unter Beschuss von rechts. Der Anfang vom Ende kam absurderweise durch die von 1937 bis 1939 durchgeführten Anhörungen des La Follette-Ausschusses.
Unamerikanische Aktivitäten
Dieser Senatsausschuss fand heraus, dass die amerikanischen Industrieunternehmen die Gewerkschaften im großen Stil von privaten Detekteien wie Pinkerton ausspionieren und infiltrieren ließen, um deren Aktionen besser sabotieren zu können. Im Gegenzug begann der von Martin Dies geleitete Ausschuss zur Untersuchung unamerikanischer Aktivitäten 1938 damit, die angebliche kommunistische Unterwanderung großer Teile der amerikanischen Gesellschaft unter die Lupe zu nehmen. Dieser Ausschuss war ein Kampfmittel der Republikaner gegen den New Deal. Auch Hallie Flanagan musste vor Dies und seinen Kollegen aussagen. Berühmt wurde die Frage eines Kongressabgeordneten, ob der von Flanagan erwähnte Christopher Marlowe ein Kommunist sei. Das war lustig, aber das Federal Theatre Project wurde trotzdem eingestellt. Die anderen von Washington aus organisierten Kulturprogramme wurden nach und nach an die einzelnen Bundesstaaten übertragen. Im Frühjahr 1942 wurden alle kulturellen Aktivitäten der Regierung, die nicht direkt in Bezug zum Krieg standen, beendet.
Die amerikanische Kultur der 30er Jahre wird oft auf die Frage der McCarthyisten reduziert: Sind oder waren Sie Mitglied der Kommunistischen Partei. Darüber kann man leicht vergessen, dass die USA in den 30ern, in der bis dahin größten Wirtschaftskrise, eine kulturelle Blütezeit erlebten, von der sie noch lange zehrten. Die Kunstprogramme des New Deal hatten daran einen großen Anteil. Nach acht tristen Bush-Jahren scheint ein Neuanfang dringend geboten. Damit er gelingen kann, ist Aufbruchstimmung und ein Aufpolieren des ramponierten Rufs der USA in der Welt erforderlich. Obama sollte nicht nur die Bibel und seinen Lincoln-Schmöker mit ins Weiße Haus nehmen. Ich empfehle The Cultural Front von Michael Denning, das beste Buch über den New Deal und die US-Kultur der 30er. Zur Aufmunterung hier noch ein Zitat von Alan Lomax, der in den 30ern für die „Special Skills Division“ des Landwirtschaftsministeriums gearbeitet hat:
„Der New Deal war die Zeit, als die Amerikanische Revolution noch einmal von vorn anfing. Es ging nicht nur darum, irgendwie mit der Wirtschaftskrise fertig zu werden, es ging darum, mit all den Problemen fertig zu werden, die wir in den hundert Jahren zwischen der Zeit der Amerikanischen Revolution und damals angehäuft hatten, durch Eigennutz und Gier und Ausbeutung, durch das Umbringen der Indianer und die Versklavung der Schwarzen und die Ausgrenzung der armen Weißen. Wir kannten die Probleme, und wir hatten eine gute Ausbildung: Ich war ein Anthropologe, Nick Ray war ein bemerkenswerter Intellektueller aus der Frank Lloyd Wright-Schule, und es gab Zehntausende von uns in der Stadt, die alle mit dem Problem zu tun hatten und dann das Startsignal bekamen: Tut etwas. Es wurde möglich durch den enormen Vorwärtsschub des New Deal. Wir hatten die Aufmerksamkeit des Mannes von der Straße. Alle Intellektuellen waren mit einbezogen; jeder war mit dabei. Die Roosevelts waren grandiose Orchestrierer. Wir schufen Gewerkschaften für die Arbeitnehmer und die Grundlagen für die Gleichberechtigung und die Aufhebung der Rassentrennung. Es war eine Zeit des Hochgefühls, es konnte einem ganz schwindelig dabei werden. Bei Gott! Wir Amerikaner waren ganz schön großartig.“
