Haben wir den sechsten Sinn?
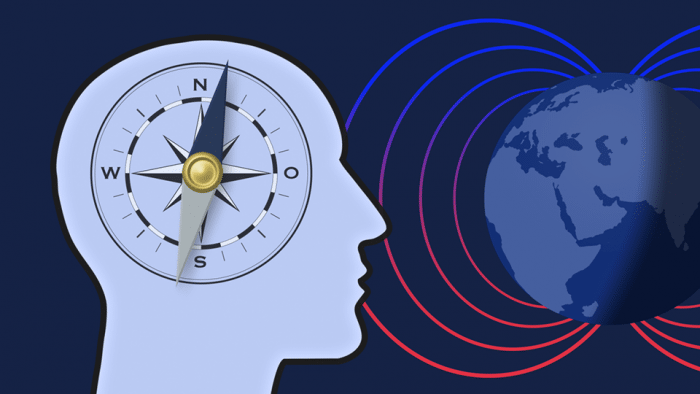
Viele Tiere können das Magnetfeld der Erde wahrnehmen. Ob Menschen dazugehören, bleibt unsicher
Von den Tzeltal, einem Mayavolk, das im mexikanischen Bundesstaat Chiapas lebt, erzählt der Ethnologe Stephen Levinson folgende Anekdote: Er fuhr mit einem Tzeltalehepaar im Auto in eine Gegend, die diese nicht kannten. Sie hatten überhaupt noch nie ihre Heimat verlassen. Die Fahrt war lang und kurvenreich, und sie kamen lange nach Einbruch der Dunkelheit und bei bedecktem Himmel im Hotel an. Dort ging die Frau ins Bad, kam wieder heraus und sagte ihrem Mann: "Das warme Wasser kommt aus dem westlichen Wasserhahn."
Levinson ist am MPI für Psycholinguistik in Nimwegen. Und so interessiert ihn an der Art, wie die Tzeltal - und etliche weitere äquatornah lebende Ethnien - die Lage von Objekten angeben, der kognitionswissenschaftliche Aspekt: Die Links-rechts-Unterscheidung, die europäische Denker seit den alten Griechen und bis hin zu Kant und von Uexküll für universal hielten, ist es nicht. Sie ist egozentrisch, d.h., sie bezieht die ganze Welt auf den Sprecher. Wenn ich mich drehe, ändert sich die Lage der ganzen Welt. Und man fragt sich unwillkürlich, wie viel Absicht in den politischen Implikationen des Titels steckt, den der Heidelberger Völkerkundler Jürg Wassmann einem Text über seine Forschung gab: "Was für die einen links ist, ist für die anderen rechts . . ."
Rund 30% der Ethnien auf dem Planeten hingegen orientieren sich geozentrisch wie die Tzeltal. Für sie steht die Schule stets westlich vom Marktplatz, egal, aus welcher Richtung sie kommen (ob sie auch politisch eindeutiger orientiert sind, ist nicht bekannt). Und dies ist nicht nur eine aus unserer Sicht umständliche (tatsächlich aber für Kinder leichter zu erlernende) Art des Sprechens.
Psycholinguisten fasziniert und Kantianer provoziert, dass die geozentrisch sprechenden Völker die Welt auch anders wahrnehmen. Legt man uns Abendländern einen Pfeil vor, der nach rechts zeigt, dreht uns dann um 180° und bittet uns, von zwei entgegengesetzt zeigenden Pfeilen den zu wählen, der so zeigt wie der erste, dann nehmen wir den, der nach rechts zeigt - geozentrisch betrachtet, in die genau entgegengesetzte Richtung. Tzeltal und andere geozentrisch orientierte Ethnien zeigen auf den linksgerichteten Pfeil.
Wie die Sprache, in der wir aufwachsen, unsere Wahrnehmung der Welt beeinflusst, ist äußerst faszinierend. Die Wirkungen sind weitreichend: Geozentrisch orientierte Menschen haben einen bei weitem besseren Orientierungssinn. Zugleich ist ihr Weltbild sozusagen buchstäblich selbstlos: Da sie selbst für die Verortung der Gegenstände keine Rolle spielen, zeigen sie beispielsweise auf sich, wenn sie sagen: In der Nähe. Man fragt sich unwillkürlich, wie weit diese andere Weltsicht in die ethischen Vorstellungen hineinreicht.
Was sich aber die Psycholinguisten erstaunlicherweise nie gefragt zu haben scheinen, ist die Frage, die sich dem Naturwissenschaftler als allererste stellt:
Wie machen die Tzeltal das?
Rechnen sie "einfach nur" ständig innerlich mit? Addieren jede Wendung mit und gegen den Uhrzeigersinn laufend auf und eichen das Ergebnis regelmäßig am Sonnenstand? Möglich, aber: bei einer stundenlangen, kurvigen Autofahrt im Dunkeln? Ist die Annahme, solche Berechnungen könnten auf Winkelgrade genau laufend unbewusst angestellt werden, wirklich die sparsamste? Oder können die Tzeltal (und viele andere, hier ungenannte, geozentrisch orientierte Ethnien) die Himmelsrichtungen wahrnehmen?
Die Fähigkeit, das Magnetfeld der Erde zu spüren und für die eigene Orientierung zu nutzen, ist im Tierreich weit verbreitet. Am längsten bekannt und am besten untersucht ist sie bei Zugvögeln. Aber auch viele andere wandernde Arten anderer Tierklassen orientieren sich am Erdmagnetfeld, von Salamandern über Lachse bis hin zu Meeresschildkröten, und auch Lebewesen, von denen man es nicht erwartet hätte. Im Fadenwurm C. elegans wurden zwei magnetsensitive Neuronen identifiziert, und sogar bestimmte Bakterien in Meeressedimenten bewegen sich entlang der Feldlinien.
Auch bei uns näher verwandten Säugetieren haben sich Hinweise auf Magnetperzeption gefunden: Verschiedene Nagetiere richten ihre unterirdischen Gänge anscheinend nach den Himmelsrichtungen aus, verschiedene Mäuse ebenso wie Delphine untersuchen einen Stabmagneten länger als einen demagnetisierten Kontrollstab.
Hynek Burda fand mit originellen und etwas skurrilen Studien noch zwei weitere Kandidaten: Seine Mitarbeiter maßen auf Bilder von Google Earth nach, wie Kühe (und auch Hirsche) auf Weiden standen oder lagen: bevorzugt Nord-Süd, mit dem Kopf nach Norden. Allerdings nicht unter Hochspannungsleitungen. Und Hunde berücksichtigen das Erdmagnetfeld angeblich beim Häufchenmachen - wobei die arg datenmelkende Statistik dieser Studie u.a. in Laborjournal und Lab Times restlos zerpflückt wurde.
Dass völlig verschiedene Tiere das Erdmagnetfeld wahrnehmen können, ist also sicher. Umso drängender stellt sich die Frage: Wie?
Schnabel oder Auge? Oder beides?
Bei den Bakterien sind es winzige Magnetitkristalle, die sie tiefer ins Sediment leiten. Da dies schon 1975 entdeckt wurde, war die Annahme naheliegend, dass Tiere es genauso machen würden. Magnetisches Eisen nutzen wir Menschen schließlich auch seit tausend Jahren zur Navigation: im Kompass. Wohl deshalb suchten Forscher nach Magnetit in Tierkörpern - und wurden fündig.
In Schnäbeln von Brieftauben entdeckten sie Gruppen von magnetithaltigen Zellen, die sie für Nervenzellen hielten, später auch in zahlreichen weiteren Geweben quer durchs Tierreich: im Hinterleib von Insekten, im Kopf und Seitenlinienorgan von Fischen, im Ohr von Vögeln, sogar im Hirn von Menschen.
Gerade diese Inflation von Funden ist ein Problem. Wie soll das alles zusammenhängen? Wie in ein Gesamtkonzept zu bringen sein? Welche Magnetitansammlung ist denn nun die richtige, und was ist nur zellulärer Eisenschrott?
Nur das scheinen nämlich die Magnetitkristalle im Vogelschnabel zu sein, an die sich so viele Hoffnungen hängten. Nach einigen Jahren schauten einige Histologen noch einmal genauer hin, schnitten nicht nur ein paar Taubenschnäbel, sondern gleich 200, kartierten alle magnetithaltigen Zellen und mikroskopierten sie und kamen zum Schluss: Es sind Immunzellen. Sie sind von Tier zu Tier unterschiedlich verteilt und haben mit dem Nervensystem nichts zu tun.
Andere Wissenschaftler, die sich v.a. um den Oldenburger Neurosensoriker Henrik Mouritsen und das Ehepaar Wiltschko in Frankfurt scharen, verfolgten derweil eine andere Spur. Die Wiltschkos hatten schon 1993 beobachtet, dass australische Graumantel-Brillenvögel kurzwelliges, also blaues bis ultraviolettes, Licht benötigen, um sich magnetisch zu orientieren. Dieser Befund verwies auf die Augen als Magnetsinnesorgan. In den Photorezeptoren findet sich das Protein Chryptochrom, welches im Licht ein Radikalpaar ausbildet, also zwei ungepaarte Elektronen, die mit gleichem oder unterschiedlichem Spin rotieren können. Diese Tendenz zu parallelem oder antiparallelem Spin kann vom Magnetfeld verändert werden und beeinflusst dann wiederum die chemischen Eigenschaften des Chryptochroms, die schließlich vom Nervensystem ausgelesen werden könnten.
Mittlerweile ist bekannt, dass eine Variante des Chryptochroms tatsächlich exklusiv in den UV-empfindlichen Zapfen von Vögeln vorkommt. Zahlreiche Versuche mit unterschiedlichen Lichtbedingungen oder betäubten Schnäbeln haben gesichert, dass Vögel das Erdmagnetfeld - genauer: seine Inklination, also Richtung zur Schwerkraft - tatsächlich sehen. Und man hat sogar berechnet, wie das Gesichtsfeld für einen Vogel aussieht: Mit ringförmigen Aufhellungen und Verdunkelungen, die sich um den ganzen Horizont spannen.
Ist der Schnabel damit endgültig raus? Möglicherweise nicht. Die Inklination des Erdmagnetfeldes kann ja nur eine Richtung angeben, möglicherweise auch eine geographische Breite - aber sie kann keine Karte liefern. Vögel und andere Tiere nutzen die Magnetfeldinformation aber anscheinend auch dazu zu wissen, wo sie sind, können also vermutlich lokale Schwankungen und Anomalien des Magnetfelds wahrnehmen. Dazu wäre ein magnetitbasierter Sinn gut geeignet.
Tatsächlich können Vögel, denen man den Nervenast, der vom Schnabel kommt, durchtrennt hat, zwar noch die Himmelsrichtung finden, merken es aber nicht, wenn man sie woanders starten lässt. Umgekehrt können sich Rotkehlchen nach einer Weile im roten Licht wieder orientieren - wenn auch weniger gut -, so lange, bis man ihren Schnabel betäubt.
Vermutlich wird also, wie so oft in der Biologie, aus einem "Entweder-Oder" ein "Beides!": Die Augen für die Kompassrichtung, der Schnabel für die Karte. Auf der Suche nach dem Magnetsinn hätte man zwei davon gefunden.
Der Magnetsinn im EEG
Oder jedenfalls: Fast. Letztgültig bewiesen ist immer noch nichts. Der Magnetsinn ist schwer zu fassen. Wir haben Augen zum Sehen, Ohren (oder, wenn wir Grillen sind, Vorderbeine) zum Hören, eine Nase (oder Antennen) zum Riechen. Fische haben ein Seitenlinienorgan, um Wasserwirbel zu spüren, Haie lorenzinische Ampullen in der Schnauze, um elektrische Felder wahrzunehmen. Immer lässt sich eine Sinnesmodalität klar einem Organ zuordnen. Aber das Organ des Magnetsinns scheint es nicht zu geben.
Das ist der eine Grund für die Schwierigkeit, diese rätselhafte Sinneswahrnehmung zu verstehen. Der andere liegt darin, dass wir selbst es anscheinend nicht können. Wüssten wir, wann und wie man "Norden" spürt, dann könnten wir die neuronalen Grundlagen im Handumdrehen finden.
Aber vielleicht können wir es ja? Niemand scheint jemals die Tzeltal gefragt zu haben, wie sie es machen. Aber schon in klassischen Studien zeigten nordamerikanische Versuchspersonen angeblich übersignifikant häufiger in den richtigen Quadranten, wenn man sie in einer unbekannten Umgebung fragte, wo Norden sei. Seit einigen Jahren nun haben auch Physiologen die Suche nach der menschlichen Magnetwahrnehmung intensiviert.
Schon 2016 vermeldete der amerikanische Allroundwissenschaftler Joseph Kirschvink (berühmt geworden als Entdecker und Benenner des "Schneeball"-Stadiums der Erde) auf einer Tagung Erfolg: Er hatte von Versuchspersonen das EEG genommen, während er mit großen Spulen das Magnetfeld um sie kreisen ließ. Rotation gegen, aber nicht mit dem Uhrzeigersinn verursachte eine signifikante Antwort in den Hirnwellen. Fast drei Jahre später, vor wenigen Wochen, erschien nun die Publikation dazu.
Darin wird der Befund bestätigt und erweitert. Die Antwort tritt nur auf, wenn die Inklination des künstlichen Magnetfelds nach Norden absinkt, wie das Erdmagnetfeld auf der Nordhalbkugel. Das könnte darauf hinweisen, dass die Umgebung eine Rolle spielt, in der die Probanden aufwachsen. Kirschvink möchte als nächstes Bewohner der Südhalbkugel testen; bei ihnen müsste es umgekehrt sein.
Da die Antwort auf Änderungen der Inklination erheblich schwächer war als auf Drehungen der Deklination, ist Kirschvink der Ansicht, einen Chryptochrom-Radikalpaar-Mechanismus ausschließen und einen Magnetit-Mechanismus wahrscheinlich machen zu können. Allerdings saßen seine Versuchspersonen im Finstern mit geschlossenen Augen. Und seine Interpretationen des Gegenuhrzeigersinn-Effektes sind wenig überzeugend. Und schließlich - auch wenn das ein Ad-hominem-Argument ist - hat Kirschvink seit fast vier Jahrzehnten an Magnetit in Bakterien und Gesteinen geforscht und ist daher vielleicht ein klein wenig voreingenommen.
Ein hungriger Kompass
Zu allem Überfluss erschien fast zeitgleich eine Studie, die genau zum gegenteiligen Ergebnis kommt: Die Grundidee war, dass Orientierung ihre Hauptrolle in der Nahrungssuche habe. Also wurden Versuchspersonen, die seit dem Vorabend nichts gegessen hatten, am Nachmittag darauf konditioniert, den durch Spulen modulierten magnetischen Norden mit einem Schokoladenchip zu assoziieren. Nach zehn Konditionierungsdurchläufen sollten sie dann, auf einem Drehstuhl sitzend, sich nach Norden drehen. Das funktionierte bei hungrigen Männern, aber nicht bei satten, und überhaupt nicht bei Frauen. Und es setzte blaues Licht voraus.
Die Streuungen in den Daten sind so groß, dass man die negativen Befunde nicht überbewerten sollte. Insbesondere das schlechte Abschneiden der Frauen - zu dem die Autoren selbstverständlich die übliche Jäger-Sammler-Steinzeit-Geschichte erzählen - widerspricht Levinsons Beobachtungen bei den Tzeltal. Die Mayafrauen orientieren sich ebenso gut wie die Mayamänner.
So kann keine der beiden Studien wirklich überzeugen. Das Rätsel der menschlichen Magnetwahrnehmung bleibt ungelöst. Vielleicht sind wir Bewohner der Industrienationen auch einfach nicht in der Situation, es zu lösen. Denn elektromagnetische Felder, von denen wir umgeben sind, stören die Magnetorientierung nicht nur von Kühen und Hirschen, sondern auch von Vögeln und anderen Tieren. Vielleicht sollte man die Labore nach Chiapas verlagern. Südwärts. Zu den Tzeltal.
