Landlust und Landflucht
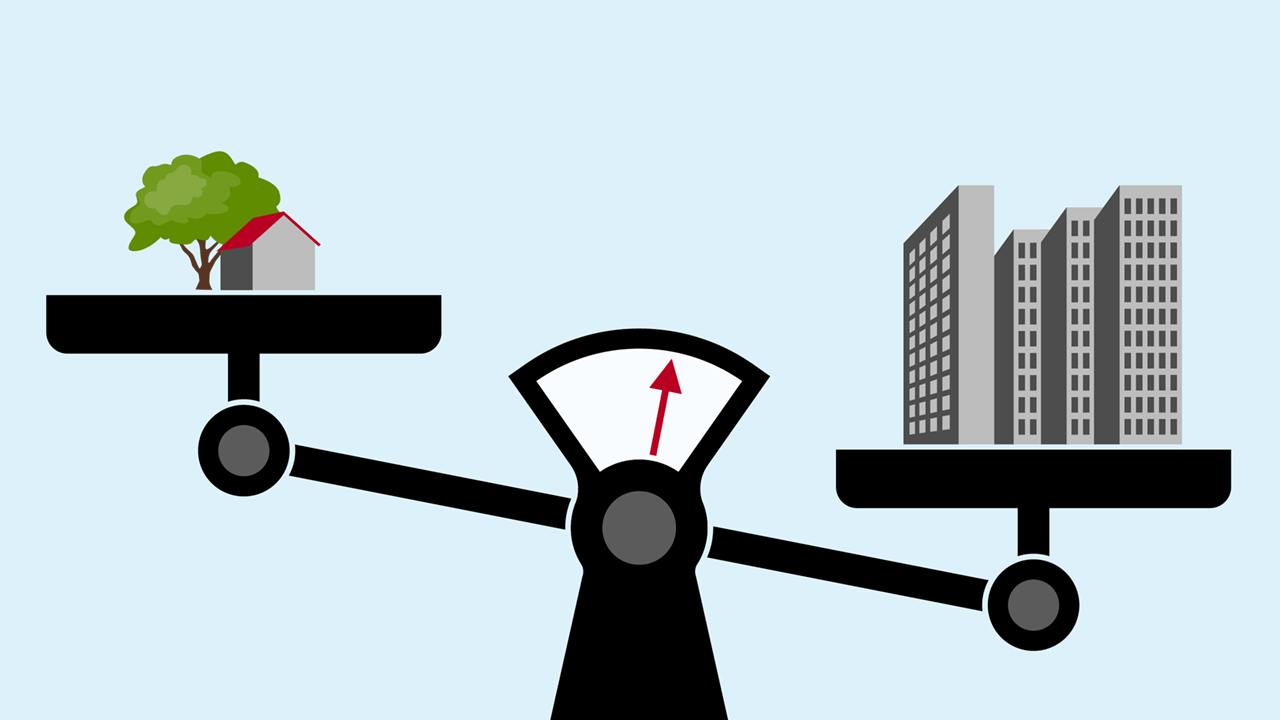
Gleichwertige Lebensverhältnisse - nur ein Mythos deutscher Politik?
Ein Bonmot von Henri Bonaventure Monnier besagt: "Man sollte die Städte auf dem Lande bauen, da ist die Luft besser." Tatsächlich ist ja in jüngerer Zeit viel von "Landlust" die Rede, wobei insinuiert wird, als sei vom "Raum da draußen" eigentlich nur Gutes zu erwarten: Naturgenuss, Erholung, Freizeitofferten; kurz, ein irgendwie anderes, besseres Leben.
Das ist, gelinde gesagt, erstaunlich. Zumal ja ganze Landstriche sich entvölkern, "die Wölfe von der Mark Brandenburg Besitz ergreifen", perforierte und stückweise brachfallende Städte und Dörfer in Ostelbien zu einer Alltagserfahrung werden. Doch der fatale Cocktail aus demographischem Wandel und Deökonomisierung wirkt ja nicht nur in der Uckermark, in Vorpommern und in der Lausitz, sondern auch in westlichen Regionen, etwa im Ruhrgebiet, in Oberfranken oder im Saarland. Jüngst wurde in einer Studie die Umzüge innerhalb Deutschlands aufwendig untersucht. Demnach verschärft sich die demografische Ungleichheit erheblich. Das wird bereits am Wanderungssaldo aller erwachsenen Deutschen gleich welchen Alters deutlich: Unter dem Strich zogen in den sieben betrachteten Jahren 250.000 Deutsche mehr in die Städte, als von dort fortzogen. Entsprechend hoch war der Verlust für den ländlichen Raum.
Mag in den großen Städten auch die Wohnungsfrage virulent sein, so offenbart sich das gesellschaftliche Problem eher auf dem Land. "Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit", besagt Art. 2 des Grundgesetzes. Das aber setzt Chancengleichheit, diese wiederum gleichwertige Lebensbedingungen in allen Teilräumen des Bundesgebietes voraus. Diese Gerechtigkeitsnorm verpflichtet Bund und Länder, regionale Disparitäten in den Lebensbedingungen abzubauen, zumindest aber sie nicht zu verstärken.
Räumliche und strukturelle Ungleichgewichte zwischen den bis zur Herstellung der Einheit Deutschlands getrennten Gebieten auszugleichen, ist folgerichtig ein Leitgedanke deutscher Politik und als solcher Konsens über alle parteipolitischen Grenzen hinweg. Der gleichen Logik folgt im Übrigen auch die Förderpolitik der Europäischen Union, die beispielsweise in ihrer prioritären Kategorie, den sog. "Ziel I Gebieten", diejenigen Regionen besonders unterstützt, die weniger als 75 % des in der EU durchschnittlichen Einkommens aufweisen.
Indes, im Kanon von Stichworten wie Deregulierung, Überalterung, Entschleunigung, Verkleinerung und Abwanderung kann sich das Ziel von der Gleichheit nicht mehr unangefochten behaupten. Daran hat seinerzeit sogar Bundespräsident Köhler erhebliche Zweifel angemeldet: "Es gibt nun einmal überall in der Bundesrepublik große Unterschiede in den Lebensverhältnissen. Das geht von Nord nach Süd wie von West nach Ost. Wer sie einebnen will, zementiert den Subventionsstaat und legt der jungen Generation eine untragbare Schuldenlast auf."
Die Normen und Werte des "Wirtschaftswunderlandes", die institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen seiner territorialen Politik entstanden unter den Bedingungen des Wachstums - von Bevölkerung, Wirtschaftsleistung, Bauflächen und öffentlichen Budgets - und sind durch sie geprägt. Entsprechend baut die Politik auf die Verteilung eines Surplus. Das aber so nicht mehr vorhanden ist: Im Zuge des europäischen Integrationsprozesses und der Globalisierung der Waren- und Faktormärkte nimmt der wirtschaftliche Standortwettbewerb zwischen Regionen massiv zu; Städte und Gemeinde konkurrieren immer verzweifelter um die Neuansiedlung von Unternehmen und Privathaushalten.
Trend zur Dienstleistungsgesellschaft und die Globalisierung unterlaufen das Steuersystem
Nun führt jedoch die Ansiedlung an einem Standort zwangsläufig zu Wegzug, Leerstand und Brachfallen an einem anderen. Wenn sich neue Kraftzentren und Innovationskerne herausbilden, dann entstehen zugleich und unweigerlich neue Hinterhöfe und zusätzliche Verlierer.
Der Befund dürfte hinreichend deutlich sein: Das deutsche Steuersystem setzt einen starken, national verankerten und damit Abgaben zahlenden industriellen Sektor sowie Vollbeschäftigung voraus. Der Trend zur Dienstleistungsgesellschaft und die Globalisierung unterlaufen dieses System. Die Industrielandschaft bricht nach und nach weg. Die verbleibenden Unternehmen sind weltweit organisiert und zahlen ihre Steuern dort, wo es für sie am günstigsten ist.
Gleichzeitig sind den Kommunen durch auf Bundes- und Landesebene beschlossene Leistungsgesetze zusätzliche Ausgabenverpflichtungen auferlegt worden, ohne dass ihnen hierfür ausreichend zusätzliche Mittel bereitgestellt wurden. Außerdem steigen durch die dauerhafte Massenarbeitslosigkeit die Ausgaben im Sozialbereich. Und die unübersehbare Vielfalt komplexer Förderprogramme und wachsende Regelungsdichte von lokaler bis europäischer Ebene sind de facto eher Belastung denn Bereicherung.
Die notwendigen Anpassungen sind ohne Konflikte nicht zu haben. Richtig ausgetragen werden sie - Stichwort Pendlerpauschale - gleichwohl nicht. Weitere Rennpisten im märkischen Sand, Gewerbegebiete, auf denen sich doch nie ein Gewerbe gründet, oder Cargolifter und andere investive Heilsversprechen: Das braucht man absehbar eher nicht. Und aller Subsidiarität zum Trotz werden die globalen Maßstäbe immer dominanter als Koordinaten für das lokale Handeln, entsprechend die kommunalen und individuellen Spielräume immer kleiner. Für diesen Antagonismus ist noch keine Antwort in Sicht.
Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit
Ebenso wenig für einen zweiten Widerspruch, der bislang im weithin Ungesagtem schlummert. Denn bei Lichte betrachtet steht das Ziel, einen Ausgleich zwischen Regionen herbei zu führen, in Konkurrenz zu Überlegungen, welche Orte aus nationaler bzw. großräumiger Sicht die Träger der zukünftigen Entwicklung sein werden, also zu Wachstumsüberlegungen. Dies muss kurz erläutert werden.
Als theoretisches Fundament für die "Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse" fungiert die Konvergenztheorie. Sie lässt sich ganz gut mit einem Bild veranschaulichen: Die Ballungsgebiete stellt man sich dann als unter verschiedenen Aspekten überquellend vor. Die Löhne sind vergleichsweise hoch, d. h. der Faktor Arbeit wird knapper, und nicht zuletzt sind die knappen Bodenflächen ein Grund, dass die wirtschaftliche Aktivität nach außen drängt. Dieser Vorgang wird durch andere als die genannten "Ballungsnachteile" noch verstärkt, beispielsweise durch die in aller Regel höhere Umweltbelastung, höhere Kriminalitätsraten als im ländlichen Gebiet etc. Umgekehrt gilt in den ländlich-peripheren Gebieten, dass dort die Faktoren Kapital und Boden reichlich und preiswert vorhanden, und die Belastungen durch Umweltprobleme und Kriminalität geringer sind.
Dieser Theorie zufolge ist eine Tendenz zum Ausgleich gleichsam immanent, weil die langfristigen Wachstumschancen außerhalb der Ballungsgebiete größer seien als innerhalb. Mithin ist unter gesamtwirtschaftlichem Aspekt ein Euro, der außerhalb der Agglomerationen - ob nun privat oder öffentlich - investiert wird, mit einem größeren Effekt auf das nationale Wachstum versehen. Woraus die Politik die Folgerung zog: Eine regionale Ausgleichspolitik, wie sie etwa im Wege der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" oder mittels des Länder- und des Kommunalfinanzausgleichs betrieben wird, sei zugleich "wachstumsfördernd" in der Breite.
Doch diese Theorie ist brüchig geworden: Die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit wird zum generellen Kennzeichen, auch in anderen Hocheinkommensstaaten. Viele Regionen wachsen, andere schrumpfen wirtschaftlich oder fallen doch gegenüber den schneller wachsenden Regionen zurück. Jede Auswahl aber, zu der die knappen Mittel zwingen, bedeutet, dass eine andere Region oder ein anderer Sektor nicht (mehr) gefördert wird.
Extremfall: Mindestversorgung für die Bevölkerung
Die Forderung nach gleichwertigen Lebensverhältnissen läuft heute also ins Leere, wenn sie nicht - sehr konkret - die Frage der "Balance" zwischen regionalem Ausgleich und Wachstum beantwortet. Sie stellt sich als die regionale Version der Wohlfahrtsstaats-Problematik dar: Man muss das Sozialprodukt erst erwirtschaften, ehe man es verteilen kann.
Die meisten Ökonomen erachten es ohnehin als generell falsche Hypothese, Deutschland sei ein homogenes Gebilde, ein einheitlicher Standort, in dem Löhne, Abgaben und Lebensqualität möglichst gleich sein müssen. Dass beispielsweise München einen im Vergleich zu Frankfurt/Oder weitaus attraktiveren Standort darstellt, fußt auf vielfältigsten - eben auch natürlichen - Faktoren und ist wirtschafts- und strukturpolitisch erst einmal nicht zu ändern. Was so viel bedeutet, dass sich bestimmte Gegenden mit den Gegebenheiten abfinden und arrangieren, dass sie sich auf eigene Kräfte und endogene Potentiale - beispielsweise Tourismus - stützen müssen. Sofern auch diese Entwicklungschance fehlt, kann es im Extremfall darum gehen, nur eine Mindestversorgung für die Bevölkerung zu sichern. Dazu könnte womöglich auf Erfahrungen mit dünn besiedelten, peripheren Regionen in anderen Staaten, beispielsweise in den skandinavischen Ländern, zurückgegriffen werden.
Die herkömmlichen strukturerhaltenden Maßnahmen über Subventionen sind längst an die Grenzen der Finanzierbarkeit gestoßen. Regionale und sektorale Disparitäten verstärken sich partiell, jedoch keineswegs nur im Osten. Gerade weil diese sich immer weniger entlang der ehemaligen Grenze zwischen neuen und alten Bundesländern entwickeln, ist die Erhaltung eines einheitlich geltenden Regelwerkes, das eine regionale bzw. lokale Strukturpolitik nach Kassenlage oder nach Gutdünken vermeidet, geboten. Gleichwohl sind alle Politikbereiche gefordert, ihre Grundsätze und Leitvorstellungen unter diesen gewandelten Rahmenbedingungen zu überprüfen.
Die "Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse" ist deswegen nicht obsolet; und sie ist als Postulat schon aufgrund der in der Bevölkerung verankerten starken Verteilungsorientierung ernst zu nehmen. Gleichwohl leidet es seit langem an Überstrapazierung und Übertreibung, die künftig keinesfalls mehr die Basis werden bilden können. An dieser Stelle sei nur der an 100% (und manches Mal darüber) reichende Ausgleichsgrad im Länderfinanzausgleich und im Kommunalfinanzausgleich mancher Bundesländer genannt.
Nun wäre es schon ein beachtenswerter Erfolg, das Verhältnis zwischen Impuls- und Nivellierungsziel neu zu justieren, den unübersichtlichen Dschungel von Instrumenten und Programmen zu roden und Abschied vom "Gießkannen-Prinzip" zu nehmen - ohne sich von allen äquilibristischen Idealen zu verabschieden. Wenn die Konzentration auf die Stimulierung des Wachstums unter den gegenwärtigen Bedingungen wohl Vorrang haben dürfte, so müssen einzelne Aspekte des Verteilungsziels, die unabdingbar sind - Stichwort "Mindestausgleich" -, doch erhalten bleiben. Diese Gratwanderung zu bewältigen ist eine Kernforderung an die kommende Politik.
Der eherne Grundsatz, vergleichbare Lebenschancen für alle Bewohner anzustreben, mag zwar sichtbar Staub angesetzt haben; ausgedient aber hat er mitnichten.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
