Mietpreis-Explosion und Wohnungsnotstand - Ursachen und Alternativen
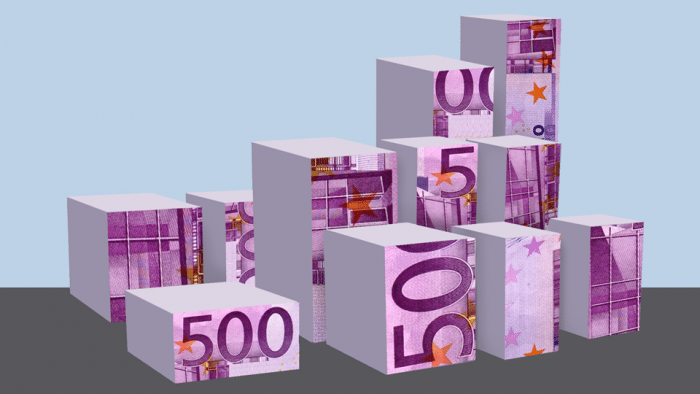
Auszug aus dem isw-report 116/117: "Schlussfolgerungen und Alternativen"
Appelle an die Sozialpflichtigkeit des Wohnungseigentums sind nutzlos! Privater Wohnungsbau und Wohnungsvermietung verfolgen kein soziales Ziel. Der Zweck von Investitionen in den Wohnungssektor ist die Rendite. Ein anderes Interesse gibt es nicht. Eine soziale Wohnversorgung muss daher immer gegen private Gewinninteressen durchgesetzt werden.
Der kapitalistische Wohnungsmarkt zielt auf die Versorgung einer zahlungskräftigen Nachfrage, nicht derjenigen, die auf preiswerte Wohnungen angewiesen sind. Eine soziale Wohnungsversorgung setzt eine leistbare und bedarfgerechte Wohnungsversorgung voraus. Insbesondere die Haushalte mit geringen Einkommen sollten nicht mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Wohnkosten ausgeben, damit noch was zum Leben übrigbleibt. Bei Einkommen zum Mindestlohn, prekärer Beschäftigung und kleinen Renten sprechen wir von Mietpreisen unter 5 Euro/m2, wenn die Kriterien der Leistbarkeit erfüllt werden sollen. Allein in den Großstädten fehlen schon jetzt etwa 2 Millionen leistbare Wohnungen.1
Solange Wohnungen als Ware gehandelt und zum Zwecke des Profits gebaut werden, wird es solche Wohnungen immer nur dort geben, wo profitträchtigere Verwertungsoptionen ausgeschlossen sind: in Substandardbeständen, in städtischen Ungunstlagen und in schrumpfenden Regionen, in denen es hohe Leerstandszahlen gibt. Da jede ökonomisch rationale Investition im Kapitalismus nach einer mindestens durchschnittlichen Verzinsung des eingesetzten Kapitals strebt, gibt es in der Marktlogik keinen Anreiz für Mieten zu unterdurchschnittlichen Preisen.
Eine soziale Wohnungs- und Mietenpolitik erfordert deshalb drastische Eingriffe in die am Profit orientierte kapitalistische Verwertung des Grund- und Hausbesitzes. Wohnungen sollten als soziale Infrastruktur angesehen werden und müssen jenseits der Profitlogik bereitgestellt, bewirtschaftet und verteilt werden. In der Konsequenz geht die Durchsetzung einer sozialen Wohnungsversorgung mit dem Umbau der Eigentümerstruktur einher und ist mit der Ausweitung eines gemeinwirtschaftlichen und nicht-profitorientierten Wohnungssektors verbunden. Wir sehen drei Elemente einer sozialen Wohnungspolitik:
- eine konsequente Mietpreisbegrenzung,
- die massive Verstärkung eines aus öffentlichen Mitteln finanzierten Sozialen Wohnungsbaus mit dauerhaften Mietpreis- und Belegungsbindungen,
- die Vergesellschaftung von Grund und Boden als Voraussetzung für eine soziale Stadtentwicklung.
Mietstopp und Mietpreisbegrenzung
Wenn hohe und steigende Mieten zum sozialen Versorgungsproblem werden, ist die naheliegende Antwort eine Begrenzung der Miethöhen.
Das von staatlicher Seite und der interessierten Wohnungswirtschaft favorisierte Wohngeld hingegen ist keine Lösung, da es als staatliche Kofinanzierung von Mietsteigerung des Problem verschärft: Je höher der Staat die teuren Mieten subventioniert, umso größer ist der Spielraum für noch höhere Mietforderungen - was wiederum noch höhere Wohngeldzahlungen zur Folge hätte. Eine Spirale ohne Ende! Eine Wohngeldreform, also wirklich angemessene Wohngeldzahlungen, würden bereits heute astronomische Summen verschlingen. Das Problem der teuren Mieten wird dadurch nicht gelöst.
Ohne einen Mietpreisstopp und eine schrittweise Begrenzung der Mietpreise, auf die tatsächlichen Bewirtschaftungskosten ist das Problem der immer höher steigenden Mieten auf Dauer nicht zu lösen.
- Ein Mietpreisstopp bedeutet, dass alle Mietpreise auf dem derzeitigen Stand eingefroren werden, so dass keinerlei Mieterhöhungen mehr vorgenommen werden können - weder bei bestehenden Mietverhältnissen, noch bei Neuvermietungen nach einem Mieterwechsel.
- Ein solcher Mietpreisstopp würde zumindest die aktuellen Mietverhältnisse schützen, eine weitere Verdrängung durch Mietsteigerungen ausschließen und aus der scheinbaren Logik der immer weiter steigenden Mieten aussteigen.
- Eine Mietpreisbegrenzung muss natürlich auch für die Erstvermietung von Neubauwohnungen gelten, bei denen derzeit die Eigentümer jeden Preis verlangen können, den der Markt gerade hergibt. Diese Erstvermietungsmieten müssten auf das Niveau der ortsüblichen Durchschnittsmiete begrenzt werden.
- Abgeschafft werden muss auch die Modernisierungsumlage, nach der die Mieter jährlich 8% der Modernisierungskosten bezahlen müssen - und zwar lebenslänglich -, obwohl die entstandenen Kosten bereits nach 12 Jahren zurückbezahlt sind.
- Die damit verbundenen Investitionen für die Wohnwertverbesserung finanzieren sich über die entsprechende Einstufung bei der ortsüblichen Vergleichsmiete.
In die Ortsübliche Vergleichsmiete - Mietspiegel - gehen in Zukunft alle Bestandsmieten ein (nicht nur die teuren Neuvermietungsmieten). Der örtliche Miet- spiegel dient als Grundlage sowohl für die Berechnung der Durchschnittsmiete bei Erstvermietungen im Neubau als auch für die Anpassung der Miete nach Modernisierungen an die entsprechende Wohnwertkategorie. - Die aus Klimaschutzgründen erforderlichen energetischen Sanierungen müssen mit öffentlichen Mitteln finanziert werden.
- In ein Mieterhöhungsverbot müssten ebenso Gewerbe- und Ladenmieten einbezogen werden. Gerade für kleine Ladenbesitzer*innen und Gewerbetreibende führen drastischen Mietsteigerungen und die damit verbundenen Kündigungen oft zur Vernichtung ihrer Existenz.
Ein staatlicher Mietpreisstopp ist nicht nur geboten, sondern auch möglich. Spätestens seit 1919 ist es in Deutschland gängige Praxis, dass der Staat mit mietpreisregulierenden Maßnahmen eingreift. Mit Regelungen der Mietpreisfestsetzung wurde auch in der Vergangenheit auf Wohnungsnotlagen reagiert.2
Aktuelle juristische und politische Diskussionen in Berlin zeigen, dass ein "Mietendeckel" als hoheitliches Mietpreisrecht sogar im Rahmen einer Landesgesetzgebung beschlossen werden kann.3
Dass private Hauseigentümer und Wohnungsunternehmen derartige Eingriffe nicht akzeptieren, ist verständlich, aber kein Gegenargument. Ihr Anspruch auf eine kontinuierlich steigende Rendite muss von den Mieter*innen nicht erfüllt werden. Ein Mietpreis- stopp würde dabei die aktuelle Ertragslage der Vermieter*innen nicht antasten, sondern lediglich eine Ausweitung der leistungslosen Zusatzgewinne einschränken.
Ein Mietstopp ist nicht nur die entscheidende Barriere gegen jede weitere Mietpreisexplosion, er wäre auch eine wirksame Waffe gegen Grundstücks- und Wohnungsspekulation. Wirksamer als jede noch so hohe Bodenwertsteuer. Auch der Umwandlungsspekulation wäre quasi der Boden entzogen; das Verkaufsargument der Immobilienhändler von den zu erwartenden überdurchschnittlichen Mietpreissteigerungen würde sich ins Nichts auflösen. Die Flucht ins Eigentum, um den immer höheren Mietbelastungen zu entkommen, würde gebremst werden. Ohne höhere Mieten keine höheren Wohnungsverkaufspreise, und ohne höhere Renditen bei der Nutzung des Bodens keine höheren Grundstückspreise.
Immobilieninvestoren werden allerdings kaum bereit sein, unter diesen Bedingungen Wohnungen zu bauen. Für die Mehrheit der Wohnungssuchenden ist das kein Schaden, weil sie sich schon heute die auf dem Markt angebotenen hochpreisigen Wohnungen nicht mehr leisten können. Für die Errichtung von Wohnungen zu bezahlbaren Mieten braucht es deshalb ein ambitioniertes Soziales Wohnungsbauprogramm, das aus öffentlichen Mitteln finanziert wird.
Sozialer Wohnungsbau mit dauerhaft bezahlbaren Mieten
Sozialen Wohnungsbau mit dauerhaft leistbaren Mieten kann es überhaupt nur unter Ausschaltung von Kapital- und Bankprofiten geben. Die Rendite der Banken und Grundstückseigentümer*innen ist der preistreibende Faktor der Wohnkosten - ohne diesen Profitanteil könnten selbst in Neubauten - und ohne eine zusätzliche Förderung - alle Mieten auf unter 6,00 Euro/m2 (nettokalt) bzw. unter 8,00 Euro/m2 (bruttokalt) gesenkt werden.
| Berechnung einer kostendeckenden Miete | ||
| Aufwendungen | Erklärung | monatliche Kosten |
| Instandhaltungskosten | mit 1% der Gebäude-Herstellungskosten eher großzügig kalkuliert | 1,25 €/m2 |
| Verwaltungskosten | Ausgaben für Verwaltung und Mietmanagement werden in wohnungswirtschaftlichen Kalkulationen mit 280 € je Wohnung p.a. berechnet | 0,40 €/m2 |
| Gebäudeabschreibung | Abschreibung umfasst 2% der Baukosten von ca. 2.500 € pro m2 und entspricht der steuerlichen Abschreibung von Wohngebäuden.* | 4,00 €/m2 |
| Mietausfallwagnis | Wird in Höhe von 2% der Nettokaltmiete veranschlagt; dient als Absicherung falls die Wohnung bei einem Mieterwechsel kurzzeitig leer steht. | 0,12 €/m2 |
| Nettokaltmiete | bewirtschaftungsnotwendige Kostenanteile | 5,77 €/m2 |
| Betriebskosten | Verbrauchs- oder gebührenabhängigen Kosten für den Unterhalt der Wohnung (wie Wasser, Müllabfuhr, Straßenreinigung, Grundsteuer, Versicherung, Hausmeister, Wartung der Heizung und Reparaturen). (Wert für München, Mietspiegel 2019) | 1,75 €/m2 |
| Gesamtkosten | 7,52 €/m2 | |
| * Die Bundesvereinigung Bauwirtschaft ging 2016 auf der Grundlage von Daten der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. von Baukosten in der Höhe von 2.400 €/m2 (inklusive aller Baunebenkosten) aus. | ||
Ein Sozialer Wohnungsbau, der diesen Namen verdient, ist nur möglich, wenn er öffentlich finanziert und von öffentlichen, gemeinnützigen oder genossenschaftlichen Trägern verwirklicht wird. Nur ein auf diese Weise entstehender und wachsender gemeinwirtschaftlicher Wohnungssektor, der von den Mietern demokratisch verwaltet wird, böte die Möglichkeit für ein dauerhaft soziales Wohnungswesen.
Beispiel Genossenschaften
Dass sozial tragbare Mieten auf Dauer möglich sind, beweisen heute schon die gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaften, die allerdings bundesweit nur über 5,3 Prozent des Wohnungsbestandes verfügen.4 So erhebt der "Gemeinnützige Wohnungsverein München 1899" mit 3.200 Wohnungen für eine ohne öffentliche Fördermittel errichtete Wohnung (Baujahr 1968) in zentrale Lage in München-Schwabing lediglich eine Nutzungsgebühr von monatlich 6,44 Euro pro Quadratmeter Bruttokaltmiete (also incl. aller Betriebskosten, Gebührenumlagen usw.). Die Genossenschaft macht zwar keine großen Gewinne, steht aber auch keineswegs vor dem wirtschaftlichen Ruin. Trotz der niedrigen Nutzungsgebühren werden Überschüsse erwirtschaftet, die in die Bestandserhaltung, in Modernisierungen und in den Neubau von Wohnungen investiert werden können.
Sozialer Wohnungsbau wie bisher - ein untaugliches Modell
Der in der BRD praktizierte Soziale Wohnungsbau hat weder zu preiswerten Sozialmieten, noch zu dauerhaft mietpreisgebundenen Beständen geführt. Die von den Wohnungsunternehmen kalkulierte Kostenmiete erforderte immer höhere Fördersummen, so dass mit immer mehr öffentlichen Mitteln immer weniger Sozialwohnungen mit immer kürzeren Bindungsfristen gebaut wurden. Statt in den Aufbau von dau- erhaft gebundenen Beständen zu investieren, wird so ein dauerhafter Kreislauf der Förderung mit begrenzten Effekten in Gang gehalten.
Beispiele aus anderen Ländern zeigen, welche Effekte dauerhafte Bindungen haben können. In Österreich z.B. gilt bei den gemeinnützigen Wohnbauträgern auch nach dem Ende der Förderphase die Kostenmietenbegrenzung, und nach der kompletten Refinanzierung des Objekts wird die Miete auf unter 5 Euro/m2 (nettokalt) abgesenkt.5
Eine entsprechende dauerhafte Ausrichtung der Wohnraumförderung würde auch hierzulande das soziale Versorgungspotential deutlich erhöhen. Die künftigen Förderprogramme sollten sich an dem Prinzip "einmal gefördert - immer gebunden" orientieren und eine zweckgebundene Verwendung von Rückflüssen aus den Förderprogrammen verpflichtend vorschreiben.
Die Finanzierung
Ein sinnvolles Förderformat wären dabei zinsfreie Darlehen mit einer jährlichen Tilgungslast in Höhe der Abschreibung, so dass von Beginn an leistbare Mieten gesichert werden. Die Höhe der Sozialmiete könnte in dieser Systematik durch Baukostenzuschüsse variiert werden, die die durch die Darlehen entstehenden Tilgungskosten weiter reduzieren. Sozialer Wohnungsbau muss in dem Umfang, wie es notwendig ist, vollständig und direkt aus öffentlichen Haushaltsmitteln finanziert werden, so wie das auch bei Schulen, Krankenhäusern, Kindergärten, Straßen, usw. der Fall ist.
Die Behauptung, dass die dafür notwendigen umfangreichen öffentlichen Mittel nicht vorhanden sind und Wohnungsbau nur über den privaten Kapitalmarkt finanziert werden kann, ist ein Märchen.
Schon heute finanziert der Staat nicht nur den Sozialen Wohnungsbau, sondern auch alle anderen Wohnungen, die in der BRD errichtet werden und er bezahlt sogar wesentlich mehr, als die Kosten zur Herstellung der Wohnungen. Die staatlichen Steuersubventionen, die in jede Wohnung gesteckt werden, sind bei einem großen Anteil der Wohnungen wesentlich höher als die Herstellungskosten. Der Unterschied bei einer direkten Finanzierung wäre, dass die jährliche Summe der staatlichen Zuschüsse für den Wohnungsbau unverschleiert als Ausgabeposten im Staatshaushalt erscheinen würde, und dass statt Luxuswohnungen, Villen, Zweit- und Drittwohnungen die preisgünstigen Mietwohnungen gefördert würden, die am dringendsten benötigt werden.
Berechnungsbeispiel
Sozialverbände und Mieterorganisationen fordern ein Neubauvolumen in Höhe von 150.000 Wohnungen, um die Zahl der Abgänge von auslaufenden Belegungsbindungen nicht nur zu kompensieren, sondern den Stock der Sozialwohnungen wieder zu erweitern. Im Vergleich zu den aktuellen Förderzahlen (25.000 Wohnungen) klingen 150.000 geförderte Wohnen pro Jahr nach einer sehr hohen Zahl, doch sie entsprechen den durchschnittlichen Förderquoten in den 1950er und 1960er Jahren.
Die reinen Baukosten liegen zurzeit inklusive aller Baunebenkosten bei ca. 150.000 Euro pro Wohnung.6 (Die Grundstückskosten vernachlässigen wir, da die Bereitstellung öffentlicher Baugrundstücke vorausgesetzt wird.) Das entspricht einem jährlichen Kostenaufwand von 22,5 Mrd. Euro. Die tatsächliche Subventionslast durch entgangene Zinserträge aus dem zinsfreien Darlehen (50 Jahre Laufzeit) für die 150.000 Wohnungen liegt mit etwa 11,5 Mrd. Euro deutlich darunter, denn die ausgereichten Fördermittel werden ja über die Tilgung zurückgezahlt. Private Bauherren würden im selben Zeitraum für die gleiche Anzahl von Wohnungen mit Steuersparvorteilen (Abschreibung und Werbungskosten für Zinsen) in Höhe von 31,5 Mrd. Euro durch den Staat begünstigt werden. Es ist also weniger die Frage, ob der Staat den Wohnungsbau subventioniert, sondern, welcher Wohnungsbau mit welchen Effekten gefördert wird.
Nehmen wir in einem Gedankenexperiment an, der Staat hätte seit Anfang der 1950er Jahren jährlich rund 150.000 Wohnungen errichtet, und keine dieser Wohnungen hätte ihre Sozialbindung "verloren", dann gäbe es heute - zusammen mit den 4 Millionen kommunalen Wohnungen aus der DDR - fast 15 Millionen Sozialwohnungen,7 das wäre bundesweit etwa ein Drittel aller Wohnungen.
Ein öffentlich finanzierter Wohnungsbau würde - zumindest langfristig - den Staatshaushalt entlasten. Aus der Tilgung der öffentlichen Darlehen für die 150.000 neu geförderten Wohnungen fließen in jedem Förderjahr (50 Jahre lang) 450 Mio. Euro (2% von 22,5 Mrd. Euro) in den Fördertopf des Staates zurück und stehen für die nächste Förderrunde zur Verfügung.
Nach der vollständigen Rückzahlung der öffentlichen Darlehen könnte anstelle der Tilgungsrate von 4,16 Euro/m2 eine monatlichliche Förderabgabe von 2 Euro/m2 erhoben werden.8 Auf diesem Weg würden langfristig pro Jahr weitere Beträge in den staatlichen Wohnbaufond fließen, so dass nicht nur das ambitionierte Wohnungsbauprogramm, sondern auch noch Modernisierungsarbeiten und Investitionen in öffentliche Infrastrukturen aus den Rückflüssen finanziert werden könnten. Hinzu kämen die Einsparungen eines großen Teils der bis zu 18 Mrd. Euro, die derzeit jedes Jahr für Wohngeldzahlungen und die Finanzierung der "Kosten der Unterkunft" für Hartz IV-Empfänger ausgegeben werden. Die Vorteile einer sich selbst tragenden Förderung (revolvierender Fonds) werden zwar erst langfristig wirksam, doch der Aufbau eines neuen Systems der Wohnungsversorgung beginnt immer mit dem ersten Schritt.
Leider gab es in der Vergangenheit keine voraus- schauende Förderpolitik, und statt der jährlichen Zuflüsse von dauerhaft gebundenen Sozialwohnungen der letzten 70 Jahre stehen die Städte vor dem Problem eines weiteren Abschmelzens der Sozialwohnbestände. Statt öffentliche Ressourcen in einem wirklich sozialen Wohnbauprogramm zu binden, wurden die Fördergelder der Vergangenheit zu Gunsten meist privater Investor*innen verschleudert.
Die Konsequenz müsste sein, wenigstens jetzt mit einem groß angelegten Sozialwohnungs-Bauprogramm mit dauerhaften Bindungen zu beginnen, statt weiterhin vor allem Wohnungsbau-Konzerne und Banken mit Milliardenbeträgen zu subventionieren. Forderungen zur Einführung einer Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit (NWG)9 oder auch die bisher leider nur lokal geführten Debatten der "Initiative Neuer Kommunaler Wohnungsbau" (INKW)10 in Berlin haben in den letzten Jahren dazu beigetragen, die Notwendigkeit von Förderprogrammen mit dauerhaften Bindungen und einer öffentlichen bzw. gemeinwirtschaftlichen Organisation des Wohnungsbaus mit Gewinnverzichten sowie die Vorteile von revolvierenden Prinzipien bei der Finanzierung in die öffentlichen und fachpolitischen Debatten zu tragen. Modellrechnungen und konkrete Vorschläge zeigen dabei, dass ein anderer Wohnungsbau tatsächlich möglich ist.
Grund und Boden in gesellschaftliches Eigentum
Ohne grundlegende Änderung des Bodenrechts ist weder eine soziale Wohnungspolitik noch eine an sozialen, kulturellen und ökologischen Erfordernissen orientierte Landes- und Stadtentwicklung möglich.
Grund und Boden müssen der privaten Verfü- gungsgewalt und der Profitspekulation entzogen und in demokratisch kontrolliertes gesellschaftliches Eigentum überführt werden.
Alle bisher unternommenen Versuche, mit Hilfe systemkonformer Korrekturen die Auswüchse der Bodenspekulation zu beseitigen, sind gescheitert.11 Die Forderung, Grund und Boden aus dem Warenkatalog kapitalistischer Verwertung zu streichen, steht deshalb weiterhin auf der Tagesordnung. Dabei ist die Wohnungsfrage nur eines von vielen Problemen, die eine grundlegende Änderung des Bodenrechts erforderlich machen.
So lange der Bodenpreis in der Marktlogik aus den jeweils höchsten erzielbaren Renditen der Verwertung abgeleitet wird, ist eine Nutzung im Interesse der Allgemeinheit ausgeschlossen. Da insbesondere aus sozialen Infrastrukturen, aus Grünanlagen und preiswerten Wohnungen keine Gewinne zu erwarten sind, ziehen diese Nutzungen in der Konkurrenz zu renditeorientierten Projekten fast immer den Kürzeren - außer die Kommune zahlt Millionenbeträge für die hohen Grundstückskosten.
Denn die Kommunen müssen die Grundstücke zu Marktpreisen erwerben, wenn gemeinnützige Nutzungen verwirklicht werden sollen. Das ist nicht gerechtfertigt, denn die sogenannten Marktpreise haben gar keinen materiellen Gegenwert, sondern erwirken eine öffentliche Entschädigung für private Gewinnerwartungen.
Das Angebot, einen Lottoschein - noch vor der Ziehung der Lottozahlen zum Preis eines möglichen Hauptgewinns zu kaufen, würden wohl die meisten von uns als völlig absurd ablehnen. Doch im Prinzip funktioniert der Bodenmarkt genau so.
Das immer wieder reklamierte "Recht auf das Eigentum" steht einer Gemeinwohloptimierung entgegen. Im Interesse einer sozialen und nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung muss der Boden grundsätzlich der privaten Verfügungsgewalt entzogen werden. Wie Wasser und Luft ist der Boden ein existenzielles Gut und sollte als eine allgemeine Ressource in öffentlicher Hand oder Gemeinbesitz liegen. Dass ausgerechnet der Ertragserwartungspreis die beste Verteilung des Bodens sicherstellen soll, ist eine absurde Annahme, da dieses Prinzip gesellschaftlich notwendige und wünschenswerte Nutzungen ausschließt.
Erst unter der Voraussetzung gesellschaftlichen Eigentums könnten Kommunen ihre Planungshoheit tatsächlich dazu nutzen, eine sinnvolle Widmung des Bodens im Interesse des Allgemeinwohls zu ermöglichen. Statt Grund und Boden zu Höchstpreisen zu verkaufen, wie das heute von vielen Städten praktiziert wird, würden Nutzungsrechte vergeben werden, die sich an den Interessen des Allgemeinwohls und an den besten Konzepten mit dem größten Mehrwert für die Gesellschaft orientieren. Die Vergesellschaftung des Bodens betrifft nicht die Besitzer*innen von selbstgenutzten Eigenheimen. Diese bekommen die Nutzung des Grundstücks in Form von Erbbaurechtsverträgen garantiert.
Einige Städte experimentieren in den letzten Jahren in kleinen Nischen öffentlicher Liegenschaften mit Konzeptvergaben und orientieren sich an einer strategischen Liegenschaftspolitik, bei der gezielt Grundstücke für die Stadtentwicklung erworben werden. Auch soziale Stiftungen und Bürgerinitiativen setzen sich in den letzten Jahren intensiver mit den Fragen der Grundstückspolitik auseinander und diskutieren Modelle und Konzepte für eine verwertungsfreie Nutzung städtischer Grundstücke im Interesse des Allgemeinwohls.
Schon jetzt wird für immer mehr Menschen deutlich, dass unter Beibehaltung des kapitalistischen Bodeneigentums und seiner Verwertungslogik weder die Wohnungsversorgung, noch eine an den Bedürfnissen der Allgemeinheit, an ökologischen Erfordernissen und Zukunftsperspektiven ausgerichtete Planung, Nutzung und Entwicklung der Städte und der ländlichen Gebiete zu gewährleisten ist.
isw-report 116/117 ist für 5,- Euro zzgl. Versand zu beziehen bei isw e.V., Johann-von-Werth-Str. 3, 80639 München
email: isw_muenchen@t-online.de
www.isw-muenchen.de
