Was kostet ein Leben, was darf es kosten?
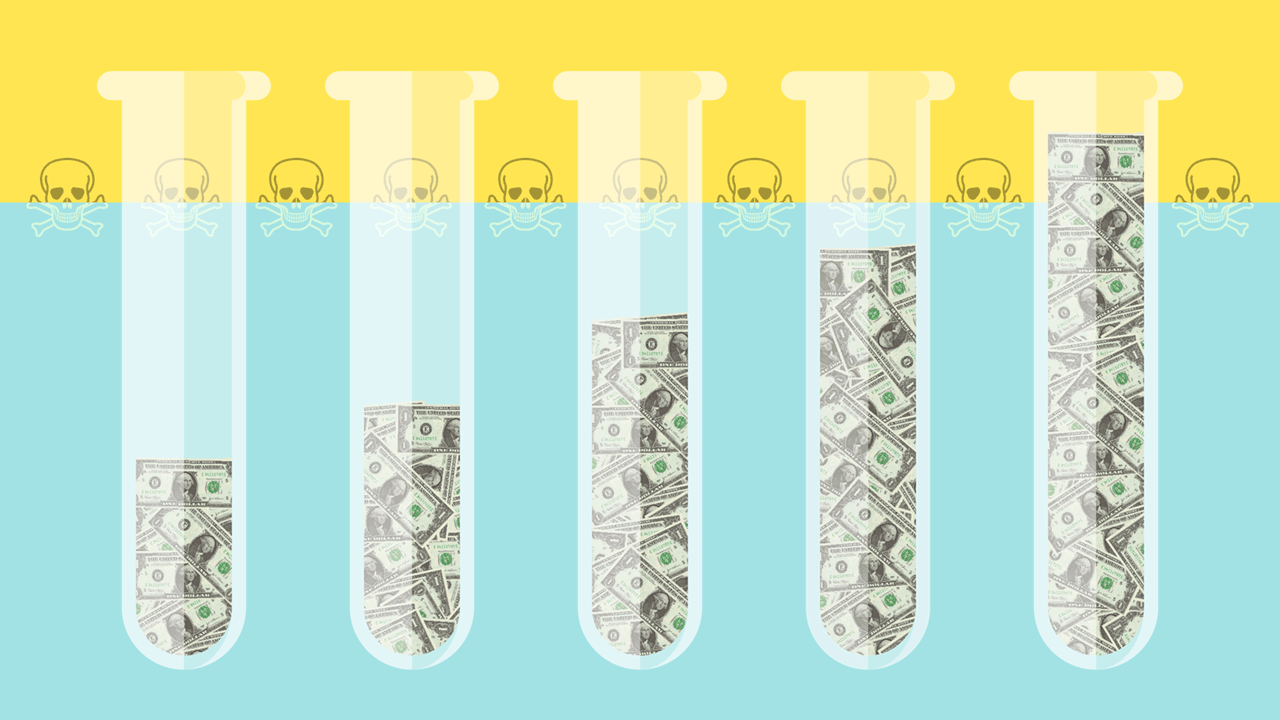
Novartis verlost an Kinder mit der seltenen Krankheit Spinale Muskelatropie ein Medikament, das 2,1 Millionen US-Dollar kostet
Sie heißen Hanna, Michael (SZ, 24.1.20), Milan oder Alparslan (WAZ, 11.1.20) und haben eines gemeinsam: Sie sind Kinder und leiden an einer seltenen Krankheit (Spinale Muskelatropie), die bei Nichtbehandlung schnell zum Tode führt.
Zur Behandlung gibt es bereits ein Medikament (Spinrasa), das alle vier Monate gespritzt werden muss und pro Injektion 90.000 Euro kostet, dabei keine Heilung, sondern lediglich eine Stabilisierung des Status quo verspricht. Nun gibt es in den USA ein neues Medikament (Zolgensma), das einmalig verabreicht wird, Heilung verspricht, aber 2,1 Millionen Dollar kostet. Da es in Deutschland noch nicht zugelassen ist, ist die Übernahme der Kosten fraglich und überhaupt umstritten, denn es gibt noch keine eindeutige Antwort darauf, ob das Heilungsversprechen auch eingelöst wird.
Angesichts der schweren Schicksale und der Höhe der Behandlungskosten werden Journalisten philosophisch und werfen eine Reihe von ethischen oder ökonomischen Fragen auf: Zum einen gibt es in Kommentaren den Tenor, dass ein Menschenleben nach Kant einen qualitativen Wert darstellt, der sich nicht in Geldgrößen oder sonstwie bemessen lasse (SZ, 13.1.20); andererseits finden ja ständig solche Bemessungen statt, so dass die Kantsche Ansicht in den Bereich des Idealismus verwiesen wird, da er sich schlichtweg an der Realität blamiere. Bei allem Eintreten für den Wert des Lebens stellt sich den Medienvertretern zudem die Frage, was ein Medikament kosten darf und wo Behandlungskosten unmoralisch werden. Das führt dann zur Abschlussfrage: Wer soll das bezahlen bzw. was können Krankenkassen überhaupt noch an Kosten verkraften?
Geld regiert die Welt
Folgt man dem Bericht der SZ, so erfährt man die Banalität, dass ständig Berechnungen des Werts von Menschenleben stattfinden - sei es als Entschädigung bei Unfällen, sei es im Rahmen von Berechnungen, ob sich eine Behandlung lohnt etc. In ersterem Fall erscheint die Berechnung als Trost für die Angehörigen, was keinen Anlass zur Aufregung abgibt, allenfalls bei der Höhe der Abfindung gelegentlich zum Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen wird. Dabei unterlässt es in der Regel keine Seite, zu betonen, dass der Wert eines Menschen nicht mit Geld aufzuwiegen ist, hält aber auch daran fest, dass ein Verzicht auf solche Zahlungen unüblich ist.
Sind die Kosten von Behandlungen oder Medikamenten Thema, steht rasch die Empörung im Vordergrund, und zwar vor allem dann, wenn es sich auch noch um die Behandlung von Kindern handelt.
Dabei legen beide Berechnungen eins offen: So einzigartig ein Mensch auch sein mag, seine Bedeutung relativiert sich praktisch an einem übergeordneten Kriterium, dem alles in dieser Gesellschaft untergeordnet ist - am Geld. Um das dreht sich in dieser Gesellschaft eben alles. Oder um diese triviale Erkenntnis etwas genauer zu fassen: Um die Vermehrung von Geld dreht sich das ganze Wirtschaftsgeschehen, darauf ist alles ausgerichtet, eben auch das (Über-)Leben der Menschen. Praktisch und augenfällig erweist sich dies im Arbeitsverhältnis, bei dem Arbeitgeber Menschen die Verfügung über ihre Lebenszeit abkaufen, indem sie ihnen Lohn oder Gehalt zusagen. Für einen bestimmten Betrag kann man sich eben hierzulande die Verfügung über das Leben anderer Menschen verschaffen und damit bestimmen, was sie in dieser Zeit zu tun oder zu lassen haben. Als anstößig gilt dieses Verhältnis übrigens nur im Rahmen der Prostitution!
Zum Grundsatzthema wird die Verfügung über das Leben anderer dann, wenn es vorbei ist, wenn Entschädigungen anstehen. Dabei wird nicht der Geschädigte entschädigt, denn diesen gibt es ja nicht mehr, sondern seine Angehörigen, denen ein Verlust zugebilligt wird, über dessen - in Geld bemessene - Höhe dann munter gestritten werden kann. Und obwohl immer wieder betont wird, dass ein Menschenleben einzigartig sei, gibt es in der Wissenschaft ganze Abteilungen, die sich mit der Berechnung des Werts von Menschenleben profilieren.
So findet man einerseits den Ansatz, dass ein Menschenleben nach der Höhe des noch zu erwartenden Einkommens in der durch den Tod verlorenen Zeit zu berechnen sei. Ein interessanter Ansatz, der die Rede vom "Humankapital" blutig ernst nimmt: Unterstellt er doch bei einem Kleinkind, dass man schon weiß, welche Erwerbstätigkeit es wahrscheinlich mit welchem Erfolg ergreifen wird. Andererseits ist offenbar das Leben eines Mindestlohnempfängers weniger wert als das eines Managers - wofür es ja auch empirische Belege gibt. Schließlich sterben Männer aus unteren Schichten elf Jahre früher und Frauen aus derselben Schicht acht Jahre früher als ihre Geschlechtsgenossen bzw. -genossinnen aus den oberen Rängen der Gesellschaft. Auch wissen die betreffenden Rechenkünstler offenbar, wie lange ein solcher Mensch wohl leben und vor allem arbeiten wird.
So schwer die Bestimmung des Wertes eines Menschenlebens auch sein mag, eins ist jedenfalls sicher: Wichtiger als das Leben eines Menschen ist das Geld, das auch nach seinem Tod Streitgegenstand ist.
Was ist ein menschliches Lebensjahr wert?
Die Frage hat sich eine Sendung im Deutschlandfunk gestellt und sie gleich darauf erweitert, "was Lebensrettung kosten darf". Ausgangspunkt der Fragestellung sind die Behandlungskosten bei verschiedenen, zum Teil seltenen Krankheiten wie Akute Lymphatische Leukämie oder Spinale Muskelatrophie. Die Kosten belaufen sich hier teilweise auf weit mehr als 100.000 € oder gehen über die Millionengrenze.
Dies wirft ganz neue Fragen auf: zum einen nach der Berechtigung der Forderungen, die die Pharmaindustrie erhebt, wobei sie die eminent hohen Behandlungskosten mit ihren hohen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung zu begründen pflegt; zum andern danach, wann sich der Aufwand für eine Behandlung in solcher Kostendimension lohnt oder ob nicht abgewogen werden muss, wer eine solche Behandlung erhalten darf.
Zur Begründung der hohen Kosten für Forschung und Entwicklung lässt eine Zeitung aus Hessen einen Professor zu Wort kommen:
Dass ein Medikament so teuer ist, hat mehrere Gründe, berichtet Prof. Andreas Hahn. Zum einen sagt der Kinderneurologe der Uni-Klinik Gießen, habe das etwas mit den Entwicklungskosten zu tun, die sehr hoch seien. Dazu kämen Studien, die folgten, sobald das Medikament entwickelt sei, und bei denen u.a. Fragen zur Wirksamkeit, zur Sicherheit und zu Nebenwirkungen geklärt werden müssten. Dazu würden eine Reihe an Versuchen durchgeführt, zum Beispiel Experimente an Mäusen. Letztlich sagt der Arzt, liegen die Entwicklungskosten oft deutlich über 100 Millionen Euro. Und dadurch dass die Krankheit selten auftrete, dauere es, bis die Kosten wieder eingenommen würden, weswegen die Behandlung so teuer sei.
Prof. Andreas Hahn
Dass ein Professor seine Expertise für die Pharmaindustrie in die Waagschale wirft, muss nicht überraschen, findet doch ein Großteil solcher Forschung an Universitäten statt, finanziert durch die Pharmaindustrie. Der Gesetzgeber hat die Universitäten schließlich aufgefordert, Drittmittel einzuwerben, und so die Karriere von Wissenschaftlern von außeruniversitären Geldgebern abhängig gemacht. Wer vorankommen will, braucht solche Forschungsmittel, und die bekommt man nur, wenn man entsprechende Ergebnisse liefert und für das von einem selbst erforschte Mittel wirbt. So gelten Professoren mittlerweile auch als "Mietmäuler", weil sie bei Tagungen oder Weiterbildungen als Referenten auf- und für "ihr" Medikament eintreten, indem sie entsprechende Forschungsergebnisse vortragen.
Wenn der Professor die hohen Kosten als Grund für die teuren Behandlungen anführt, dann ist dies jedoch nur die halbe Wahrheit - und das im buchstäblichen Sinne. Landläufig setzen sich die Kosten für ein neues Medikament zur Hälfte aus dem Entwicklungsaufwand und zur anderen Hälfte aus Werbungskosten zusammen. Werben können Pharmafirmen nicht wie andere Firmen über Zeitungen, Internet oder Fernsehen, weil die Konsumenten des Produktes, die Patienten, nicht über Kauf oder Nicht-Kauf entscheiden, sondern die behandelnden oder verschreibenden Ärzte. Also gibt es ein Heer von Pharmareferenten, die bei den Ärzten oder Kliniken vorstellig werden und mit einschlägigen Angeboten versuchen, die Verschreibungs- oder Behandlungspraxis zu beeinflussen.
Um beim Ärztestand vorsprechen zu können, müssen sie ihm schon einiges bieten. So gibt es inzwischen sogar eine Ärzte-Initiative, deren Name Programm ist: "Mein Essen zahle ich selbst". Durch die Verpflichtung zu Rabattverträgen mit den Krankenkassen haben sich die Werbebemühungen der Pharmafirmen nochmals gewandelt, aber Ärzte stehen immer noch ganz oben auf der Liste.
Der Hersteller des besonders teuren Medikaments Zolgensma, der Pharmakonzern Novartis, verweist übrigens - anders als der zitierte Professor - gar nicht auf die Forschungskosten, sondern auf den Wert der Behandlung: Der Preis "spiegelt sowohl den Wert wider, den diese Behandlung für Patienten, Pflegekräfte und das Gesundheitssystem hat, als auch die geringe Anzahl der Patienten". (SZ, 24.1.20)
Damit bezieht sich der Hersteller zum einen auf die Notlage der Patienten, die auf die Behandlung angewiesen sind und die er auszunutzen gedenkt, zum anderen auf die staatliche Vorgabe für die Zulassung neuer Medikamente zur Finanzierung durch die gesetzliche Krankenversicherung. Das Zulassungsgremium, der Gemeinsame Bundesausschuss, der mit Vertretern der Ärzteschaft und der Krankenkassen besetzt ist, entscheidet nach den Kriterien der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit.
Indem Novartis mit Zolgensma ein Heilungsversprechen auf den Markt bringt, kann dieses Medikament für sich größere Wirksamkeit als das Konkurrenzprodukt Spinraza beanspruchen. Bei einer dreimaligen Behandlung mit letzterem fallen pro Jahr Kosten in Höhe von ca. 270.000 € an. Da Zolgensma nur einmalig verabreicht werden muss, verspricht Novartis, mit seinem Angebot nach mehreren Jahren wirtschaftlicher zu sein, und begründet so seinen Preis ganz frei von jeder Aufrechnung der eigenen Kosten.
Dass Pharmahersteller solche Traumpreise verlangen können, verdanken sie staatlichen Regelungen. Entscheidend für die Höhe der Kosten eines Medikaments ist als Erstes die Anerkennung des Patents, das auf den neuen Wirkstoff ausgestellt wird. Dies verschafft dem Hersteller ein Monopol für den darin enthaltenen Wirkstoff, das zehn Jahre gilt - und in dieser Zeit kann er im Prinzip jeden Preis verlangen. Um sein Produkt durch die Krankenkassen finanziert zu bekommen, bedarf es der Zulassung durch den oben angesprochenen Gemeinsamen Bundesausschuss, die mit der Prüfung von Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit verbunden ist. Nach erfolgter Prüfung kann der Hersteller ein Jahr lang jeden Preis verlangen, muss dann aber mit den Kassen in Verhandlungen über die zukünftige Preisgestaltung treten. Wenn es kein Alternativprodukt gibt, ist die Position der Kassen aussichtslos, dann können sie die Zulassung nicht rückgängig machen.
Dass in den Medien mit einer gewissen Regelmäßigkeit Einzelschicksale dargestellt werden, deren Behandlung an der Finanzierung durch die Krankenkassen zu scheitern droht, so dass die Eltern - etwa für eine Behandlung in den USA - auf Spenden angewiesen sind, legt einen Verdacht nahe: Hier soll ein neues Medikament in den Markt gedrückt werden!
Wie das gehen kann, ist durch den Gesetzgeber vorgezeichnet. Zunächst braucht Novartis z.B. die Zulassung als Medikament durch die europäische Behörde. Als ein Mittel zur Behandlung seltener Krankheiten, zu denen die Spinale Muskelatrophie gehört, kann es auch ohne umfangreiche klinische Studien zugelassen werden, da die Patientenpopulation verhältnismäßig klein ist.
Bislang waren Medikamente für seltene Krankheiten kaum auf dem Markt vorhanden, da sich die Entwicklung und Produktion für die Hersteller nicht lohnte und sie auf Blockbuster für die massenhaft vorhandenen Zivilisationskrankheiten setzten. Deren Patentschutz ist allerdings in den meisten Fällen abgelaufen, somit können alle interessierten Hersteller diese Mittel als Generika verkaufen. Das drückt den Preis, die Produktion der Wirkstoffe ist daher weitgehend nach China, Indien oder Vietnam verlagert worden. Manche Produkte wurden vom Markt genommen, weil sie sich nicht mehr lohnen, bei anderen kommt es inzwischen mit großer Regelmäßigkeit zu Versorgungsengpässen - auch eine wunderbare Leistung der viel gelobten Marktwirtschaft, die laufend Mangelwaren hervorbringt!
Die große Verlosung
Angeregt durch die EU haben nun die Pharmaunternehmen den Markt mit seltenen Krankheiten für sich entdeckt oder aber die Personalisierte Medizin, also Medikamente für eine Teilgruppe von Patienten, und fordern für diese Medikamente Beträge von Hunderttausenden von Euro oder wie im Falle von Zolgensma 2 Millionen. Wie das Beispiel von Novartis zeigt, unterziehen sie sich nicht einmal der Mühe, ihre Gewinnansprüche mit den eigenen Kosten zu begründen - ganz so, als ob jede Ausgabe von Geld durch Unternehmen, der Einsatz von Kapital, per se ein Recht auf Verzinsung beinhalten würde.
Für besondere Aufregung hat jetzt die Aktion von Novartis gesorgt, 100 Dosen dieses Medikamentes gratis abzugeben. Eltern der kranken Kinder können sich hier bewerben und die Zuteilung wird verlost. Einen Effekt hat die Aktion bereits erzielt: Das Medikament ist in aller Munde. Dabei soll die Aktion einerseits ein Akt der Selbstlosigkeit sein, schließlich werden die Medikamente kostenfrei abgegeben, wobei der Konzern betont, dass die Fabrik in den USA zurzeit nicht mehr herstellen könne. Andererseits wird in der Öffentlichkeit die Verlosung kritisiert und dem Pharmakonzern vorgeworfen, das Leben von Kindern zu einem Lotteriespiel zu machen. Während Professoren für Ethik sich zu schwierigen Abwägungen herausgefordert fühlen, sehen sich Gesundheitspolitiker durch die Aktion unter Druck gesetzt, für eine schnelle Zulassung des Medikamentes zu sorgen.
Angesichts der geforderten Beträge, bei denen den Medien schnell Zweifel in Sachen Bezahlbarkeit durch die Krankenkassen kommen, stößt sich niemand daran, dass auch das Gesundheitswesen - wie alles in dieser Gesellschaft - ein Geschäftszweig ist und damit alles Lebensnotwendige abhängig ist von der Verfügung über Geld. Statt dessen wird philosophisch aufs Tiefsinnigste über den Wert des Lebens sinniert, was dann die marktwirtschaftliche Vernunft ganz banal auf Fragen der Bezahlbarkeit von Behandlungen zurück- und in Debatten dazu überführt, ab wann Leistungen für Kranke oder Alte unbezahlbar werden und damit eingeschränkt gehören.