Wer nicht träumt, wacht müde auf
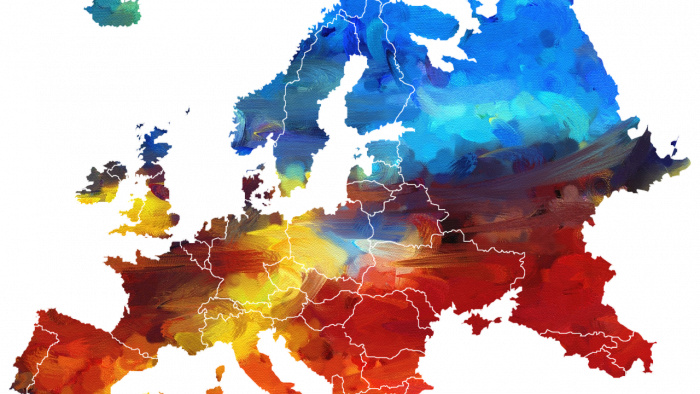
Bild: Pixabay.com
Rede über die europäische Zukunftsdeprivation
"Is this a great time, or what :-)" (Werbeslogan der US-Telefongesellschaft MCI, 1997)
Als ich zum ersten Mal von dem Thema dieser Veranstaltung hörte, war ich verwundert: Müdigkeit? Ich starrte einen Augenblick auf die E-mail, die erklärte, daß die Welt in wildem, ermüdendem Leerlauf stillzustehen scheine, dann sah ich vom Monitor auf und hinaus auf die alten Juniper-Bäume vor dem Fenster und den Canyon dahinter und den hohen blauen Himmel darüber.
Ich verstand nicht recht, worum es ging. Wer war da wovon müde? Und vor allem, warum war diese Müdigkeit einer obskuren Minderheit, selbst wenn es sie gab, ein so wichtiges Thema?
Zu dem "wir", von dem da die Rede war, gehörte ich jedenfalls nicht. Ich war definitiv nicht müde, eher ein wenig aufgekratzt. Denn ich finde nicht, daß sich nichts bewegt, daß sich keine Zukunft abzeichne.
Nach meiner Erfahrung stimmt das genaue Gegenteil: Das Leben ist heute so spannend wie seit Jahrzehnten nicht mehr, so spannend wie einst in den sechziger Jahren, als ich Nächte vor dem Fernseher klebte - nein, nicht, um die damals wie heute ziemlich überschätzten bundesdeutschen Studentenunruhen zu verfolgen. Die interessierten mich als Zwölf-, Dreizehnjährigen nicht die Bohne, und auch der Prager Frühling, von dem ich beim Friseur hörte, zu dem mich meine Mutter unter Androhung von Liebes- und Taschengeldentzug geschleppt hatte, ließ mich kalt. Dubcek und Honecker, Breschnew und die russischen und ostdeutschen Panzer, das war alles langweilig, Umtriebe von alten Männern in grauen Anzügen, die die Zukunft, nach der ich mich sehnte, sowieso nicht erleben würden. Die nämlich lag in den Sternen: Was mich die Nächte ohne jede Müdigkeit durchhalten ließ, waren die ersten Raumschiffe, die vom Planeten Erde gen Mond flogen.
Alles schien damals möglich, und alles scheint nun wieder möglich. Die Welt ist in Bewegung, neue Grenzen lassen sich überschreiten. Von der Eroberung des Cyberspace über die Fortschritte der Gentechnik bis zu den ersten Ergebnissen der Nanotechnologie - die Menschheit schickt sich endlich wieder an, unbekannte Räume zu erobern. Wir erlangen Kenntnisse und entwickeln Fähigkeiten, die vor wenigen Jahren noch undenkbar schienen, wir nehmen unser Schicksal als Spezies selbstbewußter denn je in die eigene Hand.
Explosion an Innovationen
Jenseits all der großen epochalen Worte bringt dieser Eintritt ins digitale Zeitalter ebenso radikale wie wundersame Veränderungen für das Leben jedes einzelnen. Meines zum Beispiel wurde schon durch das bißchen digitaler Infrasstruktur, was bislang existiert, schlicht von den eingeschlafenen Füßen auf den sehnsüchtigen Kopf gestellt.
Die Digitalisierung ermöglichte mir, wie Unzähligen anderen, endlich zu realisieren, wovon ich zwei Jahrzehnte lang geträumt hatte: Die großen Apparate und die großen Städte zu verlassen, aus Deutschland fortzuziehen, an wärmere, freundlichere Orte - und dabei doch nicht isoliert zu werden, nicht abgeschnitten zu sein von dem steten Strom der Informationen und Waren, wie ihn bis vor kurzen nur die Großstädte boten. Dank Internet (und in begrenztem Maße auch Dank Telefon, Fax und Satelliten-TV) bleibe ich nach Lust und Laune informiert und so dicht am Zentrum des Geschehens, daß ich weiterhin als Autor deutscher Sprache meinen Lebensunterhalt verdienen kann.
Heute ist nichts mehr an meinem Alltag noch so, wie es vor fünf Jahren war - wie ich lebe, mit wem und für wen ich arbeite, worüber ich schreibe, alles ist neu: neue Orte, neue Menschen, neue Gewohnheiten, neue Themen. Denn die Welt quillt schier über vor funkelnagelneuen Gelegenheiten und Ereignissen, und der Tag ist nicht lang genug, um all das zu erkunden, was mich fasziniert.
Es ist viel, aber nicht zuviel. Die Explosion an Innovationen ist in ihrer schieren Quantität durchaus anstrengend, sie fordert viel Aufmerksamkeit und Energie, aber ich werde ihrer nicht müde, da das Neue ja so vielfältig ist. Und darin bin ich keine Ausnahme, darin gleiche ich dem Gros der Menschen, die ich in Amerika kenne und denen ich zufällig begegne, im Cyberspace und anderswo - sonst besäße der MCI-Werbeslogan, den ich eingangs zitierte, auch schwerlich die Massenwirkung, die eine solche Millionenkampagne erfordert.
Ich will nun aber meine Verwunderung über die Behauptung einer in Europa grassierenden Gegenwarts- und Zukunftsmüdigkeit nicht übertreiben. Denn natürlich weiß ich, daß in anderen Teilen der Welt, schon an der amerikanischen Ostküste, erst recht in Europa, in Deutschland, über die heraufziehende digitale Epoche anders gedacht wird, negativer und pessimistischer. Eine der schönen Konsequenzen des being digital, des Lebens unter digitalen Bedingungen, ist ja, daß es für die Erlangung von Informationen keinen rechten Unterschied mehr macht, wo man lebt. Auf meiner abgeschiedenen Ranch in Arizona lese ich deutsche Zeitungen im Zweifelsfall, bevor der Durchschnittskäufer ein gedrucktes Exemplar in der Hand hält, und ich diskutiere mit meinen Freunden hartnäckiger und gründlicher per E-mail oder bei Live-Chats, als wir es je über Bier- und Weingläsern getan hatten.
Müdigkeit allerdings schien mir, als ich die Einladung zu dieser Veranstaltung bekam, auf den ersten Blick nicht das passende Wort für all die befremdlichen Nachrichten aus der alten Welt, handelten sie doch weniger von Erschöpfung als von Unsicherheit und Abwehr, von Angst und Aggression.
Euro-Angst. Eine Bestandsaufnahme
Euro-Angst heißt das in der amerikanischen Presse, und damit ist nicht die verbreitete Furcht vor der neuen Währung gemeint, sondern die - von außen äußerst irrational anmutende - Neigung der Europäer, hinter noch der kleinsten Veränderung, die die gewohnten Kreise stört, nichts weniger als einen Weltuntergang zu vermuten.
Der Umgang mit den Errungenschaften der digitalen Epoche gibt dafür ein schlagendes und zugleich typisches Beispiel, denn alle Beteiligten reagieren ganz automatisch, wie es von ihnen zu erwarten ist. Die Mehrheit der Politiker, die natürlich gar nicht versteht, worum es eigentlich geht, setzt in bewährter obrigkeitsstaatlicher Tradition auf Verbote; schließlich war ja früher immer alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt war.
Die mächtigen Verwaltungen - zu denen bis heute die monopolistischen Telekombehörden zählen -, unternehmen wenig und blockieren alles, indem sie die Qualität des notwendigen Leitungsangebots so schlecht und die Preise so hoch wie möglich gestalten.
Am wildesten treiben es aber die meinungsführenden Kulturkritiker in den Medien. In Ermangelung eigener praktischer Erfahrungen und Erkenntnisse, bedienen sie sich freizügig bei allem, was es im angelsächsischen Raum an neo-ludditentümlichen Schriften gibt, während sie den breiten Technik-Optimismus, auf den diese Schriften ja nur die Reaktion darstellen, souverän mit Verachtung strafen. Sie gebärden sich als Warner vor der drohenden Datenwüste, wissen ganz genau, was für ihre intellektuellen Mündel das beste und schlechteste ist, und schwingen, um die geistige Volksgesundheit besorgt, eine permanente Rede von Gefahren und Nebenwirkungen, als handele es sich bei der digitalen Revolution um eine schwerverdauliche Arznei, die nur äußerst dosiert genossen werden dürfte und auf deren Einnahme alle außer den wirklich Schwerkranken am besten verzichten sollten.
Die Liste des Elends, das die Technik über die bislang ja von ihr noch recht unberührte deutsche Kulturlandschaft bringen könnte, ist schier unendlich. Eine Auswahl aus den vergangenen Monaten: E-mail verwildere die Briefsitten und zerstöre die handschriftliche Persönlichkeit des Kontakts, die menschliche Signatur. Das Internet sei wie Fernsehen, nur teurer und unbequemer. Die heraufziehende Cyberökonomie begünstige die Globalisierung und damit das Sinken des deutschen Lohnniveaus. Das Internet sei unnötig, denn Gemälde und Fotos sehen in Museen und Hochglanzbänden besser aus. Das WWW sei ein Geldgrab, für Kunden wie Anbieter. Bildschirmarbeit mache krank. Der Cyberspace sei Sammelplatz für sozialschädliche Sekten und Verrückte, die man sonst nicht mal in den Leserbriefspalten zu Wort kommen läßt. Im Internet finde sich nichts als plumpe Werbung der Konzerne. International operierende Cyber-Nazis drohten, die abwehrgeschwächte deutsche Seele zu vergiften. E-Cash enthemme die Konsumlust. Im Cyberspace verkümmere sozialer Kontakt. Online produziere psychische Abhängigkeit, die durch die hohen Kosten des Internet in den finanziellen Ruin führe. Von der virtuellen Pizza, die man den Menschen aufdränge, werde keiner satt. Die Echtheit der Nachrichten sei im WWW nicht gewährleistet. Handel im Cyberspace werde die Arbeitslosigkeit explodieren lassen. Wer am Online-banking teilnehme, werde der menschlichen Wärme in der Schlange vorm Schalter beraubt. Onanistischer Cybersex verhindere die Zeugung von rentenrechnerisch nötigem Nachwuchs; das wenige, was noch nachwachse, falle in die virtuellen Klauen von Kinderpornographen. Und so endlos weiter, keinen bedenkbaren intellektuellen Um- und Irrweg vermeidend.
Doch die Energie ist größtenteils verschwendet, denn die Objekte all dieser fürsorglichen Bevormundungen, die breite Bevölkerungsmehrheit, zeigt ohnehin wenig Neugier auf all das Neue, um dessen Bedeutung und Regulierung die Elite sich balgt. Was die neuen Kommunikationsmittel angeht, verfährt die Masse der Menschen in der Alten Welt nach dem Altberliner Motto: Gar nicht erst ignorieren.
So wenig gesichert alle Zahlen sind, die den Cyberspace statistisch und demographisch erfassen wollen, in der Tendenz laufen alle Untersuchungen auf dasselbe hinaus, und die stimmen exakt zu meinen eigenen Beobachtungen im Kreis der Verwandten und Bekannten: Mit Computern geht, von wenigen Ausnahmen abgesehen, hierzulande nur um, wer unbedingt muß. Dasselbe gilt für elektronische Kommunikationsformen. Das Potential der neuen Technik, den ungeliebten Alltag zu revolutioieren, wird nicht genutzt.
Ein paar Zahlen aus jüngster Zeit, die die Größenordnungen andeuten: 90 Prozent aller Angestellten arbeiten in den USA an Computern, in Westeuropa lediglich 53 Prozent. 30 Prozent aller US-Haushalte haben PCs - was wenig genug ist -, keine zehn Prozent in Westeuropa. Und von den restlichen 90 Prozent wiederum denken 80 Prozent überhaupt nicht daran, sich so ein Teufelsding ins Haus zu holen. 76 Prozent aller Deutschen sind obendrein, wie es in derselben Emnid-Umfrage heißt, "strikt gegen eine Netz-Anbindung" - die Formulierung allein klingt nach Unfreiheit, so als solle da Michel-Prometheus an digitale Felsen gekettet werden.
Wie das Leben in Europa heute ist, sei es zwar schlecht, meint eine Mehrheit; daran lassen die diversen Umfragen keinen Zweifel. Aber Veränderung möchte man wenn, bitteschön, gerne im Sinne von Rückgängigmachen. Die Konstellation ist klar: Klagen über eine vermeintlich verwirrende und in ihrer Reizvielfalt und Innovationsflut ermüdende Gegenwart, Idealisierung einer national-idyllischen Vergangenheit, die es nie gab, Zukunftsangst anstelle von Zukunftsperspektive.
Am schönsten formuliert hat dieses paneuropäische Phänomen jüngst Claudius Seidl in einem Bericht über die Berliner Filmfestspiele, in dem er das europäischen Sorgenkino analysierte. Die Zukunft, schrieb er, sei "aus Europa nach Amerika ausgewandert".
Melancholie am Ende der Epochen
"Ach, ich bin müde - ich bin nervös,
ich weiß nicht, was ich will ..."
(Arthur Schnitzler, Anatol, 1893)
Weltschmerz, Ennui, existenzielle Müdigkeit, das Leiden an einer unbefriedigenden Gegenwart bei gleichzeitigem Verzicht darauf, diese Gegenwart aktiv in Richtung einer weniger unangenehmen Zukunft umzugestalten - ein solches Arsenal von Denk- und Verhaltensweisen ist nun allerdings aus der Literatur- und Sozialgeschichte bekannt. Man spricht in diesem Falle psychischer Krankheit von Melancholie.
Unter ihr litten zu historischen Zeiten Angehörige privilegierter Schichten - etwa des höfischen Adels im 17. und 18. Jahrhundert, des Rentier-Großbürgertums in der Wiener Jahrhundertwende -, Gruppen also, die vom Existenzkampf weitgehend entlastet waren.
Ihre Melancholie war subjektives Symptom einer objektiven Konstellation. Melancholiker, schreibt Wolf Lepenies in seiner einschlägiger Studie zu "Melancholie und Gesellschaft", leiden unter "Weltverlust", weil "sie vom Handeln als einem Wirken in der Welt abgeschnitten sind".
In der Regel waren die Gruppen, die sich zu historischen Zeiten in die Melancholie retteten, relativ wohlhabend und relativ machtlos zugleich. Als kritischer Begriff beschreibt Melancholie so die Denk- und Verhaltensweisen, mit denen auf diese unbefriedigende Situation reagiert werden kann, ohne sie zu ändern: masochistische Koketterie mit dem eigenen Leiden, ins Unendliche reflektierende Skrupel, die sich als intellektuelle Einsicht tarnen, Entschlußlosigkeit, die als Moralität daherkommt und erfolgreich jede aktive Einflußnahme auf das Weltgeschehen verhindert. Dazu im Alltag ein System der kalkulierten Ausbrüche, kleine Fluchten in obsessive Leidenschaften, Rettung in die Einsamkeit der Natur, die regelmäßige Reise.
Melancholie, diese existenzielle Müdigkeit, diente so stets als Veränderungsabwehr. Sie war eine Verarbeitungsform des schlechten Gewissens darüber, daß man die eigenen Hoffnungen und Ideale zum Zwecke des Privilegienerhalts verraten hatte, und sie war ein Weg, die psychischen Spannungen zu mindern und das weitere Funktionieren im sozialen Kontext zu gewährleisten. Denn der adlige Melancholiker und auch der bürgerliche Rentier hatten schließlich guten Grund, eine radikale Veränderung der beklagten Lebensverhältnisse, wie sie historisch anstand und aus individueller Einsicht oft auch für nötig gehalten wurde, nicht allen Ernstes ins Auge zu fassen. Der Preis für den Erhalt der ungeliebten, aber privilegierten Gegenwart war der Verzicht, sich als Individuum wie als Schicht mit seiner Zukunft noch allen Ernstes zu beschäftigen.
Zu ihren historischen Blütezeiten war die Melancholie jedoch stets mehr als die psychische Verfaßtheit einzelner Privilegierter. In verkrusteten Gesellschaften, zu Zeiten und an Orten, wo die Geschichtsbewegung für einen Augenblick angehalten schien, verkörperten die Melancholiker Sozialcharaktere, in deren Wehleiden sich breite Schichten von Zeitgenossen selbst erkannten - ihre verhinderten Sehnsüchte, ihre Ängste. Mit dem reichen Rentier Anatol etwa, im müßiggängerischen Liebesschmerz zerrissen zwischen den Mondainen seiner Schicht und den süßen Mädels der Vorstadt, stiftete Arthur Schnitzler zur Zeit der letzten Jahrhundertwende kulturelle Identifikationsfiguren für das deutschsprachige k.u.k.-Bürgertum und insbesondere für die Wiener Intelligenz.
Denn auch damals gab es Grund genug zur Furcht vor anstürmenden Veränderungen. Im Zuge der Ablösung der Landwirtschaft als dominierendem Produktionszweig durch die Schwerindustrie, die in der rückständigen Donaumonarchie ein wenig später als in Frankreich oder England oder auch Deutschland stattfand, revolutionierte sich das Arbeits- und Alltagsleben. Neue Verkehrs- und Kommunikationsmittel wie Auto, Telefon, Kino beschleunigten den Umschlag von Nachrichten und Waren und veränderten den einst so viel "gemütlicheren" zwischenmenschlichen Umgang.
Neue Schichten entstanden, und Millionen, denen der Fortschritt zu schnell ging, sahen ihre soziale Identität in Frage gestellt, suchten nach Sündenböcken und nach Führern, die versprachen, den ungebremsten Fortschritt schlicht zu verbieten - von der Maschinisierung der Arbeit bis zum Wuchern der Städte, in denen der Zuzug begrenzt werden sollte, nicht zuletzt um der Überfremdung und einer angeblich wachsenden "Unmoral" Einhalt zu gebieten.
Einerseits, auf der Seite von Macht und Masse, also das Aufkommen populistischer Massenbewegungen, die nationalistisch, feindlich gegenüber anderen Ethnien und auf Verbot oder zumindest "Kanalisierung" der Innovationen gerichtet war; andererseits, auf der Seite der feinsinnigen Schichten, die die gefährdete Kultur trugen, melancholische Weltflucht, spöttische Distanz und existenzielle Müdigkeit. Will sagen: gewisse Parallelen der damaligen Umbruchszeit zur Gegenwart drängen sich auf.
Heute, beim abrupten Wechsel von einer Ökonomie, die auf Stahl basierte, zu einer, die sich in Silikon realisiert, beim Wechsel von der industriellen zur digitalen Epoche, stehen nicht minder Lebensweisen auf dem Spiel. Unter den ökonomischen Bedingungen der digitalen Epoche werden immer weniger Normalbürger einen "festen Arbeitsplatz" besitzen, weder einen bestimmten Ort, an dem sie sich einzufinden haben, noch die lebenslange Festanstellung. Mit ihrer ökonomischen Grundlage zerfällt auch die wohlgeordnete Zivilisation der Massen, die damals, im 19. Jahrhundert entstand. In den entwickelten westlichen Ländern befinden sich Gesundheits- wie Erziehungssystem in einer Dauerkrise, der Verkehr bricht Stück für Stück zusammen, Verbrechen und Umweltschäden eskalieren. Nicht eine, sondern nahezu alle Institutionen des öffentlichen Lebens, die das industrielle Zeitalter gebar, die staatlichen Bürokratien, die politischen Parteien, die Gewerkschaften, die Massenmedien, wirken sklerotisch und verlieren unablässig an Glaubwürdigkeit - selbst bei denen, die zu ihren Nutznießern zählen.
Von der Müdigkeit zur Mündigkeit
Verantwortlich dafür ist natürlich die digitale Ökonomie. Sie nämlich bietet dem einzelnen eine ökonomische Freiheit, die historisch ohne Beispiel ist - und komplettiert so die politische Freiheit der entwickelten westlichen Demokratien, die historisch ja ebenfalls ohne Beispiel war und ist. Wir, die Kinder des industriellen Zeitalters, haben diese Freiheit allerdings erst zu erlernen. Noch sitzen die meisten von uns, jenen Tieren gleich, die im Käfig aufgewachsen sind, bewegungslos in unseren alten, engen Verhältnissen und starren ängstlich auf die plötzlich weit offene Gittertür.
Was an Neuem am Horizont heraufzieht, mag erschrecken - doch es läßt, mit jedem Tag ein bißchen mehr, auch ahnen, was nunmehr möglich wäre. Selbst in den Regionen der industrialisierten Welt, die bislang von den gröbsten Krisen verschont blieben, selbst in Deutschland, erscheint einer immer größeren Zahl von Menschen das Leben unter den gegenwärtigen Durchschnittsbedingungen daher als bleischwere, eben ermüdende Last - die reglementierte Arbeit in den denkblockierten Großapparaten, die Hemmung jeder Eigeninitiative, ihr Versickern in Gremien und Antragsverfahren, die gebremste Bewegungsfreiheit in den verstopften Städten, die unbequeme Organisation des Alltags.
Diese systematische Verhinderung von Selbständigkeit machte zu industriellen Zeiten ihren Sinn. Sie war ein Ergebnis des kolllektiven, arbeitsteiligen Produktionsprozesses und sie diente in weiten Teilen ja nicht nur der Einschränkung des Einzelnen, seiner Anpassung an die Bedürfnisse industrieller Produktion, sondern auch seinem Schutz vor Beschädigung und Ausbeutung durch andere Mitglieder der Massengesellschaft, die sich zuviel Freiheiten nehmen könnten.
Dieser Teil der Unfreiheit, die Betreuung und Absicherung durch "Vater Staat", hat in den entwickelten Wohlfahrtsstaaten eine Sorte von Privilegien geschaffen, die gerade im Bereich der akademischen Intelligenz strukturell denen der Wiener Rentiers ähneln - im Vergleich zu jenen, die schon keinen Arbeitsplatz mehr haben, und erst recht im Vergleich zu jenen in vielen anderen Weltgegenden, in denen derlei Wohlfahrtsverhältnisse nicht herrschen. Gleich den Melancholikern der Wiener Jahrhundertwende sehen sich daher auch die Intelligentesten der Nutznießer des gegenwärtigen Systems vor das Dilemma gestellt, daß sie, um der Einsicht in den Geschichtsprozeß zu folgen, sich gegen die eigenen Interessen entscheiden müßten.
Der Käfig mag ein Käfig sein, doch man wird gut gefüttert. Die Freiheit hingegen, die draußen wartet - wer weiß, die könnte fürchterlich sein. So bleibt man also lieber, wo man sitzt, verbietet sich jeden Blick über den Rand des vergoldeten Käfigs hinaus und versucht weiter, das alte Leben zu führen. Doch wie früher ist es nicht mehr. Denn nun weiß man ja, daß es eine Existenz auf Abruf ist, daß man jederzeit auf alles gefaßt sein muß, und dieses Wissen macht den überholten Alltag, den man mühsam konserviert, so anstrengend, so ermüdend.
Der Rentier der Wiener Jahrhundertwende, war ein Typus, und wie jeder Typus war er auch ein Stück weit übertriebene Karikatur. Die Gattungsbezeichnung die Arthur Schnitzler für den Einakterzyklus wählte, dessen Held Anatol war, lautete schließlich "Melancholödie". Sein aktuelles Aquivalent, der kulturtragende bundesdeutsche Geistesarbeiter mittleren Alters und mittleren Einkommens, läßt sich so überzeichnen: leicht gebückte Persönlichkeit, in der sich die Last seines Lebens ausdrückt, die verantwortungsbeladene Stellung und das Leiden an ihr; dazu der leise, schwer nachdenkliche Sprachgestus, der asketische Verzicht auf jeglichen Enthusiasmus, die Neigung zu endlosen Kettenreflexionen, die alles in Frage stellen und so zu nichts kommen, zu keinem Handlungsentwurf, zu keiner Empfehlung, zu keiner theoretischen Erkenntnis, die in Zukunft Konsequenzen haben könnte, ja am Ende nicht einmal mehr "guten Gewissens" zu irgendeiner gesicherten Aussage auf dem begrenzten Gebiet, auf das sich der betreffende Professor, Lehrer oder auch Kritiker spezialisiert hat (wobei letztere, das muß zur Ehrenrettung der freien Kritiker gesagt werden, von den Zwängen des Marktes getrieben, von denen die verbeamteten Kollegen entlastet sind, sich immer wieder gezwungen sehen, die eine oder andere klare Feststellung zu treffen - für die sie sich jedoch, drauf angesprochen, prompt schämen).
Diese epidemische Resignation der kulturtragenden Schichten, ihre freiwillige Selbstbescheidung, die dem Erhalt der eigenen, insgeheim als überholt erkannten Privilegien dient - die nach einigen Jahren natürlich prägend wird und dann nicht mehr so freiwillig ist -, hat die Neigung zum weitgehenden Verzicht produziert, Utopisches noch denken oder gar realisieren zu wollen.
An die Stelle der verdrängten Zukunft ist die unablässige Reflexion aufs Vergangene getreten, die spöttische Entwertung des technischen Fortschritts, ja bisweilen offene Technikfeindlichkeit und damit der Wille zum Krieg gegen die Zukunft; kurzum: die realexistierende Traumlosigkeit nicht nur in der bundesdeutschen Gegenwartskultur, von der ich aus eigener, teils realer, teils virtueller Anschauung reden kann, sondern wohl, wenn man den Nachrichten von Freunden und in den Medien trauen kann, auch der Frankreichs und anderer westeuropäischer Länder.
Der Weg aus diesem Dilemma scheint ebenso einfach wie schwierig. Er besteht in der Aufhebung der Denkblockaden, die man sich aus Eigeninteresse auferlegt hat. Auf Dauer läßt sich die rückständige Existenz ohnehin nicht bewahren. Die grassierende Müdigkeit beseitigen wird nur Mündigkeit - der freiwillige Schritt aus dem Versorgungskäfig, die Bereitschaft, am globalen Markt der Ideen wieder mitzumischen, sich seiner Konkurrenz auszusetzen.
Geschlossene Gesellschaften nämlich, Menschengruppen, die sich abschotten, die die Grenzen und ihre Phantasie dicht machen, gehen an sich selbst zugrunde; man zerfleischt sich, man kocht in der eigenen Nestwärme, man erleidet den entropischen Wärmetod.
Die Offenheit, von der ich spreche, meint allerdings nicht nur die Bereitschaft, die Kindlein zu sich kommen zu lassen, um sie anzuhören, sondern auch und vor allem die Bereitschaft, selbst neue Wege zu gehen.
Während der Konferenz wurde bemerkt, daß der europäischen Gesellschaft im allgemeinen und der deutschen im speziellen augenscheinlich der amerikanische Wille fehle, immer weiter zu gehen, sich mit dem Erreichten nicht zu bescheiden, immer neue Grenzen zu überschreiten. Florian Rötzer, der das sagte, verkürzte dabei bewußt. Denn er weiß es besser, er selbst schrieb vor kurzem in "Telepolis" von den im "doppelten Sinne in der Alten Welt Zurückgebliebenen". Und in der Tat, Amerika ist kein fremdes Land; dort, in der Neuen Welt, leben all die Vertreter alter Völker (und ihre Nachkommen), die es in der überkommenen Enge nicht mehr aushielten und auszogen, größere Freiheit zu suchen - die Anti-Melancholiker, die Resignationsverweigerer, die Nimmermüden.
Timothy Leary sprach einmal von einem Prozeß darwinistischer Auslese, an dessen Ende Amerika stehe: Die gesamte Menschheit habe ihr abenteuerlichstes Gen-Material in die Neue Welt geschickt, und jene, die wiederum von denen am abenteuerlichsten gesonnen waren, seien dann weitergezogen von der Ostküste und haben die "frontier" erobert, den Wilden Westen - weshalb Kalifornien der aktuelle Hort der Utopie sei. Darüber mag man streiten, aber nicht streiten kann man über die simple Tatsache, daß bis heute diese Wanderung andauert, vorwiegend als "brain drain", als Verlust einiger der besten wissenschaftlichen und auch künstlerischen Köpfe Europas an Amerika. Zurück bleiben - nicht nur natürlich, aber überproportional - die Bedenkenträger, die Resignierer, die in ihr komfortables Elend verliebten Melancholiker.
Stoppen ließe sich dieser Prozeß nur, wenn Europa selbst wieder eine "frontier" böte, einen Freiraum für Abenteuer und abenteuerliche Geister jenseits der verwalteten Enge in der realen alten Welt. Der Cyberspace ist ein solcher Raum - noch. Die Krakenarme der Kontrolleure rühren sich bereits, und während den verfassungsfeindlichen Anstrengungen des amerikanischen Ostküsten-Politik-Establishment zumindest vorerst von der Justiz Einhalt geboten wurde, steigern die Staatsbürokratien in Europa und auch Asien immer unbekümmerter ihre Zensuranstrengungen - und Einhalt gebietet ihnen bislang nur ihre technische Inkompetenz.
Doch daß die wunderbare Freiheit im Cyberspace ein Beiprodukt der Isolierung des Datenraums von der Bevölkerungsmehrheit war, daß den Eroberern wie noch stets die Zäunezieher, die Geschäfte- und die Gesetzemacher folgen würden, war wohl jedem klar, der in den vergangenen Jahren diese Gründerjahrefreiheit genoß.
Freiheit ist ja kein Claim, den man sich ein für alle mal abstecken kann. Freiheit muß täglich neu erobert werden. Insofern kann auch der Cyberspace nicht die letzte Grenze, sondern nur eine Grenze mehr sein, die es zu überschreiten galt.
Andere, neue warten. Sie liegen, meine ich - doch mit solchen Meinungen liegt man in diesen akzelerierten Zeiten ruckzuck falsch -, im Mikro- wie im Makrobereich, sie liegen in der Nanotechnologie und in einer Besiedlung des Weltraums, die nicht länger von Staats wegen, sondern privat betrieben wird und damit nicht nur zugerichteten Befehlsempfängern, sondern freiheitssuchenden Individuen offensteht.
Europa könnte theoretisch - das heißt: angesichts seiner ökonomischen und intellektuellen Ressourcen - an der Erschließung dieser oder einer anderen terra incognita teilhaben. Nichts spricht dagegen außer der Verzagtheit der meinungsstiftenden Vordenker und der Ignoranz der politischen Führungseliten.
Ob ich an eine solche Überwindung der Müdigkeit in Richtung Mündigkeit glaube? Ob ich einen solchen radikalen Umbau der europäischen Gesellschaften für wahrscheinlich halte?
Ehrlich gesagt: In diesem einen Punkt bin ich ganz Europäer - hoffnungslos pessimistisch und der vergeblichen Anstrengungen lange schon müde.
