Der Brexit, die neuen Nationalisten und der neoliberal-demokratische Mainstream
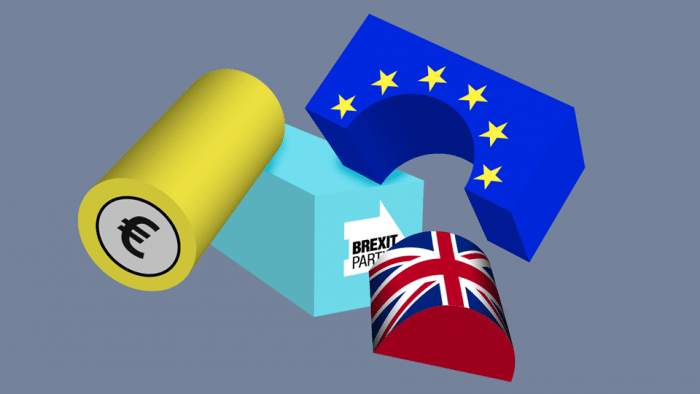
Die Widersprüche der Europäischen Union entfalten ihre Sprengkraft
Nun haben sie also gewählt, die europäischen Bürger und Bürgerinnen: Neben einer Klatsche für die konservativen und sozialdemokratischen Parteien und einem teilweise fulminanten Ergebnis der Grünen gelang es den Nationalisten, in Großbritannien, Italien, Frankreich und Polen als stärkste Parteien aus den Wahlen hervorzugehen; rechtsnationale oder rechtspopulistische Kandidaten siegten zudem in Ungarn, Tschechien und Slowenien.
Folgte man der Argumentation der Mainstream-Parteien des konservativ-sozialdemokratisch-liberalen Lagers, schienen die Rechten irgendwie vom Himmel gefallen zu sein; die Protagonisten der etablierten Union beschrieben im Kontrast zu ihren nationalistischen Konterparts die EU als Paradies an Handelsfreiheit, Personenfreizügigkeit und Friedfertigkeit, was sie den Wählern mit unterirdisch seichten bis belanglosen Wahlkampfsprüchen weismachen wollten: Europa war hier schlicht und einfach das Beste, was den Europäern passieren hat können - nur woher kamen dann die vielen, die das scheinbar nicht bemerkt hatten?
Neoliberaler Mainstream und Rechtspopulisten - Fisch- oder Fleischvergiftung?
Umgekehrt die "Brexiteers" in Großbritannien: Die Verarmung breiter Schichten der Bevölkerung Großbritanniens, die kürzlich offiziell von den Vereinten Nationen festgehalten wurde, zeigte sich den UN-Berichterstattern als Resultat einer radikal neoliberalen Politik, die das Land seit Margaret Thatcher geprägt hat. "Alles muss weg, was keine Rendite bringt! Und über die Rendite kann nur der Markt entscheiden!" Das war die Devise der Tories, aber auch von Teilen der Labour Party unter Tony Blair, der diesen Schwenk mit der nebulösen Umschreibung "New Labour" zu beschönigen versuchte.
Den hausgemachten Notstand der Europäischen Union in die Schuhe zu schieben, stellte die propagandistische Glanzleistung der "Brexiteers" unter Führung von Nigel Farage dar, der dafür das gesamte Arsenal des bodenständigen Nationalismus, bis hin zu offensiven Lügen, in Anschlag brachte. Farage, bewaffnet mit einer neuen, ganz auf ihn und den Brexit zugeschnittenen Partei, hat damit nun schon zum zweiten Mal einen bemerkenswerten Erfolg davongetragen.
Spricht das aber dafür, dass die Politik der EU nichts mit dem Sieg rechtspopulistischer Parteien in Europa zu tun hat? Mitnichten: Die gleiche EU hat, zusammen mit EZB und IWF in Gestalt der "Troika", Griechenland zwecks Rettung deutscher und französischer Geldhäuser unter ein Austeritätsregime gezwungen, das die Bevölkerung verarmt und die Ökonomie massiv beschädigt hat, wie der IWF selbst kürzlich zugab.
In Frankreich demonstrieren die Gelbwesten gegen wachsende Steuerbelastungen für die ärmeren Schichten und das infrastrukturelle Ausbluten der Provinz durch eine Politik der Schließungen und Privatisierungen. In Deutschland können sich viele bald das Wohnen nicht mehr leisten; der Niedriglohnsektor gedeiht und die sozialen Spannungen wachsen fast überall. In Südosteuropa herrscht angesichts der unterbezahlten bis desolaten Beschäftigungsbedingungen, die sich nach der ökonomischen Transformation dort etabliert hatten, ein Abwanderungsdruck, der die passiv sanierten Räume ausblutet und die Arbeitnehmer/innen in den Stammländern des europäischen Kapitalismus unter zusätzlichen Konkurrenzdruck setzt. Die EU-Agrarsubventionen fördern nach wie vor hauptsächlich die industrielle Landwirtschaft und tragen damit zur Zerstörung der Natur bei.
Wo sind die Ursachen für diese Politik zu finden? Die EU und ihre Mitglieder agieren im Rahmen eines politisch-ökonomischen Gesamtsystems konkurrierender kapitalistischer Staaten, die all jene ökonomischen Prinzipien und die darin eingeschlossenen sozialen Gegensätze, die den globalisierten Kapitalismus ausmachen, als "Sachzwänge" voraussetzen, akzeptieren und systemkonform zu steuern versuchen. Die Resultate dieser marktradikalen Politik haben die neonationalistische Rechte auf den Plan gerufen, da sich die Opfer des gnadenlosen Wettbewerbs offensichtlich erneut den Standpunkt einleuchten lassen, dass nicht das System der privatwirtschaftlichen Konkurrenz, sondern die (oft nur vermuteten) Konkurrenten von anderswoher schuld an ihrer Misere seien, was allein schon belegt, dass die hier nichts zu suchen haben.
Dieser elementare faschistische Übergang von den Konkurrenzresultaten eines gnadenlosen Wettbewerbs auf den Waren-, Kapital-, Wohnungs- und Arbeitsmärkten zu einer Beschuldigung von nicht zur halluzinierten "Volksgemeinschaft" gehörigen, "fremden" Konkurrenten, die einem das schöne urtümliche Volksgehege kaputt machen würden, richtet sich dieses Mal vor allem an den außereuropäischen Migranten aus, die noch dazu die falsche Religion haben; die falsche Optik sowieso. Ebenso gut verfängt der neonationalistische Verweis auf die EU als Ursache des Übels, wenn die Bevölkerungen der osteuropäischen Beitrittsländer bemerken, dass der dort stattgefundene industrielle Aufschwung in ihren Geldbeuteln kaum ankommt.
Damit entlasten sich die nationalen Eliten und verschweigen, dass sie selbst als Subventionsempfänger und Kooperationspartner der angesiedelten transnationalen Konzerne wie diese Nutznießer des abgestimmten Systems von kapitalistischer Ausbeutung durch Niedriglöhne und Ansiedlungssubventionierung sind, weshalb sich die Gerichte dort mit schöner Regelmäßigkeit mit Korruptionsanklagen konfrontiert sehen.
Insofern gehören sie schon zusammen, die Schönfärber aus dem "Mainstream" und die militanten völkischen Nationalisten von der Rechten: Letztere teilen alles, was das herrschende System für viele so ungemütlich macht - die meisten rechten Parteien von heute sind wirtschaftspolitisch extrem neoliberal -, möchten die kapitalistischen "Sachzwänge" aber nur auf die rassistisch ausbuchstabierten "Volksgenossen" angewandt wissen, denen eine Art Nationalparadies versprochen wird, wenn sich das Land erst einmal in ein exklusives Gehege, einen veritablen Nationalpark für die "Dazugehörigen" verwandelt hat.
Zu diesem Zweck werden jede Unbill und Interessenschädigung, die sich der nationalen Politik oder Ökonomie verdanken, der EU zur Last gelegt. Die neoliberal-demokratischen Verteidiger ziehen aus dem Aufstieg der Rechten keineswegs die Konsequenz, dass ihre eigene ökonomische Politik dazu beigetragen haben könnte, sondern halten schönfärberisch das abstrakte Ideal von der prima Staatengemeinschaft ("Europa ist die beste Idee, die Europa je hatte" u.ä.) gegen die "Spalter" hoch.
EU und Euro: Insgesamt ein widersprüchliches, unvollständiges Projekt
Welche Rolle spielt nun die europäische Gemeinschaftswährung Euro in dieser Auseinandersetzung? Eine Gruppe von Ökonomen hat kürzlich das widersprüchliche Mit- und Gegeneinander der Mitgliedsstaaten der EU bemerkt und den Euro für den von ihnen so wahrgenommenen "Riss durch Europa" verantwortlich gemacht. Ist es wirklich so einfach?
Wahr ist wohl, dass die vor dem Euro übliche Methodik der Konkurrenzverlierer unter den europäischen Staaten, durch Abwertung ihrer Währung den wachsenden Produktivitätsvorsprung der Gewinner, allen voran Deutschlands, preispolitisch einzudämmen, durch die Gemeinschaftswährung verunmöglicht wurde. Dies versetzte die ökonomische Führungsmacht der EU in die Lage, die Märkte der Süd- und Osteuropäer mit ihren effektiver, d.h. kostengünstiger produzierten Waren zu durchdringen und dabei viele traditionelle regionale Händler und Produzenten zu verdrängen. Ob in Land's End an der Küste von Cornwall, im hintersten Winkel des Douro-Tals in Nordportugal, auf der Peloponnes oder im andalusischen Hinterland: Aldi und Lidl sitzen überall.
Soweit ist die Rede vom ökonomischen Riss nicht ganz verkehrt: Deutschland hat die Folgen der Finanzkrise für sich und gegen die anderen genutzt - wie alle EU-Mitgliedsstaaten dies tun oder zumindest gerne getan hätten. Wobei die Nutznießer wie stets diejenigen darstellen, die respektvoll "die Wirtschaft" heißen; die herrschende deutsche Politik, ganz auf Wachstumssteigerung durch Exporterfolge und auswärtige Marktdurchdringung programmiert, öffnet ihren produktiven Firmen die Märkte, weshalb kaum eine wirtschaftspolitisch wichtige Politikerreise ohne Unternehmerriege im Gepäck auskommt.
Dennoch ist die Methode der Ökonomen bezüglich ihrer Taxierung der Wirkungen des Euro auf die innereuropäische ökonomische Differenzierung fragwürdig: Sie vergleichen eine Kontrollgruppe von Staaten mit angeblich "ähnlicher" Entwicklung, aber ohne Euro-Einführung mit den Euro-Beitrittsländern der EU und kommen zu dem Ergebnis, dass der Euro die Unterschiede zwischen diesen relativ verstärkt hätte. Inwieweit eine derartige Kontrollgruppe aus anderen Staaten aber überhaupt vergleichbar ist, hängt auch von deren politischer Ökonomie, ihrer wirtschaftspolitischen "Kultur" und vielen anderen tradierten sozialen und kulturellen Zusammenhängen ab, die sich den mathematischen Quantifizierungen der offiziellen ökonomischen Lehre nicht erschließen.
Das Argument, die komparativ-mathematische Methode seit "ganz gut etabliert" in der Ökonomie, ist an Dürftigkeit nicht zu überbieten: Welches falsche Weltbild, welcher Unsinn, von der Erde als Scheibe bis zum klassischen Lamarckismus, waren nicht wohl etabliert, bevor sie sich als falsch erwiesen? Gerade in der neoklassischen Ökonomie sind seit ewigen Zeiten einige Prämissen "wohl etabliert", die schon von vielen Kritikern (Marx, Keynes, Robinson usw.) widerlegt wurden und trotzdem innerhalb des Mainstreams weiterhin unbeirrbar behauptet werden, allen voran das Konstrukt des "homo oeconomicus".
Völlig offen und nicht modellierbar ist zudem die Frage, wie wohl in der Hochphase der Weltfinanzkrise 2008, dann der Euro-Krise 2010/11 die ominösen "Finanzmärkte" auf z.B. eine Lira reagiert hätten, die ständig abwertet. Den verbesserten Preisspielräumen im Export stehen nämlich dann Verluste der in der Landeswährung gehaltenen Papiere seitens der auswärtigen Investoren gegenüber, die in einer solchen Situation gut zu einem "Run" aus diesen Papieren hätten führen können - zumindest ist das Ergebnis in einer derartigen Sondersituation völlig offen und ex post nicht abzuschätzen, also auch keine Grundlage für empirische Komparatistik.
Der zentrale Grund für die gegensätzliche Entwicklung der Staaten innerhalb des Euro-Systems ist von wesentlich grundlegenderer Natur. Die ökonomische Konkurrenz der in der EU versammelten Nationalstaaten treibt den zentralen Widerspruch der EU hervor:
Einerseits mehr als ein loser Staatenbund sein zu wollen, der nach außen gemeinsam seine Interessen vertritt; die EU will ja als eigene supranationale Institution den anderen Weltmächten auf gleicher Augenhöhe, als politisches und ökonomisches, in Zukunft vielleicht auch als militärisches Subjekt gegenübertreten. Die dafür andererseits notwendige Abgabe von nationaler Souveränität wollten und wollen die unter dem Dach der EU versammelten Nationalstaaten aber nicht leisten; und dies in unterschiedlichem Grade: Großbritannien noch nie - mit folgerichtigem Endresultat; Deutschland, als Initiator und größter Nutznießer am anderen Ende des Spektrums gelegen, schon erheblich mehr, da es seine Erfolge als Maßstab für die anderen setzen kann. Generell wollen alle in der EU und daher mit(tels) ihr ihre nationalen Interessen gegeneinander, möglichst auf Kosten der Konkurrenten, verfolgen.
Der Euro ist damit nicht Ursache dieses Gegensatzes; umgekehrt wird schon eher ein Schuh daraus: Der Mangel der Konstruktion des Euros, der zwar von einer eigens geschaffenen europäischen Zentralbank herausgegeben, aber von keiner übergeordneten, souveränen europäischen Wirtschafts-, Geld- und Finanzpolitik bewirtschaftet wird, resultiert genau aus diesem Bedürfnis der eigensinnigen Nationalismen der Mitgliedsländer, die EU, also auch den Euro, als ihr Konkurrenzmittel gegen die anderen wahrnehmen zu wollen: Dies hat bei den ökonomischen Unterschieden bis Gegensätzen innerhalb der EU, deren institutionelle Souveränitätsmechanismen und supranationale Institutionen von den Beteiligten eben nur bedingt akzeptiert werden, in den schwierigen Zeiten nach der Finanzkrise zur Vertiefung des vorhandenen Produktivitäts- und Wachstumsgefälles und deshalb zur Unzufriedenheit mit dem Nutzen der EU für die jeweiligen Nationen geführt.
Die infolgedessen in mehreren Staaten an die Macht gekommenen Neonationalisten drehen nun den Spieß sogar um und machen die EU als supranationale Institution für alle Misserfolge ihres nationalen Ladens verantwortlich; auch diejenigen, die mit der EU nichts oder nur am Rande zu tun haben. Sie weichen die für das Vertrauen des Finanzkapitals in den Euro von den Mainstream-Parteien als bedeutsam erachteten Vereinbarungen selbstbewusst weiter auf, um die Belastbarkeit der Gemeinschaftswährung als supranationales Kreditgeld zugunsten ihrer nationalen politischen Vorstellungen nutzen zu können - ein Tauziehen, das den Euro von Anfang an begleitete, also nicht von den Rechtspopulisten erfunden wurde.
Fazit: Der Euro drückt den beschriebenen "Geburtsfehler" der EU aus, ist aber nicht dessen Ursache, sondern der von den EU-Führungsmächten Deutschland und Frankreich aus wohlverstandenen Eigeninteressen initiierte Versuch seiner Überwindung; ein Versuch, der unter den gegebenen Bedingungen notwendig mangelhaft bleiben musste, da er die ihm zugrundeliegenden Widersprüche nicht beseitigt, sondern vorausgesetzt hat.
Die widersprüchliche Basis der Europäischen Union: Die konkurrierenden Nationalstaaten lassen sich nur bedingt auf ein gemeinsames supranationales Institutionensystem ein
Die nationalistische Politikermannschaft überall, die nun das tendenzielle Scheitern der "alten" EU feiert, vertauscht eine rationelle Kritik an der einseitigen Ausrichtung der EU auf die Bedürfnisse der Ökonomie mit dem klassischen nationalistischen Perspektivenwechsel: Sie vertritt lauthals die Vorstellung, es läge am über-nationalen, "internationalistischen" Charakter der EU, dass die Institutionen der kollektive Daseinsvorsorge und die wirtschaftlichen Perspektiven der arbeitenden Mehrheit in den jeweiligen Heimatländern der Union unter die Räder kämen. Als ob die nationalen politischen und ökonomischen Eliten ihrer Mitgliedsländer nicht das gleiche politökonomische System organisieren und repräsentieren würden, das in Gestalt der EU nur deshalb eine Ergänzung durch transnationale politische Institutionen erhielt, damit die europäischen nationalen Macht- und Wirtschaftseliten sich in der globalen Konkurrenz mit den USA, inzwischen auch China, besser behaupten können.
Dass sie diesen für das kapitalistische Wirtschaftssystem existenziellen Konkurrenzkampf um rentable Geschäfte aber gleichzeitig, EU hin oder her, auch weiterhin innerhalb der EU gegeneinander führten und führen, war und ist der zentrale Widerspruch der EU, der sich in der Weltfinanzkrise, in der es keine Überschüsse mehr, sondern nur noch Schaden umzuverteilen gab, zuspitzte: Auf Kosten der EU, also der anderen, sich selber schadlos zu halten, indem man seine Interessen als allgemeines EU-Reglement durchzusetzen versuchte, war da die Devise der Stunde. Und das gelang nur - Deutschland, was den Zusammenhalt nicht gerade befördert hat.
Spätestens bei der Verteilung der Flüchtlinge aus den vom amerikanischen "War on Terror" ruinierten Staaten des Mittleren Ostens haben sich die ost- und südeuropäischen Staaten dann für das "Schäuble-Regime" der Finanzkrisenbewältigung mittels strafbewehrtem Kaputtsparen als neuer faktischer EU-Richtlinie gerächt und Merkel eine lange Nase gezeigt, die deshalb auf ihrer "Willkommenskultur" sitzen blieb. Offensichtlich wurde nämlich ebenso, dass es sich die maßgeblichen Akteure der EU mit der Dublin-Vereinbarung, dass diejenigen Staaten für die Geflüchteten zuständig sein sollten, bei denen sie zufällig qua Küstenlinien oder räumlicher Nähe zu den Kriegsgebieten strandeten, zu leicht gemacht und den "schwarzen Peter" Ländern zugeschoben hatten, die die Folgen der Weltfinanzkrise kaum in den Griff bekamen.
Bis zur Finanzkrise hingegen sahen auch die "schwächeren" EU-Staaten die EU als notwendiges bis nützliches Übel an, was durchaus eine reale Grundlage hatte: Mittels zahlreicher Fördertöpfe für Infrastruktur, Landwirtschaft und Soziales brachte die EU die Angleichung der Lebensverhältnisse in ihren "goldenen Jahren" durchaus ein Stück weit voran, wovon das vortreffliche Straßennetz bis in die tiefsten Provinzen Spaniens, Portugal und Italien ebenso zeugt wie die üppige Förderung der Landwirtschaft in den osteuropäischen Beitrittsländern.
Gleichzeitig profitierten die kapitalistischen Führungsnationen in der EU, allen voran Deutschland, von diesen neuen Märkten, die großen Geschäftsbanken schließlich von der Kreditwürdigkeit, die der Euro plötzlich der abgehängten EU-Peripherie verlieh, was deren Staatsführungen zu üppiger Verschuldung in der neuen, scheinbar grenzenlos vertrauenswürdigen Währung verleitete.
Damit machte die Weltfinanzkrise Schluss: Die Rechnung wurde präsentiert, zahlreiche Angleichungserfolge der letzten Jahre bis Jahrzehnte zunichte gemacht, indem die Krisenlasten auf den hochverschuldeten Staaten Süd- und Osteuropas abgeladen wurden - waren diese in der Lesart der "Sieger" doch selber schuld: Hätten sie halt nicht so viel Eurokredit beansprucht, müssten die "Finanzmärkte" nicht so misstrauisch sein! Die Opfer einer derartigen Austeritätspolitik bekamen Europa nun von einer Seite präsentiert, die die bisherige Kosten-Nutzen-Rechnung ihrer EU-Mitgliedschaft in ihren Augen gehörig relativierte oder gar ins Gegenteil verkehrte.
Mit dem Erstarken der rechtspopulistischen Parteien bei der Europawahl am Sonntag werden die bisherigen, gangbaren Verlaufsformen des Widerspruchs der EU, die etablierten institutionellen Formen des politischen Miteinanders als Mittel des nationalen Konkurrenzvorteils gegen die anderen Mitglieder nutzen zu wollen, wohl weiter erodieren bzw. in Frage gestellt; vor allem wird sich zeigen, ob auf dieser Grundlage noch politische Kompromisse in wichtigen Fragen erzielt werden können, die zu umsetzbaren Entscheidungsergebnissen führen.
