Die EZB: Herrschaft abseits von Volkssouveränität
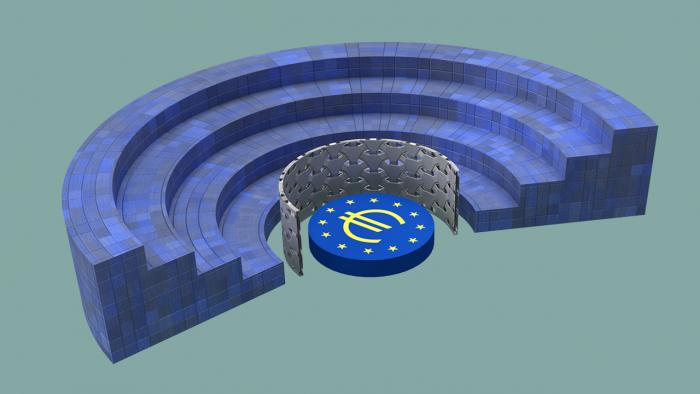
Die EZB agiert weitgehend unabhängig von demokratischer Kontrolle. Ihre Geldpolitik hat große ökonomische Verteilungswirkungen. Kann das gut gehen?
Der Anspruch der EU für den "Wert der Demokratie" zu stehen, wird von der Mehrheit der Parteien im Europawahlkampf als unabweisbare Wahrheit verkündet. Eine nüchterne Institutionsanalyse allerdings belegt, dass jedenfalls die Europäische Zentralbank (EZB) für sich keinerlei demokratische Legitimität beanspruchen kann.
„Nur Demokratie schafft Freiheit“ und „Wirtschaft liebt Freiheit, so wie Du“ lesen wir auf einem Plakat der Grünen respektive der Freien Demokraten zur Europawahl. Die Grünen und die FDP bekennen sich damit zum politischen Liberalismus. Die Ergänzung der FDP, eine liberale politische Ordnung ohne eine liberale Wirtschaftsordnung, die Verteilungsfragen dem marktwirtschaftlichen Preismechanismus überantwortet, nicht zu haben ist, wird im liberalen Mainstream der Politik ebenfalls kaum bestritten werden.
Der Weimarer Staatstheoretiker Hermann Heller, dessen Konzept der Sozialen Demokratie Eingang in das Grundgesetz gefunden hat, war dagegen der Meinung, dass die Wirtschaft als Politikum zu erkennen sei. Es sei Aufgabe einer demokratischen Regierung, so Heller, nicht nur die rechtliche, sondern auch die materielle Gleichstellung seiner Bürger zu gewährleisten. Was nach Meinung des Wirtschaftshistorikers Karl Polanyi einer institutionellen Einbettung von Marktmechanismen bedarf.
Retter in letzter Instanz?
Zentralbanken sind nach seiner Meinung solche marktbegrenzenden- bzw. korrigierenden politische Institutionen. Sie verhinderten eine „Unterordnung der Einkommens- und Beschäftigungsstabilität unter die Preisstabilität“.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020 zu dem von der EZB Mitte 2014 aufgelegten Staatsanleihenkaufprogramm lassen an einer solchen Interpretation der EZB-Politik Zweifel aufkommen. Denn die Karlsruher Richter hatten geurteilt, dass die Staatsanleihenankäufe den „Grundsatz der Verhältnismäßigkeit missachteten“. Ihr Vorwurf ist, der Ankauf von Staatsanleihen ökonomische Verteilungswirkungen habe, die sich nicht demokratisch legitimieren lassen.
Progressive Ökonomen weisen diesen Vorwurf entschieden zurück. Nach Meinung etwa des Spiegel-Kolumnisten Thomas Fricke belegen die massiven Ankäufe von Staatsanleihen durch die EZB, dass die EZB als "Retter in letzter Instanz" fungiere und "notfalls eben Geld reinschießt – solange das die Regierung nicht macht".
Zweifelsfrei haben die Anleiheankäufe durch die EZB vielen Ländern der Eurozone eine expansivere Fiskalpolitik ermöglicht. Von einer fiskalpolitischen Orientierung der EZB-Geldpolitik könnte man aber nur reden, wenn die temporäre Aussetzung der restriktiven Fiskalregeln der Eurozone auf Dauer gestellt würde. Die anhaltenden Diskussionen über eine Reform der europäischen Fiskalregeln geben zu dieser Hoffnung allerdings wenig Anlass.
Fiskalpolitische Blütenträume
Mit Wolfgang Streeck ist übereinzustimmen, dass schon die "Vorstellung abwegig erscheinen" muss, „dass in einer so vielfältigen Gesellschaftslandschaft wie Europa eine einzige, einheitliche, ungeteilte, zentralisierte Expertenregierung ausreichen könnte, um allen überall ähnlichen Wohlstand zukommen zu lassen“. Es ist diese unrealistische Vorstellung, die es aber erst erlaubt, die Staatsanleihenkäufe – als gemeinwohldienliche Fiskalpolitik zu interpretieren.
Die Geldpolitik der EZB hat nachweislich sowohl zwischen als auch in den einzelnen Euroländern zu einer zunehmende Einkommens- und Vermögensungleichheit geführt. Dennoch ist nicht zu bestreiten, dass die „unkonventionelle Geldpolitik“ von einer keynesianischen Idee inspiriert ist. Sie will mit den Staatsanleihekäufen eine zunehmende private Verschuldung ermöglichen, um damit das Wirtschaftswachstum in der Eurozone anzukurbeln. Diese Politik aber hat zu einer die Wirtschaftsentwicklung und Finanzstabilität gefährdenden Überfinanzierung geführt.
Die viel beschworene Zinswende ab dem Jahr 2023 mag daher als ein Schritt in die richtige Richtung erscheinen. Denn es wurden nicht nur die Leitzinsen erhöht, sondern auch die Beendigung der Anleihekäufe durch die EZB verkündet. Es ist aber nicht zu bestreiten, wie der Bankrott der amerikanischen Silicon Valley Bank (SVB) 2023 gezeigt hat, dass schon eine Reduktion der Ankaufsvolumina die Finanzmarktstabilität gefährden kann.
Was allerdings nicht für eine Fortsetzung der Anleihekäufe spricht, wie der Finanzmarktforscher Leon Wansleben vom Max-Planck-Institut in Köln einwendet. Denn aufgrund der Merkmale der Geldordnung würde damit "selbst mit den besten Absichten die selbstzerstörerischen Zyklen der finanziellen Expansion verstärkt". Nach seiner Meinung sollte daher der erhöhte Finanzierungsbedarf öffentlicher Haushalte primär über Steuererhöhungen gedeckt werden.
Notwendigkeit einer Geldsystemreform
Vor diesem Hintergrund scheint aus Sicht eines Sozialdemokraten politisch klüger, statt über die ungenutzten Möglichkeiten der staatlichen Schuldenfinanzierung zu klagen, auf Steuererhöhungen zu setzen. Damit aber bleiben die auf die Geldschöpfungsfähigkeit von gewinnorientierten Finanzunternehmen rückführbaren Dysfunktionalitäten des Finanzsystems unangetastet.
Was für eine "Vollgeldreform" im Sinne des Wirtschaftssoziologen Joseph Huber spricht. Die Einführung eines "digitale Euros" kann ein wichtiger Schritt hin zu einem solchen staatlichen Geldmonopol sein. Ein solcher Machtzuwachs der EZB ist aber ein zweischneidiges Schwert. Denn die EZB ist in keiner Weise von majoritären Staatsorganen abhängig, wie in Artikel 130 des AEUV unmissverständlich festgehalten wird.
Das essenzielle Merkmal demokratisch legitimierter Herrschaft ist aber eine Bindung exekutiver Staatsorgane an majoritäre Institutionen. Für Adam Tooze dagegen scheinen politisch unabhängige Zentralbanken kein Problem, sondern ein Segen:
Die Unabhängigkeit, die wir schätzen, beinhaltet die Freiheit des Urteils, den Schutz vor unmittelbarer Einmischung und die unabhängige Autorität, die Instrumente der Geldpolitik in dem Tempo anzuwenden, das die Umstände erfordert.
Streeck hat Aussagen nach diesem Muster als Glauben an eine "von Partikularinteressen gereinigte, sachgerechte Herrschaft eines neuartigen Philosophenkönigtums, unabhängig von Wahlen und Parteien" kritisiert. Was ihm prompt den Vorwurf von Michael Wendl einbrachte, dass er nicht verstehe, dass Zentralbanken "schwere ökonomische Krisen durch eine diskretionäre Geldpolitik, zu der der Ankauf von Wertpapieren zählt, erfolgreich zu steuern" vermögen.
Fazit
Das BVerfG hat mit seinem Urteil darauf aufmerksam gemacht, dass eine Beurteilung des "Erfolgs" der "diskretionären Geldpolitik" der EZB einer Prüfung ihrer Verhältnismäßigkeit bedarf. In einer parlamentarischen Demokratie kann nur ein gewähltes Parlament über die Frage nach der Verhältnismäßigkeit einer solchen "Geldpolitik" entscheiden.
Ein Parlament mit entsprechenden Interventionskompetenzen gibt es in der EU nicht. Man mag daher zwar „Europa“ als normativ wünschenswert und faktisch alternativlos behaupten, redet damit aber nur, wie der Politologe Dirk Jörke richtig festgehalten hat, einem „demokratiezerstörerischen europäischen Exekutivföderalismus“ das Wort.