Die Reichen sind die Schlimmsten
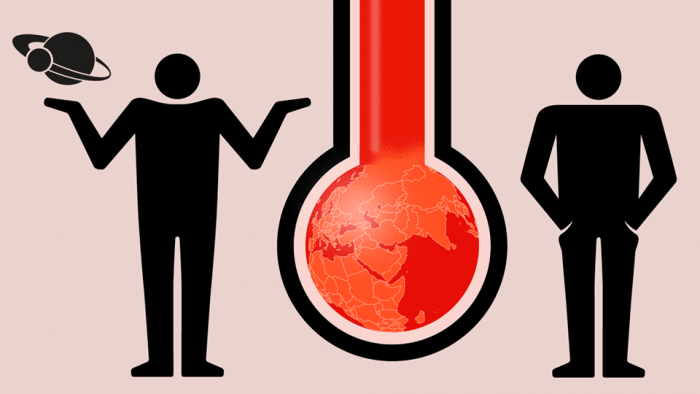
- Die Reichen sind die Schlimmsten
- Konkurrenz für die Grünen?
- Auf einer Seite lesen
Die Energie- und Klimawochenschau: Von der Ungleichheit der Verantwortung, neuen Klimaschutzprotesten, Tarifauseinandersetzungen beim ÖPNV und grünen Autobahnbauern
Von verschiedenen Seiten wird ja gerne auf die individuelle Verantwortung des Einzelnen verwiesen. Politiker machen das gerne, wenn sie sich vor für die Industrie schmerzhaften Entscheidungen drücken wollen, Journalisten, die meinen, dem Publikum einfache Lösungen präsentieren zu müssen, und verbitterte alte Männer, die finden, die Jugendlichen hätten ja alle Smartphones und sollten sich lieber an die eigene Nase fassen, statt ihre SUV zu kritisieren.
Auch mancher der jungen Klimaschützer von Fridays for Future tappt gerne mal in diese moralisierende Falle. Wie sehr man allerdings mit einem solchen Ansatz daneben liegen kann, hat dieser Tage eine Studie der internationalen Hilfsorganisation Oxfam gezeigt.
Demnach sind die Treibhausgasemissionen höchst unterschiedlich nicht nur unter den Ländern, die ja auch verschieden groß sind, sondern auch unter den Menschen verteilt. Ein erheblicher Teil geht vor allem auf das Konto der reichsten Teile der Erdbevölkerung, insbesondere, wenn nicht nur die mit dem individuellen Energieverbrauch, sondern auch die mit dem Konsum verbundenen Emissionen berücksichtigt werden.
Laut der Oxfam-Studie war das reichste Zehntel, das ein Jahreseinkommen von über 38.000 US-Dollar (32.400 Euro) hat, im Untersuchungszeitraum von 1990 bis 2015 für 52 Prozent der Kohlendioxidemissionen (CO2) verantwortlich. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung dagegen für lediglich sieben Prozent.
Können wir uns die Reichen noch leisten?
Das reichste Zehntel der Menschheit hat zugleich 31 Prozent des verbliebenen CO2-Budgets aufgebraucht, das uns noch verbleibt, wenn die Pariser Klimaziele eingehalten werden sollen. Die ärmere Hälfte hingegen nur vier Prozent. Gleichzeitig werden sie, die am wenigsten zur Misere beigetragen haben, als erste unter den Folgen des Klimawandels leiden. Weil sie in ungeschützten Küstenregionen leben, als Bauern unter den Folgen von Dürren und Überschwemmungen leiden, keine Ressourcen haben, sich und ihre Habe vor extremen Wetterereignissen in Sicherheit zu bringen.
Seit 1990 sind die Treibhausgasemissionen stark gestiegen, und zwar nicht nur in einigen Schwellenländern, namentlich China, sondern auch in vielen Industriestaaten, nicht zuletzt den USA. Über ein Drittel dieses Anstiegs, 37 Prozent, wird von den Autorinnen und Autoren der Oxfam-Studie den reichsten fünf Prozent der Weltbevölkerung zugeordnet.
Die Einkommen wurden als Kaufkraftparitäten auf der Basis der Verhältnisse von 2011 dargestellt. Die Autoren gehen davon aus, dass dadurch wohlhabende Bewohner ärmerer Länder reicher erscheinen. Auf der Basis von Wechselkursen hat das reichste ein Prozent der Bevölkerung viermal so viel Einkommen wie die ärmeren 50 Prozent. In Kaufkraftparitäten ist das Einkommen der oberen ein Prozent hingegen nur doppelt so groß wie das der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung.
Zum ungefähren Vergleich: In Deutschland betrug 2016 das Netto-Medianeinkommen 19.380 Euro im Jahr. Das heißt die Hälfte der Menschen hat ein geringeres und die andere Hälfte ein höheres Einkommen.
In Kaufkraftparitäten ist der Wert grobgeschätzt etwa 10 Prozent niedriger. Oder mit anderen Worten: Deutlich weniger als die Hälfte der Deutschen gehört zum reichsten Zehntel der Weltbevölkerung. Zeit also, bei der Frage der Emissionen konkreter zu werden, wie es die Schülerinnen und Schüler seit nunmehr über einem Jahr tun, indem sie zum Beispiel den Kohleausstieg bis 2030 fordern.
Globaler Aktionstag
Am kommenden Freitag soll dafür und für Klimagerechtigkeit wieder auf die Straße gegangen werden, und zwar in besonders vielen Städten und weltweit. Das Internationale Netzwerk der Schülerinnen und Schüler hat sich nämlich auf einen globalen Aktionstag verständigt. Demonstriert wird nicht nur hierzulande, in der Schweiz und in Österreich, sondern in knapp 1800 Städten in 150 Ländern.
Gleichzeitig stehen wir jetzt an einem Wendepunkt in unserer Geschichte: Wir sind die letzte Generation, die noch eine Chance hat, die Notbremse zu ziehen. Klimagerechtigkeit bedeutet, Ungerechtigkeiten zu überwinden, die dazu führen, dass einige Menschen von der Klimakrise sogar profitieren, während andere viel stärker unter ihren Folgen leiden.
Aus dem Aufruf zum globalen Aktionstag
Der Aufruf verweist weiter auf Aussagen der Weltgesundheitsorganisation, wonach ab 2030 jährlich 250.000 Menschen an den Folgen des Klimawandels sterben könnten. An Hitzestress, weil sich Malaria ausbreitet, weil Ernten durch Dürre und extreme Niederschläge zerstört werden. Alleine 2017 seien 18,8 Millionen Menschen durch Naturkatastrophen zur Flucht gezwungen worden.
Der Berliner "Tagesspiegel" hat aus Anlass des Aktionstages ein lesenswertes Portrait einiger der jungen Klimaschützer aus der Spreemetropole veröffentlicht, die von ihren Sorgen und auch den Schwierigkeiten in den Schulen berichten.
Derweil wurden bundesweit in nicht ganz 340 Städten Aktionen angemeldet, zum Beispiel auch in Erfurt, Würzburg und Kiel, oder auf Fehmarn, Sylt und Norderney. In manchen Städten finden mehrere Aktionen statt, um die Demonstrationen zu entzerren. Hygieneregeln sind den jungen Leuten in Zeiten der Pandemie nämlich ausgesprochen wichtig.
Unterstützung gibt es unter anderem von der evangelischen Kirche in Württemberg und den Omas gegen Rechts.Von den Gewerkschaften ist hingegen anders als vor einem Jahr beim globalen Klima-Streiktag am 20. September 2019 diesmal wenig zu hören.
Bündnis mit Gewerkschaften
Dabei hatten die FFF-Schülerinnen und -Schüler schon im Juni mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ein Bündnis für sozial gerechten Klimaschutz geschmiedet, das die Beteiligten seinerzeit in der Bundespressekonferenz vorstellten. Das Bündnis, so FFF-Sprecherin Luisa Neubauer bei dieser Gelegenheit, sei "der Beweis, dass sich soziale Absicherung und konsequenter Klimaschutz keinesfalls im Wege stehen sondern sich gegenseitig bedingen".
Inzwischen hat ver.di die Tarifauseinandersetzungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) begonnen. Die Gewerkschaft hat die Verbände der Kommunalen Arbeitgeber aufgefordert, einen bundesweiten Rahmentarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der mehr als 87.000 Beschäftigten abzuschließen. Diese würden in 130 kommunalen ÖPNV-Unternehmen in 16 Bundesländer täglich mehr als 13 Millionen Fahrgäste befördern.
Bereits im Vorfeld hatte es Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern sowie mit anderen Umweltschützern gegeben. Schließlich teilt man ein gemeinsames Ziel: den ÖPNV ausbauen und für Nutzer und Beschäftigte attraktiver gestalten. Am vergangenen Freitag gab es in rund 20 Städten einen gemeinsamen Aktionstag mit den örtlichen Fridays-for-Future-Gruppen.
Der ÖPNV kann seine Schlüsselrolle zur Erreichung der Klimaziele nicht erfüllen, solange die kommunale Kassenlage das Angebot bestimmt. 20 Jahre Sparkurs haben dazu geführt, dass die Beschäftigten am Rand der Belastungsgrenze stehen. Soll der ÖPNV eine Zukunft haben, muss endlich ausreichend ins Personal investiert werden. Die Verkehrswende kann darüber hinaus nur mit konsequentem Ausbau gelingen. Klimaschutz ist eine globale Herausforderung, die Verantwortung dafür kann nicht auf der kommunalen Ebene abgeladen werden. Bund und Länder müssen endlich Verantwortung übernehmen. Dafür brauchen wir nach mehreren Autogipfeln jetzt einen ÖPNV-Gipfel.
Christine Behle, stellvertretende ver.di-Vorsitzende
Der Gewerkschaft ist es erstmals seit fast zwei Jahrzehnten gelungen, die auf die einzelnen Bundesländer zersplitterten Tarifverhandlungen zu synchronisieren. Seit der einst bundesweit einheitliche Flächentarifvertrag für den gesamten öffentlichen Dienst zerbrochen ist, sind Arbeitsbedingungen und Entlohnung weit auseinander gedriftet. Inzwischen sind sie vielerorts so schlecht, dass die Betriebe Schwierigkeiten haben Fahrerinnen und Fahrer zu finden.
"60 Prozent aller Busunternehmen in Deutschland fehlen Kräfte und müssen deshalb Linien ausfallen lassen oder zusammenstreichen", wird ver.di-Sekretär Dirk Schneider von der Internetzeitung "In Franken" zitiert. In den nächsten zehn Jahren müssten mindestens 100.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden, denn rund die Hälfte der derzeitigen Belegschaft werde in dieser Zeit in Rente gehen. Neben einer Erhöhung der Urlaubstage auf 30 pro Jahr und besseren Überstundenregelungen werden unter anderem auch Schichtzulagen gefordert.
