Good vibes in the brain
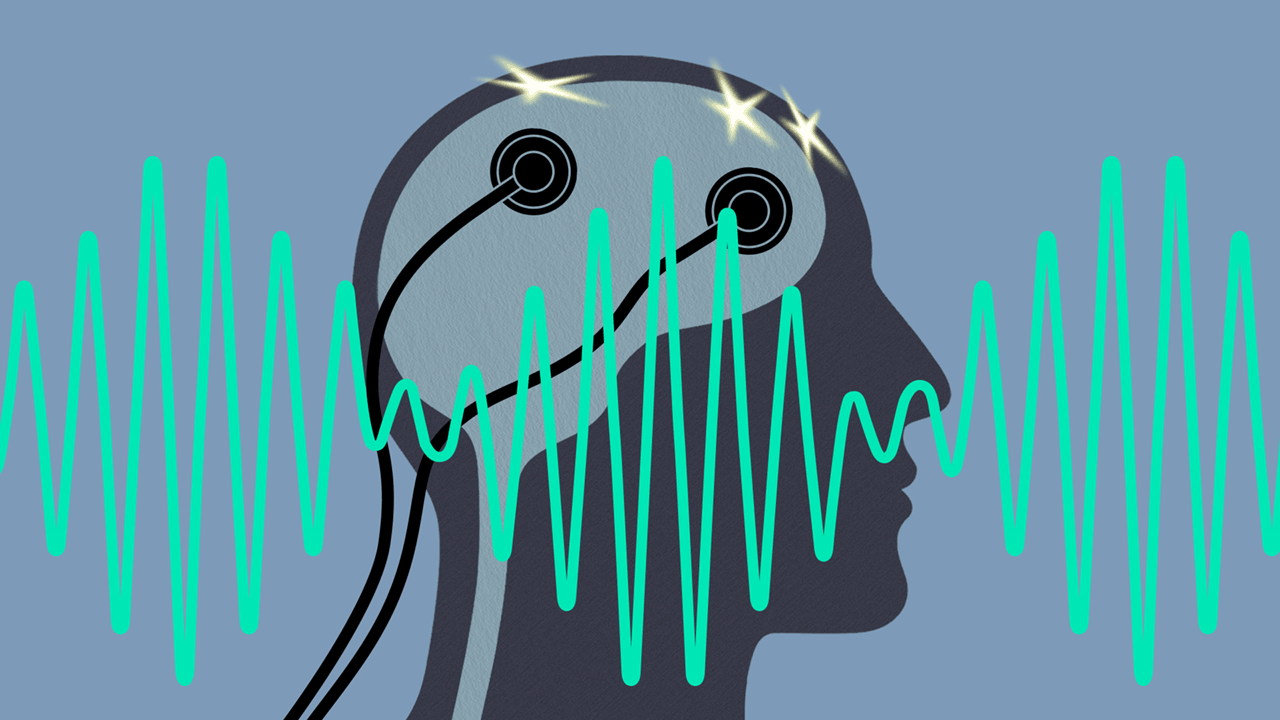
Die Aktivität der Nervenzellen in der Hirnrinde erzeugt die Wellen des EEG. Seit einigen Jahren entdecken Neurobiologen, dass sie mit rhythmischer Stimulation auch auf die Neuronen zurückwirken können
Vor ungefähr 15 Jahren schleppte meine Doktormutter einen komischen Kauz mit zauseligen Haaren zum Vortrag ins Institut. Günter Haffelder, so hieß der Mann, war Leiter eines selbstgegründeten "Instituts für Kommunikation und Hirnforschung" und Erfinder einer Wundermethode.
Wie er uns im Vortrag erzählte, leitete er das EEG von Patienten ab, Fourier-transformierte es (aber auf eine irgendwie besondere Weise), um die Signalstärke in den verschiedenen Frequenzbändern zu ermitteln, und stellte so fest, welche Frequenzen angeblich "fehlten". Dann erzeugte er für jeden Patienten eine spezielle Musik-CD - vorwiegend, selbstredend, mit Mozart-Stücken -, auf welcher er die fehlenden Frequenzen hochgeregelt hatte. Indem die Patienten diese CD hörten, sollten ihre Hirnwellen wieder in Ordnung gebracht und sie geheilt werden.
Und zwar so ziemlich egal, wovon. Depression, Psychose, ADHS, Legasthenie - you name it. Ja, sogar mit Querschnittslähmung hatte er schon vielversprechende Ansätze. Und außerdem war er mit seiner Yacht auch schon bei den Delphinen gewesen und hatte deren Hirnströme gemessen.
Hätte er ein Illuminatenzeichen auf der Stirn tätowiert getragen und von Chemtrails gefaselt, ich hätte nicht skeptischer sein können. Neben all den ganz offensichtlichen Warnzeichen waren daran auch inhaltliche Erwägungen schuld:
Erstens das Problem, dass eine kausale Rolle für die im EEG zu messenden Wellen unbekannt war und nicht wahrscheinlich schien. Diese Wellen entstehen als Feldpotentiale der Ströme, welche die radial zur Schädeldecke angeordneten Nervenzellen in der Hirnrinde bei ihrem Feuern durchlaufen. Wenn im Wachzustand jede Zelle vor und für sich hin rechnet und feuert, dann ist immer was los, aber es summiert sich wenig auf: hohe Frequenz, niedrige Amplitude. Versinkt die Hirnrinde dagegen in Schlaf, dann feuern viele Zellen synchron: niedrige Frequenz, hohe Amplitude. So einfach, so bedeutungslos.
Dass die EEG-Wellen mehr sein sollten als ein Epiphänomen, dass sie sogar kausal auf die Arbeit der Nervenzellen zurückwirken können sollten - dafür gab es keinerlei Anzeichen.
Als zweites erschien mir der Ansatz, die Hirnfrequenzen mit Musik zurechtrütteln zu wollen, auf einer Fehlannahme zu beruhen. Die Frequenzen des Schalls werden in der Hörschnecke umkodiert in eine räumliche Information - Auslenkung der Sinneszellen an bestimmten Stellen der Schnecke - und erscheinen im Gehirn dann nur noch als Feuern bestimmter Neuronen an entsprechenden Stellen.
Die Annahme, sie würden als Frequenz im Nervennetz erhalten bleiben, ist schlicht naiv. Zudem bewegen sich die Frequenzen des EEG akustisch unter der Hörschwelle oder dicht daran, eignen sich also schwerlich als Musik. Aber die Details der praktischen Umsetzung hielt Herr Haffelder immer streng geheim.
Und so war ich nicht bereit, der bemerkenswerten Offenheit meiner Doktormutter zu folgen, sondern stempelte Herrn Haffelder (der mir zudem ein Spätzlerezept anvertraute, das nicht funktionierte) als Scharlatan ab.
Jahre vergingen.
Lern, Kindchen, lern, . . . wir brauchen neue Wiegenlieder
In der Schlafforschung dient das Zittern der EEG-Linien als maßgebliches Kriterium zur Bestimmung der Schlafstadien. Wenn Gelerntes sich im Schlaf festigt (Schlaf, der Gedächtnisgärtner), kann man den Lernerfolg mit der Dauer der verschiedenen Schlafstadien korrelieren und hat so herausgefunden: Deklarative, also mitteilbare Gedächtnisinhalte profitieren von Tiefschlaf. Prozedurales Lernen, also Bewegungslernen durch Versuch und Irrtum, wird hingegen anscheinend eher im Traumschlaf verstärkt.
Kennzeichnend für den Tiefschlaf sind langsame Oszillationen: Wellen hoher Amplitude, die mit ungefähr 1Hz große Gruppen von Nervenzellen im Gleichklang schwingen lassen. Auf den Wellenbergen können rekapitulierte Erinnerungen besonders leicht in die Synapsen eingeschrieben werden. Der Tübinger Schlafforscher Jan Born, der den größten Teil zu diesen Erkenntnissen beigetragen hat, kam daher auf die Idee, ob man da nicht nachhelfen könnte: Lernt man besser, wenn das schlafende Gehirn im Rhythmus der langsamen Oszillation stimuliert wird?
Zunächst versuchten sie es mit transcranieller Magnetstimulation, also Magnetspulen, die außen am Schädel angelegt werden und über elektromagnetische Felder unmittelbar in die elektrische Aktivität der Nervenzellen eingreifen. Born und seine Mitarbeiter sendeten Wellen von 0,75Hz während des frühen Nachtschlafs, wenn wir normalerweise noch nicht in den ganz tiefen Schlaf sinken. Sie konnten damit nicht nur das Gehirn sofort und verfrüht in Tiefschlaf zwingen, sondern auch abendlich Gelerntes messbar festigen. Damit war erstmals gezeigt, dass die Wellen des Gehirns nicht nur Epiphänomene sind, sondern, in einer 180°-Wendung der Kausalität, ihrerseits die Arbeit der Nervenzellen verändern.
Wenige Jahre später setzten Jan Born und seine Mitarbeiter noch einen drauf. Anstelle magnetischer Felder nutzten sie einfach Töne. Ein leises Tut-Tut-Tut, gespielt während der Wellenberge der langsamen Oszillation, ließ diese länger andauern und verbesserte das Lernen von Wortpaaren. Dieselben Töne, gespielt während der Wellentäler, beendeten die Oszillation vorzeitig (konnten aber das Lernen nicht messbar stören).
Eine andere Arbeitsgruppe hat mittlerweile überprüft, ob sich dieser Effekt nicht nutzen lässt, um das nachlassende Gedächtnis älterer Menschen zu verbessern. Im Alter lässt auch der Tiefschlaf nach, sodass ein Zusammenhang naheliegend ist. Die Probanden wurden im Schlaf eine Nacht mit rosa Rauschen in Phase mit ihren langsamen Hirnwellen beschallt, in einer anderen Nacht war Stille. Das rhythmische Rauschen verstärkte ihre langsamen Oszillationen und ließ sie Wortpaare, die sie am Abend gelernt hatten, am Morgen deutlich besser behalten.
Ganz handfest und ein wenig skurril ging schließlich eine Genfer Forschergruppe vor, die für langsame Schwingungen sorgte, indem sie diese gleich dem ganzen Bett verpasste: Pendelnd aufgehängt, wiegte es ein Elektromotor während des Schlafs leise in vier Sekunden hin und zurück. Die gewiegten Probanden schliefen tiefer und fester und merkten sich besser, was sie am Vortag gelernt hatten.
Neuronen auf Trab bringen
Während die Schlafforscher die Neuronen schaukelten, zeigten andere Wissenschaftler bald auch am wachen Gehirn, dass Oszillationen nicht nur entstehen, sondern auch wirken. Da es logischerweise im Wachzustand keine langsamen Oszillationen gibt, konzentriert sich die Forschung auf das andere Ende des Frequenzspektrums - die Gammawellen. Sie treten mit ca. 40Hz im Zustand hoher Konzentration auf und sind ein heißer Kandidat für das "neuronale Korrelat des Bewusstseins" (wenn man letzteres im Gehirn sucht).
Appliziert man transcranielle Magnetstimulation der Sehrinde, dann nimmt die Versuchsperson Lichterscheinungen wahr; setzt man die Spule über die Fühlrinde (somatosensorischer Kortex), dann kribbelt und streichelt es (Übersichtsarbeit). Richtig praktisch wird es, wenn man die Magnetspule auf die Stirn setzt: Dann beschleunigt die Gamma-Reizung des Stirnhirns messbar das logische Denken, während bei langsameren Oszillationen nichts geschieht. Und als dieselbe Arbeitsgruppe die Spule übers Ohr platzierte, um den Schläfenlappen zu reizen - wo vor Jahren der neuronale Hotspot des Aha!-Erlebnisses gefunden wurde -, da erhöhte sie damit die Genauigkeit, mit der die Versuchspersonen plötzliche Einsichten beim Rätsellösen hatten.
Wenn das Gehirn aus dem Takt kommt
Da das gemeinsame Schwingen anscheinend so wichtig ist für die kognitive Funktion der Hirnrinde, ist es nicht erstaunlich, dass es in verschiedenen neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen gestört ist. In der Parkinson-Erkrankung ist es die Beta-Oszillation von ca. 20Hz, die während eines (scheiternden) Bewegungsversuchs erhalten bleibt, während sie bei gesunden Menschen in diesem Augenblick zurückgeht. Es gibt daher bereits erfolgreiche Versuche, diese Wellen durch Hirnstimulation zu unterdrücken. Bei Alzheimerdemenzpatienten beobachtet man eine Schwächung des Gammarhythmus, bei gentechnisch veränderten Mäusen, welche das menschliche Amyloidpeptid exprimieren und kognitive Einbußen zeigen, ebenso.
Da lag es nahe, auch hier den lahmenden Nervenzellen den Marsch zu blasen. In verschiedenen Alzheimer-Mausmodellen wurde in der Sehrinde der Gammarhythmus zunächst optogenetisch - also vermittels lichtempfindlicher Kanalproteine -, dann, als das erfolgreich war, einfach über Stroboskoplicht ausgelöst. Beides war erfolgreich: Die Immunfresszellen des Gehirns wurden aktiviert, die Zahl an Amyloidplaques sank drastisch.
Da man die Sehrinde eben zum Sehen, leider ab nicht zum Denken und Erinnern braucht, ließ sich ein funktioneller Effekt nicht leicht feststellen. Das sah anders aus, als die Forscher anstelle des Flackerlichts einen tiefen Ton von 40Hz verwendeten, denn die Hörrinde liegt unmittelbar in der Nähe des Hippokampus, der eine bedeutende Rolle für die Gedächtnisbildung spielt. Nun verschwanden nicht nur die Plaques in der Hörrinde, es verbesserte sich auch das Gedächtnis. (Dass der Brummton seine Frequenz ins Gehirn übertrug, erstaunt mich weiterhin.)
Und als sie beide Modalitäten kombinierten, wurden die Mäuse nicht etwa völlig rappelig, wie man erwarten könnte, wenn man sich vorstellt, unter Flimmerlicht einem sonoren Brummen ausgesetzt zu sein. Nein, der induzierte Gammarhythmus setzte sich anscheinend durch das ganze Gehirn fort und erreichte das Stirnhirn - mit der Folge, dass verschiedene genetische Mausmodelle der Alzheimer-Erkrankung neuronal und kognitiv gesund blieben.
Viele bunte Kiesel
Parkinson, Alzheimer . . . - bei der Lektüre eines Übersichtsartikels in Nature hatte ich geradezu ein Déjà-vu: "They aim to treat everything from insomnia to schizophrenia and premenstrual dysphoric disorder." - You name it. Günter Haffelder und meine Doktormutter waren anscheinend voll in Phase mit der Forschungswelle, als sie für eine gemeinsame Pilotstudie fünfzig Probanden einmal quer durchs DSM-IV rekrutierten. Laut dieser Untersuchung, die anscheinend nicht verblindet vorging, half Haffelders "neuroaktive CD" messbar bei verschiedenen psychiatrischen Symptomen, darunter v.a. Angsterkrankungen.
Leider ist die Musik in Günter Haffelders Gehirn vor knapp zwei Jahren für immer verstummt, und die Geheimnisse seiner Wundermethode werden wohl für immer verloren sein. Vielleicht habe ich ihm Unrecht getan. Wahrscheinlicher war er ein Dilettant, der neben vielen Kieseln auch manche Rohdiamanten fand und in ihnen allen unterschiedslos Juwelen sah.
