Industrie 4.0 - paradiesische Aussichten mit Marx und Keynes?
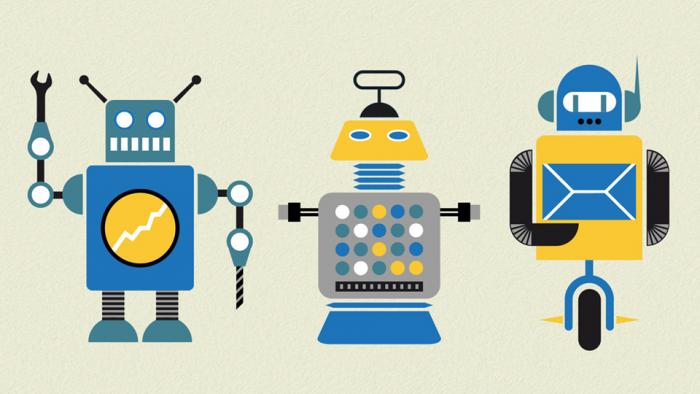
- Industrie 4.0 - paradiesische Aussichten mit Marx und Keynes?
- Kann der "steigende Wertschöpfungsanteil der Maschinen" verteilt werden?
- "Marx ohne Murks"
- Auf einer Seite lesen
Mit der umfassenden Automatisierung und Vernetzung der industriellen Produktion gedeihen Angst und Rettungsvorschläge
Als "4. industrielle Revolution" seit einigen Jahren in der Diskussion, weckt die mehr und mehr Fahrt aufnehmende Verschmelzung von IT und Produktion Befürchtungen, den Menschen könnte bald die Arbeit ausgehen: "Arbeitnehmer spüren, dass sich gerade gewaltig etwas ändert. Täglich künden die Medien, was neue Algorithmen, Roboter oder künstliche Intelligenz alles können. Im Zweifel mehr als sie, die Menschen. Maschinen, die ja 24 Stunden schuften, nie erkranken oder den Chef kritisieren, scheinen gerade die Zukunft zu besetzen." (Alexander Hagelüken, Marx für die Maschinenära, SZ vom 27./28. Oktober 2018, S. 26)
Dass den Menschen möglicherweise die Arbeit ausgeht, könnte eigentlich als gutes Zeichen gewertet werden, denn wenn die gleiche Menge oder mehr Güter mit weniger Arbeitsaufwand hergestellt werden können, sollte sich der Anteil der für individuelle Zwecke nutzbaren Zeit eigentlich vergrößern lassen. Gäbe es da nicht die gegenteilige Erfahrung, dass rationelleres Produzieren die Intensität und Dauer der Arbeit keineswegs verringert und die Einsparung ihres Arbeitsvermögens für die Beteiligen auch keineswegs mit einer Entspannung ihrer Arbeitssituation verbunden ist, sondern im Gegenteil sogar den Verlust des Arbeitsplatzes und somit ihrer Lebensgrundlage nach sich ziehen kann.
Der Grund dafür liegt darin, dass es den Unternehmen gar nicht um die praktische Nutzanwendung der von ihnen produzierten Güter geht, sondern um den finanziellen Erlös, der mit ihnen zu erzielen ist. Und die Arbeitskräfte, welche die zur Herstellung erforderlichen Arbeiten ausführen, interessieren die von ihnen gefertigten Güter ebensowenig, denn ihnen geht es um die finanzielle Vergütung ihrer Arbeitsleistung. Beide Seiten folgen darin lediglich ihren Interessen als Eigentümer von Kapital bzw. Arbeitsvermögen, und die sind nun mal ausschließlich auf den Gelderwerb ausgerichtet.
Die aus Kostensenkungsgründen beim Unternehmer jederzeit willkommene Einsparung von Arbeitskosten durch Rationalisierung und Automatisierung der Produktionsverfahren führt deshalb auf Seiten der Beschäftigten nicht zu einer ihnen zugute kommenden Verringerung des Arbeitsbedarfs, sondern stellt ihren Beschäftigungsstatus in Frage. Denn das unternehmerische Motiv dafür, Arbeit einzusparen, liegt ja gerade nicht darin begründet, den Beschäftigten durch Rationalisierungsmaßnahmen ein weniger anstrengendes Arbeitsleben zu ermöglichen, sondern den Kostenfaktor Arbeit zu reduzieren. Und daran fortwährend tätig zu werden, entspringt nicht einer den Unternehmern gern unterstellten moralisch fragwürdigen "Gier" nach immer mehr, sondern dem Umstand, dass die Konkurrenz ihre Arbeitskosten gleichfalls zu senken bemüht ist, was wiederum als alternativlose Aufforderung genommen wird, es jener gleich tun oder besser noch darin vorausschauend aktiv zu werden, will man nicht ins Hintertreffen geraten und dadurch das eigene Geschäft gefährden.
Der unter Privateigentümern von Produktionsmitteln herrschende Konkurrenzzwang ist deshalb durchaus als das zu nehmen, was er ist, nämlich eine sachliche Notwendigkeit, an der es nichts zu rütteln gibt, auch wenn die auf Entscheidungen von Managern beruht, denen man im Konfliktfall gern unterstellt, sie hätten sich ja auch mal anders, nämlich das persönliche Schicksal ihrer Mitarbeiter berücksichtigend, entscheiden können. Konnten oder können sie aber nicht! Gegen Sachzwänge hat die Moral immer hintan zu stehen!
Mit der "Industrie 4.0" beginnt für Hagelüken die sogenannte "Maschinenära", ausgestattet mit einem folgenreichen Charakteristikum: "In fünf Jahren könnten Maschinen mehr Arbeit erledigen als Menschen." Was die Zukunftsängste lohnabhängiger Bürger befeuere, müsse allerdings gar nicht so wörtlich genommen werden, denn "die Angst vor dem Fortschritt habe sich nie bewahrheitet. Es entstanden für die alten Tätigkeiten einfach immer neue", und viele vormals kräftezehrende Arbeiten würden mittlerweile durch Maschinen erledigt.
Wo es um "Chancen" geht, herrscht immer ein Mangel an realen Möglichkeiten
"Fortschritt", so kann daraus geschlossen werden, schafft einerseits Arbeitserleichterung, ist andererseits aber auch immer dann am Werk, wenn die Industrie Arbeitsplätze durch Maschinen ersetzt und die daraus resultierenden Arbeitslosen vor existenzielle Probleme gestellt werden! Letzteres sei nicht zu ändern, meint Hagelüken:
Die Menschen können nicht wissen, was geschehen wird. Aber das ist weniger dramatisch als es klingt. Entscheidend ist, dass sie Herren des Verfahrens bleiben - und eine Vision für das neue Maschinenzeitalter entwickeln.
"Eine Vision ..." entwickeln, wenn man gar nicht weiß, "was geschehen wird": eine wahrhaft herausfordernde Aufgabe! Als "Herren des Verfahrens" mit "Vision" dürften sich überflüssig gewordene oder zu werden drohende Arbeitskräfte eher nicht fühlen, denn darauf, ob sie ihren Arbeitsplatz verlieren, haben sie keinen Einfluss. Das brauche sie aber nicht bekümmern, denn "die Maschinenära lässt sich auch, ja: als Chance begreifen". Und Chancen sind ja überhaupt das Zauberwort, wenn es darum geht, den Leuten die Teilnahme an eher ziemlich aussichtlosen Konkurrenzverfahren schmackhaft zu machen: Wo es um "Chancen" geht, herrscht immer ein Mangel an realen Möglichkeiten, sonst müsste um die ja nicht konkurriert werden.
Allein aber die Aussicht auf die und mit genügend ausgeprägtem Eigeneinsatz betriebene Teilnahme am Wettbewerb um eine wie auch immer geartete "Chance" lässt optimistisch gestimmte Gemüter rasch vergessen, dass sie an einem Ausleseverfahren teilnehmen, welches nur eines mit Sicherheit hervorbringt: wenige Gewinner und viele Verlierer! Denn in Konkurrenzverfahren setzen sich immer diejenigen durch, die auf Leistung und Durchsetzungsbereitschaft getrimmt und persönlich bereits bestens an die funktionellen Aufgaben in bis auf's Letzte durchgetakteten Produktions- und Distributionssystemen angepaßt sind.
Sollte die anbrechende "Maschinenära" also massenhaft Arbeitsplätze kosten, ist die Zeit für neue "Chancen" gekommen. Denn es gebe ja auch "anspruchsvollere(n) Arbeitsplätze" als jene, die zukünftig durch Maschinen ersetzt würden. Arbeitsplätze, für die Eigenschaften wie "Kreativität, Überzeugungskraft oder Empathie" gefordert sind: "Etwas entwerfen und entwickeln, jemanden unterrichten, beraten oder sich um ihn kümmern."
Der gesamte Dienstleistungssektor ist ja ohnehin ein schier unerschöpfliches Reservoire an "Chancen"! Und für die schöne neue Welt des vernetzten Produzierens werden natürlich auch noch lebendige Arbeitskräfte benötigt, nämlich: "Datenalaytiker, Social-Media-Fachleute oder Verkäufer". Freilich, wenn digital gesteuerte und vernetzte Arbeitsprozesse weitgehend automatisiert ablaufen, müssen die programmiert und überwacht und die daraus resultierenden Produkte auch weiterhin beworben und unter's Volk gebracht werden. Und wem diese gar nicht so neuartigen Berufsbilder trotzdem nicht zusagen sollten, kann sich eben immer noch "kreativ" betätigen. Aber genau dafür sollen die Menschen von ihren unzeitgemäßen Erwartungen an ein gesichertes und möglichst ungestört verlaufendes Leben ablassen und sich auf lebenslanges Lernen einstellen, denn die Bedingungen, unter denen sie ihren Lebensunterhalt zukünftig werden verdienen können, erfordern ein großes Maß an Anpassungsbereitschaft und Flexibilität.
Hagelüken ahnt wohl, dass sich die Anforderungen an zukünftiges Arbeitsvermögen allein individuell nicht werden bewältigen lassen, fordert deshalb ein Umdenken und unterstützende Aktivitäten von Industrie und Politik und fände es prima, wenn die Regierung "Köpfe und Herzen der Bürger mit einer Digitalstrategie zu erobern suchte: Hier geht es um Eure Jobs und Löhne! Gestaltet die Zukunft, bevor Unternehmer oder globale Investoren über Euch entscheiden!" Die betroffenen Bürger würden sich einen derartigen Appell sicher sofort zu Herzen nehmen und sich zu eigen machen und die Gestaltung ihrer Zukunft entschlossen in Angriff nehmen!
